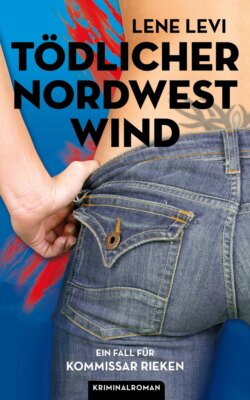Читать книгу Tödlicher Nordwestwind - Lene Levi - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеAls Robert vom Pferdemarkt in die schmale Gasse einbog, in der ein Kino und ein Café ums Überleben kämpften, gelangte er nach ein paar Metern auf eine mit groben Pflastersteinen angelegte Straße. Hier begann das Ziegelhofviertel, eine der inzwischen bevorzugten Wohngegenden der Stadt. Robert überkam bei seinen Streifzügen durch dieses Viertel immer wieder das Gefühl, er betrete an dieser Stelle eine Puppenstubenstadt, so klein und gediegen waren einige der Häuser. Die mit Rosen und Buchsbaumhecken bepflanzten Vorgärten waren ebenso winzig wie die Häuser selbst und von den davorliegenden schmalen Bürgersteigen konnte jeder Passant direkt in die Wohnzimmer der Menschen blicken. Jedes Mal, wenn er in der hiesigen Regionalzeitung las, Oldenburg wäre eine Großstadt, musste er schmunzeln. Dabei stimmte diese Einordnung durchaus, denn in der Stadt lebten über 100.000 Einwohner, genau genommen waren es sogar über 162.000. Und Jahr für Jahr nahm diese Zahl noch zu, denn Oldenburg hatte sich eine Gediegenheit bewahrt, die die Menschen, die hier lebten, sehr schätzten.
Aber es blieb nicht nur bei diesem Puppenstubenstadtgefühl. Schon nach wenigen Metern änderte sich der Gesamteindruck. In einem der nächsten und schäbig wirkenden Mehrfamilienhäuser, an dessen Außenfassade seit den letzten Weltkriegstagen offenbar keinerlei Renovierungen mehr durchgeführt worden waren, lebte Roberts Mutter nun schon seit vielen Jahrzehnten. Über einem der Kellerfenster dieses aschgrauen Gebäudes waren noch immer deutlich drei mit weißer Farbe aufgemalte Großbuchstaben LSR mit einem Richtungspfeil hin zur Fensteröffnung gut lesbar. Die alte Dame wunderte sich selbst am meisten darüber, dass sie es für einen Großteil ihres Lebens hier ausgehalten hatte, denn die Wohnung war alles andere als komfortabel.
Rixte Rieken war geistig noch sehr fit, fuhr sogar noch Auto, auch wenn inzwischen der klapprige R 4 immer mehr Beulen bekam, über deren Entstehung sie nicht sprach und auch nichts wissen wollte. Sie nahm am Leben noch regen Anteil, soweit dies ihre gesundheitlichen Einschränkungen erlaubten. Rixte litt schon jahrelang an unregelmäßig auftauchenden, nicht therapierbaren Migräneanfällen, an denen ganze Generationen von Fachärzten wie Spezialisten verzweifelt waren. Keiner der Mediziner konnte ihr jemals ein probates oder wirksames Mittel gegen ihr Leiden verordnen, sodass sie es irgendwann aufgegeben hatte, die gutgemeinten ärztlichen Ratschläge und Therapien zu befolgen. Mit zunehmendem Alter lernte sie ganz pragmatisch damit umzugehen und irgendwann akzeptierte sie es, mit ihrer Krankheit so gut es eben ging fertig zu werden.
Robert blieb für einen Moment vor dem Haus stehen und sah hinauf zu ihrem Wohnzimmerfenster. Er war beruhigt, da er die eingeschaltete Zimmerbeleuchtung erkennen konnte und die Bewegungen ihres Schattenbildes, das durch das Licht auf die Zimmerdecke projiziert wurde. Rixte einem trostlosen Altersheim auszuliefern, das hätte er nicht übers Herz gebracht, deshalb kümmerte er sich regelmäßig um sie. Er selbst bewohnte nur wenige Gehminuten entfernt eine Etagenwohnung in einem renovierten Gründerzeithaus. Diese Nähe erwies sich als sehr praktisch, denn wenn Markttage waren, besorgte er alle notwendigen Einkäufe und versorgte seine Mutter gleichzeitig mit dem allerneuesten Stadttratsch.
Robert mochte dieses Viertel sehr. Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Grundsteinlegung des Hauses, in dem er nun selbst wohnte, lies die etwas eigenwillige Hauseigentümerin ein Sandsteinrelief an die Hausfassade anbringen. Das steinerne Kunstwerk stellte eine barbusige junge Frau dar, die ganz verklärt in der einen Hand einen Joint hielt und in der anderen einen Backstein. Manchmal blieben Passanten davor stehen und betrachteten verwundert oder neugierig das Relief. Darunter hatte der Bildhauer eine Hinweistafel angebracht. Darauf stand der eindeutige Titel: Die Kifferin.
Robert kannte die Hauseigentümerin schon seit vielen Jahren, denn er wohnte früher schon einmal hier in diesem Haus, damals jedoch noch als Polizeischüler und Mitglied einer WG, die zum Teil aus schwer erziehbaren Jugendlichen und zum anderen Teil aus Studenten und schließlich der Vermieterin selbst bestand. Das kiffende Hippiemädchen an der Hauswand war vermutlich deshalb auch eine Art Reminiszenz an längst vergangene Zeiten. Als Robert sich um seine Versetzung nach Oldenburg bemühte und sich bereits abzeichnete, dass seinem Antrag stattgeben würde, war ihm der Gedanke gekommen, seine damalige Vermieterin im Internet ausfindig zu machen. Sie erinnerte sich tatsächlich noch an ihn. Und so war er, nicht ganz zufällig, zu dieser schönen Wohnung gekommen. Mit seinem Einzug schloss sich ein Kreislauf in seinem Leben und dieses Ereignis vermittelte Robert das Gefühl, genau an einem Ort angekommen zu sein, an dem einmal alles begonnen hatte - und wo er jetzt wieder hingehörte. Inzwischen lebten hier längst andere Mieter. Die WG existierte schon lange nicht mehr. Die alten Geschichten waren mit den einstigen Hausbewohnern ausgezogen. Eine Frau, die direkt unter ihm wohnte, besaß einen silbergrauen Jagdhund, der jeden Morgen in den Garten schiss. Robert mochte Hunde. Und über ihm schien ein junges Pärchen zu wohnen, das er zwar schon des Öfteren nachts gehört, aber bisher noch nie persönlich zu Gesicht bekommen hatte.
Mit den alteingesessenen Oldenburgern war er es dagegen nicht so einfach. Im Grunde hatte anscheinend nur er sich in den vergangenen Jahren verändert, so kam es ihm zumindest vor. Seine ganz persönliche Art, auf die Dinge des Lebens zu sehen und sie zu bewerten, war eine völlig andere geworden, seitdem er die Stadt irgendwann in den 80er Jahren verlassen hatte. Manchmal begegneten ihm in der Fußgängerzone vertraute Gesichter, die er jedoch nicht mehr namentlich zuordnen konnte. Seltsamerweise erkannten ihn selbst aber wesentlich mehr Leute aus früheren Tagen als umgekehrt. Wenn sie ihn fragten, wo er die ganze Zeit gesteckt habe und er dann erzählte, dass er in Berlin und anderswo gelebt und gearbeitet hätte, bekamen sie mitunter seltsam leuchtende Augen, als wäre Berlin das Gelobte Land oder gar die sächsische Elbmetropole Dresden ein exotischer Ort, der auf einer abgelegenen Südseeinsel liegt. So mancher seiner einstigen Weggefährten schien zwar unter der Beschaulichkeit und Trägheit der Stadt zu leiden, aber diesen Ort jemals für längere Zeit zu verlassen, dazu wäre kaum einer von ihnen bereit gewesen.
Dem Stadtfluidum war irgendein undefinierbarer Klebstoff beigemischt. Und eben diesen Leim spürte Robert nun selbst wieder unter den eigenen Schuhsohlen. Oldenburg war eine Klebestadt. Hier lebten scheinbar friedfertig mit- und nebeneinander Studenten und Bankangestellte, Esoteriker und Verwaltungsbeamte, Arbeitslose und Akademiker, Lehrer und Besserwisser, Fahrradfahrer und Altrocker. Und genauso stellten es die hiesigen Stadtväter auch sehr gern dar, wenn sie über die von ihnen selbst inszenierte »Zukunftsstadt« ins Schwärmen gerieten.
Die Fußgängerzone in der Innenstadt funktionierte im Grunde wie ein Kettenkarussell, sie war öffentliche Ringelpiezanstalt und zugleich auch die Buschfunkzentrale Oldenburgs. Für einen Kriminalkommissar ein ziemlich ergiebiges Terrain. Robert brauchte sich eigentlich nur eine Weile in eines der Straßencafés zwischen Staulinie und Theaterwall zu setzen, um von diesem Fixpunkt aus die vorüberziehenden Passanten zu beobachten. Nach kurzer Zeit hätte er alle Neuigkeiten erfahren, die diese Stadt derzeit bieten konnte, ohne dabei auch nur einen Fuß vor den anderen setzen zu müssen. Auch das gehörte mit zur Gediegenheit des Oldenburger Stadtlebens.
***
Der Wolkenbruch des gestrigen Abends brachte am Montagmorgen nicht die erhoffte Abkühlung. Es war noch immer heiß und schwül. Die Luft in dem Plattenbau, in dem die Polizeiinspektion untergebracht war, wirkte abgestanden und stickig. Robert wollte nur kurzzeitig sein Büro aufsuchen, um etwas Schreibkram und ein paar Anrufe zu erledigen. Er war noch immer ziemlich sauer auf seinen Chef. Da aber Heribert de Boer noch nicht zum Dienst erschienen war, entschied er sich dafür, die neue Woche möglichst ruhig anzugehen. Nach einer Stunde hielt er es in der Dienststelle nicht mehr aus. Er schwang sich auf sein Fahrrad und radelte in Richtung Innenstadt.
Kurze Zeit später schlürfte er an einem Glas Latte macchiato in einem der Straßencafés und beobachtete gelangweilt die Leute, als plötzlich sein junger Mitarbeiter auftauchte. Kriminalmeister Jan Onken, mit dem er sich seit einem halben Jahr das kleine Dienstzimmer und sogar den einzigen Schreibtisch darin teilte, legte Robert von hinten seine Hand auf die Schulter.
„Hab ich´s mir doch gleich gedacht, dass Sie sich hier vor der Arbeit drücken.“
„Im Gegenteil, Onken, im Gegenteil. Ich behalte die Szene der Kleinkriminalität im Auge. Immerhin werden pro Tag etwa acht Drahtesel hier in der Stadt geklaut. Da muss das Auge des Gesetzes stets wachsam sein. Sogar während der Mittagspause.“
Robert streute genüsslich braunen Rohrzucker in sein Getränk und beobachtete dabei das verblüffte Gesicht seines jungen Kollegen.
„Ah, verstehe. Mittagspause um 10 Uhr 30.“
Er ging auf diese ironische Bemerkung nicht ein. Jan legte das aufklappbare Kästchen mit dem Backgammonspiel auf den Bistrotisch und setzte sich zu Robert.
„Hat sich inzwischen das Betrugsdezernat gemeldet?“, erkundigte sich Robert.
„Nein, aber die Gerichtsmedizin hat vor etwa einer halben Stunde angerufen. Sie sollen zurückrufen, sobald Sie wieder im Büro sind.“
Jan war Ende Zwanzig und erst vor einigen Monaten von der Polizeiakademie Niedersachen direkt ins Oldenburger Kommissariat versetzt worden. Seine Gesichtszüge und sein ganzes Äußeres ähnelten auf merkwürdige Weise dem des englischen Prinzen William. Er kleidete sich überaus korrekt und bevorzugte dabei dunkle Strellson-Anzüge. Sein Haupthaar war für sein Alter bereits sehr dünn, auch darin ähnelte er dem englischen Thronfolger. Dadurch wirkte er viel reifer und gesetzter. Jan hätte sicher auch als smarter Banker eine gute Figur abgegeben. Ansonsten war er ein schlanker, sportlicher Typ, im Gegensatz zu Robert. Der Kommissar und sein junger Kriminalmeister waren schon deshalb rein optisch ein vollkommen ungleiches Paar. Robert wäre es am Beginn seiner eigenen Polizeilaufbahn wahrscheinlich niemals in den Sinn gekommen, mit Schlips und gebügeltem Hemd, geschweige mit einem teuren Anzug, zum Dienst zu erscheinen. Das war damals noch nicht üblich, aber so ändern sich die Zeiten. Ansonsten kam er mit Jan sehr gut zurecht und das war die Hauptsache. Beide hatten es von Anbeginn ihrer Zusammenarbeit geschickt verstanden, die gravierenden Generationsunterschiede und abweichenden Lebenserfahrungen mit allen damit einhergehenden hierarchischen Kompetenzproblemen, die leicht zu Konflikten führen können, in den Hintergrund zu stellen. Für Robert war vor allem eins wichtig: alle beruflichen Probleme effizient und gemeinsam zu lösen. Dienstränge oder Hackordnungen jeglicher Art spielten für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Er fühlte sich während seiner Arbeit an keinerlei Konventionen gebunden und Dienstvorschriften interessierten ihn schon gar nicht. Es reichte ihm aus, dass sie auf dem Papier standen. Der Alte konnte von dem Jungen ebenso viel lernen, wie umgekehrt. Robert hasste vor allem die anfallenden administrativen Tätigkeiten, die nur mit dem PC zu erledigen waren. Diese Arbeit wiederum empfand Jan als sehr notwendig. Datenbanken zu füttern, aufzubauen und zu pflegen, das gehörte zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Er war ja quasi mit dem modernen technischen Krimskrams aufgewachsen. Jan profitierte dagegen reichlich von Roberts kriminalistischem Spürsinn und seinen manchmal unorthodoxen Ermittlungsmethoden. Einen besseren Vorgesetzten hätte er sich eigentlich nicht wünschen können. Allerdings gehörten Fahrraddiebstähle nicht unbedingt zu den übermäßig verantwortungsvollen Aufgaben, die sie gern gemeinsam aufklären wollten, aber sie arbeiteten dennoch sehr erfolgreich in diesem Bereich. Das Team Rieken/Onken hatte es immerhin binnen weniger Monate geschafft, die Aufklärungsquote dieser Delikte schlagartig nach oben schnellen zu lassen. Sechs von acht Fahrraddiebstählen schafften sie, innerhalb weniger Wochen nach begangener Tat aufzuklären. Dazu gesellten sich neuerdings ganz gewöhnliche Wohnungseinbrüche und Autodiebstähle. Dagegen kamen Mord oder Totschlag in Oldenburg relativ selten vor. Und genau das war einer der Gründe, weshalb Robert seine Versetzung in diese Stadt angestrebt hatte.
Nachdem sie gemeinsam noch einige Partien Backgammon speilten, die allesamt Robert verlor, verließen sie das Café und kehrten ins Polizeirevier zurück.
Im Büro bekam Robert plötzlich Kopfschmerzen. Er trat an den Wasserkocher, um sich eine frische Tasse Tee aufzubrühen. Dann öffnete er beide Fenster, um einen Luftdurchzug zu ermöglichen. Aber es schien aussichtslos zu sein. Draußen bewegte sich kein einziges Blatt an den Bäumen. Jan saß an seinem PC und hackte auf der Tastatur herum. Von einem der beiden Bürofenster aus blickte Robert ins Grüne eines gegenüberliegenden alten Friedhofs, als plötzlich das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte. Frau Dr. Lin Quan, die Gerichtsmedizinerin, meldete sich. Robert nahm ab:
„Moin Lin. Du hast wahrscheinlich so einiges über die Wasserleiche herausgefunden. Stimmt’s?“
„Eines ist zumindest sicher, da hast du mir einen interessanten Fall auf den Seziertisch gelegt. Wann kannst du rüberkommen?“
Wer Lin Quan nicht kannte, hätte leichtfertig an einen ungewöhnlichen Fall von transnationaler Seelenwanderung glauben können. Sie war zwar Chinesin, aber gebürtige Oldenburgerin. Ihre Eltern waren Kanton-Chinesen und vor über drei Jahrzehnten nach Niedersachsen übergesiedelt. Sie betrieben seither einen Schnellimbiss im Stadtteil Nadorst, in dem Robert schon während seiner Ausbildungszeit häufig verkehrte, da das Essen dort gut und sehr preiswert war. Lin war ihm schon damals im Imbiss über den Weg gelaufen. Jetzt aber war aus dem kleinen chinesischen Mädchen eine attraktive und hochgewachsene Frau geworden. Für Robert war es immer wieder sehr reizvoll, eine Chinesin zwar zu betrachten, aber gleichzeitig eine typische Oldenburgerin zu hören, die alle sprachlichen und mentalen Eigenheiten ihres Geburtsortes bereits quasi mit der Muttermilch in sich aufgenommen hatte und so sprach, wie ihr der Schnabel gewachsen war. Ihre Physionomie und ihr Idiom passten irgendwie in der Vorstellungskraft der meisten Menschen noch nicht ganz zusammen. Und genau darin lag dieser sonderbare Reiz. Robert hatte im Laufe seines Lebens einmal einen Japaner kennengelernt, der lupenreinen bayerischen Dialekt sprach, weil er in Oberbayern aufgewachsen war. Auch war ihm schon mal ein Schwarzafrikaner über den Weg gelaufen, der einen derart stark ausgeprägten sächsischen Dialekt zu sprechen pflegte, dass selbst die eingefleischtesten Sachsen seine Aussprache nur schwer ertragen konnten. Nun war ihm in der »Zukunftsstadt« Oldenburg eine Chinesin begegnet, die kaum mehr norddeutscher sein konnte. Vielleicht lag darin tatsächlich der erste Schritt für eine nahe Zukunft, in der alle Grenzen und Herkunftsbarrieren keine Rolle mehr spielen würde.
Dr. Lin Quan und Robert waren sich zum ersten Mal seit seiner Rückkehr während einer Theateraufführung im Oldenburgischen Staatstheater begegnet. Sie besaßen beide ein Abonnement und beanspruchten zufälligerweise zwei nebeneinanderliegende Sitzplätze im Parkett 3. Reihe, ziemlich in der Mitte. Gezeigt wurde Charleys Tante, eine Komödie in drei Akten von Brandon Thomas. Eine langweilige Inszenierung. Während der Pause waren sie ins Gespräch gekommen und fanden bald heraus, dass sie auch beruflich für die gleiche Behörde arbeiteten. Bereits kurz nach ihrer ersten Begegnung begannen sie Freunde zu werden und verabredeten sich seither ab und an. Jetzt aber trafen sie eine rein dienstliche Verabredung.
„Wie wäre es mit heute Nachmittag? Sagen wir mal gegen 17 Uhr“, bot ihr Robert an.
Sie zögerte nur kurz. Dann sagte sie: „Gut, das passt. Aber ich empfehle, vorher nichts Schwerverdauliches zu dir zu nehmen. Das wird ver …“
Robert unterbrach die Gerichtsmedizinerin, noch bevor sie ihren letzten Satz vollständig aussprechen konnte.
„Oh ja. Genau, das habe ich bereits befürchtet, Lin. Erspare mir aber bitte jetzt am Telefon die allzu genauen Details.“
„Wie soll das funktionieren? Ich werde dir auf jeden Fall das kleine Geheimnis des Toten nicht vorenthalten können. Aber die Leiche besteht darauf es dir selbst zu erzählen. Sie liegt hier direkt vor mir auf dem Tisch und wartet schon auf dich. Also dann, bis nachher.“