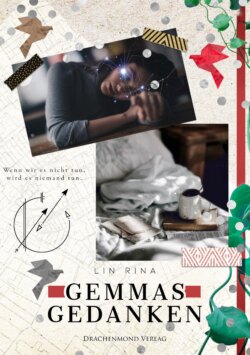Читать книгу Gemmas Gedanken - Lin Rina - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Krankenhausgeruch
ОглавлениеWährend ich auf die Bahn wartete, schrieb ich Vika. Sie sah die Nachricht jedoch nicht und hatte mir auch nach zehn Minuten noch nicht geantwortet. Ich spürte, wie ich langsam durchdrehte, wenn ich nicht auf der Stelle mit jemandem darüber redete. Mein Herz pochte schmerzhaft in meiner Brust und ich konnte mich kaum konzentrieren, als ich in den Waggon stieg, der direkt vor mir seine Türen öffnete.
Fahrig drehte ich mein Smartphone in den Händen, wusste nicht, was ich denken sollte und ein Zittern erfasste meinen Körper. Kälte keimte in meinem Bauch und ich rieb mir die Arme, die sich mit einer Gänsehaut überzogen.
Wenn Vika nicht erreichbar war, wen konnte ich sonst anrufen, der mich gut genug kannte?
Ich brauchte kaum zu überlegen, da entsperrte ich schon mein Handy und suchte Joris in meinen Kontakten.
»Gemma. Was geht?«, begrüßte er mich überschwänglich und ein bisschen atemlos, als er abnahm, und im Hintergrund hörte ich das hallende Brüllen von Männerstimmen wie aus einer Sporthalle. Er war beim Basketballtraining. Aber wenigstens nicht auf der Arbeit. Das wäre mir noch unangenehmer gewesen, ihn dort zu stören.
»Meine Mutter ist im Krankenhaus«, schluchzte ich ins Telefon und musste mich zusammenreißen, um nicht völlig die Nerven zu verlieren. »Papa sagt, sie hat sich selbst verletzt. Tante Laura behauptet, sie hätte versucht, sich umzubringen.«
Ich versuchte leise zu sprechen, doch eine Frau auf der anderen Seite des Ganges blickte mitleidig zu mir rüber.
»O nein. Gemma, das tut mir so leid.« Joris’ Stimme zu hören war ein echter Trost, weil ich wusste, dass er meine Gefühle in dieser Situation leider viel zu gut verstand.
»Wie geht’s ihr? Warst du schon bei ihr? Soll ich zu dir kommen?«, stellte er mir viel zu viele Fragen und ich schüttelte den Kopf.
Krampfhaft presste ich die Lippen aufeinander, um bloß nicht hemmungslos loszuheulen. Erst als ich mich einigermaßen wieder im Griff hatte, schaffe ich es zu antworten.
»Ich weiß nicht. Ich bin auf dem Weg ins Jenny-Menn-Hospital.« Ich schluckte schwer. »Ich war auf der Gesundheitsmesse und mein Paps hat angerufen.« Meine Stimme bebte und es schüttelte mich vor innerer Kälte.
»Ich treffe dich an der Haltestelle. Meine Halle ist nicht weit weg«, stellte Joris mich vor vollendete Tatsachen und ich hörte seine quietschenden Schritte auf dem Hallenboden.
»Du musst dir meinetwegen keine Umstände machen«, sagte ich und meinte es gar nicht. Eigentlich wollte ich, dass er kam und für mich da war und ich mich dieser beschissenen Situation nicht allein stellen musste.
»Bin schon auf dem Weg.« Etwas raschelte und seine Stimme klang von weiter weg. Wahrscheinlich hatte er das Telefon auf Lautsprecher gestellt und zog sich jetzt um.
»Warst du ganz allein auf der Messe?«, fragte er und ich legte meine Stirn auf meiner Handfläche ab.
»Nein, Luna und Jessy waren dabei. Wir sind für heute im Infozelt für die Ausbildung bei Biolog eingeteilt. Die beiden mussten dann natürlich bleiben«, erzählte ich ihm, auch wenn es mir völlig überflüssig erschien, darüber zu reden.
»Okay. Was habt ihr denn da so gemacht?«, wollte er weiter wissen und ich fühlte Wut in mir aufsteigen.
»Das ist doch unwichtig«, keifte ich ins Handy und im gleichen Moment tat es mir leid, so schroff gewesen zu sein.
Doch zum Glück schien Joris sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. »Ist es nicht, Gemma«, redete er gefasst auf mich ein und zeigte damit mehr Empathie, als ich ihm zugetraut hatte. »Du musst dich jetzt ablenken, bis du da bist, sonst drehst du durch. Also konzentrier dich auf was anderes und erzähl mir von der Messe.«
Ich seufzte laut und berichtete ihm von meinem ersten Auftrag als AIC-Technikerin. Joris hielt mich bei der Stange und fragte mich alle möglichen Sachen, damit ich mich bloß nicht dem Selbstmitleid hingab.
Als ich endlich die richtige Haltestelle erreichte, stand Joris bereits am Bahnsteig. Ich trat auf ihn zu, zitternd und mit verquollenen Augen von all den Tränen, die ich mir verkniffen hatte. Er öffnete lediglich die Arme und zog mich fest an sich.
Er roch nach frischem Schweiß und Männerdeodorant, und ich war einfach nur unendlich dankbar, dass er hier war und mich zum Krankenhaus begleitete.
»Du zitterst voll«, meinte er und rieb mir die Arme.
»Ich friere auch.« Schniefend zog ich die Nase hoch und löste mich ganz langsam aus der Umarmung.
Joris öffnete sofort den Reißverschluss seines Kapuzenpullovers, zog ihn aus und legte ihn mir um die Schultern.
Kommentarlos ließ ich es geschehen, zog mir den Handtaschenträger von der Schulter und schlüpfte in die Ärmel, die mir viel zu lang waren. Es passte überhaupt nicht zu dem eleganten Messeoutfit, das ich trug, aber das war jetzt egal. Wenigstens fühlte ich mich nicht mehr so entblößt in meiner dünnen Bluse. Wie ein Schutzpanzer gegen das, was jetzt kommen würde.
»Weißt du, was genau passiert ist?«, fragte Joris mich vorsichtig, schulterte seine Sporttasche und führte mich langsam zu der Treppe, die nach unten auf die Straße führte.
»Nein. Paps hat nur gemeint, sie hätte einen Anfall gehabt, mein altes Zimmer demoliert und sich dann selbst verletzt.«
»In deinem alten Zimmer war doch gar nichts mehr drin zum Demolieren«, merkte Joris an und ich nickte.
»Keine Ahnung«, sagte ich nur und wir überquerten die Straße an einer Ampel.
Ich wusste ja selbst nicht, wie ich mir das alles vorstellen sollte, was mich nur noch angespannter werden ließ und die Angst schürte. Papa und Tante Laura waren ja nicht mal so weit gekommen, mir zu sagen, was genau sie sich denn angetan hatte. Nur dass sie jetzt in den OP gebracht wurde. Bei der Vorstellung zitterte ich noch mehr und wickelte mir die Pulloverjacke fester um den Körper.
Als wir uns dem Krankenhaus näherten, wurden meine Schritte schneller, Joris’ jedoch langsamer.
Erst als ich merkte, dass er nicht mehr neben mir ging, blieb ich stehen und sah mich nach ihm um. Sein Gesicht war blass und er wich meinem Blick aus.
»Hier haben sie meinen Vater auch hingebracht«, sagte er und trat auf der Stelle.
Ich verstand. »Du musst nicht mit reinkommen«, versicherte ich ihm und er sah mich wieder an. »Wirklich. Ich danke dir so sehr, dass du mir geholfen hast, die Fahrt hierher zu überstehen. Du bist ein wahrer Freund. Auch wenn du jetzt nicht mit reinkommen willst.«
»Aber …«, machte er, ließ den Satz aber unbeendet. Es war zwar schon über zehn Jahre her, aber das alles mit mir mitzufühlen konnte nicht leicht für ihn sein.
»Mein Vater wartet drinnen auf mich. Geh zurück zum Training. Oder nach Hause. Ich schreib dir, sobald ich mehr weiß.« Zwar war ich immer noch voller Sorge und von Unsicherheit geplagt, doch ich fühlte mich schon wieder ein bisschen gefasster.
Joris nickte. »Den Pullover kannst du mir später wiedergeben. Ich werde mal meine Mum anrufen.«
»Gute Idee. Und vielen Dank«, wiederholte ich mich und drückte Joris kurz zum Abschied.
Es war nicht weit bis zum Haupttor des Jenny-Menn-Hospitals und ich bog auf den gepflasterten Weg ein, ging durch eine kleine Parkanlage zum Eingang der Notaufnahme.
Die Schiebetüren schlossen sich hinter mir und der Geruch von Desinfektionsmitteln stieg mir unangenehm in die Nase.
Vor meinen Augen verschwamm plötzlich alles, eine Frauenstimme schrie wie am Spieß meinen Namen und die Erinnerung an einen allumfassenden Schmerz schoss mir durch den ganzen Körper.
Doch dann war der Moment wieder vorbei und ich lag auf dem Boden des Krankenhausflures. Mein rechtes Handgelenk schmerzte, als hätte ich es mir umgeknickt, und der Inhalt meiner Handtasche war über den ganzen Boden verteilt.
Verwirrt und noch heftiger zitternd kam ich auf die Füße. Was war das denn gewesen? Stieg mir meine Sorge so sehr zu Kopf?
Auf wackeligen Beinen sammelte ich meinen Kram wieder ein und fragte mich, warum ich drei Päckchen Taschentücher mit mir herumschleppte. Wenigstens hatte mich bei diesem Missgeschick niemand gesehen.
Langsam wankte ich um die Kurve auf die Rezeption zu und versuchte, den Schmerz in meinem Handgelenk zu ignorieren. Gleichzeitig schob ich auch die befremdlichen Gefühle fort, die sich unter die Sorge um meine Mutter mischten und sich mir wie Säure ins Herz ätzten.
»Ich suche Ida Henson«, sprach ich die Frau an der Rezeption an und war viel zu durcheinander für eine Begrüßung.
Die Frau, eine Krankenschwester, sah mich nur kurz an, wie ich hibbelig und verwirrt vor ihr stand, und gab dann ohne ein weiteres Wort den Namen in den Computer ein, der neben ihr stand. Sie las die Informationen auf ihrem Bildschirm und blickte dann mit mitleidigem Blick zu mir zurück. Das war kein gutes Zeichen und ließ die Panik wieder an die Oberfläche kriechen.
»Sind Sie eine Angehörige?«, fragte sie mich und ich spürte, wie mir die Tränen kamen und der kalte Klumpen in meinem Bauch mich runterzog.
»Ist sie etwa gestorben?«, platzte es ängstlich aus mir heraus und die Krankenschwester stand hastig von ihrem Stuhl auf.
»Nein. Nein. Alles ist gut. Sie wird gut versorgt. Ich darf die Infos nur nicht an jeden rausgeben«, besänftigte sie mich sofort und kam um ihren Tresen herum, um mir den Arm um die Schultern zu legen.
»Ich bin ihre Tochter«, schniefte ich und sie führte mich mit kleinen Schritten in Richtung Fahrstuhl.
»Alles ist gut bei deiner Mutter. Sie ist im OP. Dort werden gerade nur die Schnittwunden an ihren Händen und Armen gelasert. Eine Routinesache. Ich bring dich nach oben«, bot sie mir an und wir stiegen in den Fahrstuhl mit grünen Wänden.
Ich versuchte langsamer zu atmen und wiederholte im Kopf die Worte der Krankenschwester. Alles war gut. Nur eine Routinesache. Doch warum hatte sie sich die Hände zerschnitten? Und womit? War es vielleicht möglich, dass es auch nur ein Unfall gewesen war und gar kein Selbstmordversuch?
»Schnitte in den Händen?«, fragte ich leise, als die Türen sich wieder öffneten und mein Blick sofort auf Papa fiel, der im Stechschritt hin und her tigerte.
»Paps«, rief ich, als ich ihn sah, und er hielt inne in seiner Rennerei.
»Gemma. Du bist hier!« Er drückte mich an sich und ich erhaschte im Augenwinkel, wie die Krankenschwester mit einem sanften Lächeln hinter den Türen des Fahrstuhls verschwand, bevor ich ihr danken konnte.
Doch ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf Papa, der total aufgelöst aussah. Seine sonst so säuberlich gekämmten Haare waren zerwühlt und die Krawatte hing einfach so um seinen Hals, da er den Knoten wohl gelöst hatte.
»Was ist denn passiert?«, konnte ich endlich fragen und Papa drückte mich so fest, dass ich kaum noch atmen konnte und meine Hand noch mehr schmerzte.
»Ich kam von einer Sitzung nach Hause. Mama ging es heute Morgen so gut, dass sie sogar Frühstück gemacht hat. Pancakes. Ich dachte, es wäre alles in Ordnung. Und als ich wieder heimkam, da …«, erzählte er und stockte.
Auch in meinem Hals steckte ein großer Kloß, der sich nicht schlucken ließ. Papa gab mich wieder frei, rieb mit den Händen über sein Gesicht, das gerade alt und müde aussah.
»Und dann?«, versuchte ich ihn zum Weitersprechen zu animieren und er nahm seinen Gang wieder auf und lief im Vorraum der OP-Station hin und her.
»Sie saß in deinem alten Zimmer. Sie hat die Hälfte deiner Bodendielen herausgerissen und wühlte im Dämmstoff herum, als würde sie etwas suchen. Überall war Blut und sie hat sich mit einem Cuttermesser die Finger und Arme aufgeschnitten.« Papas Stimme brach. So aufgelöst hatte ich ihn noch nie gesehen.
Doch obwohl mich seine Worte tief erschütterten, als ich mir versuchte vorzustellen, wie er Mama und meinen hellen Boden mit Blut verschmiert vorgefunden hatte, löste sich die Panik in meinem Kopf jedoch sofort auf und meine Gedanken wurden wieder klar.
»Es war kein Selbstmordversuch«, sprach ich meine Erkenntnis sofort aus und wusste im gleichen Moment auch, dass ich es meinem Vater nicht würde erklären können.
Denn unter meinem Boden hatte ich früher die geheimen Bücher versteckt. Und nach jedem Eintrag einen Schnitt in meinen Finger gesetzt.
Es war nicht das Gleiche, was Mama getan hatte, doch sie war im Wahn eines Anfalls in das gleiche Muster verfallen. Sie hatte lediglich ihre Gedanken für die Auslese unbrauchbar gemacht und nicht versucht, sich das Leben zu nehmen.
Doch wie konnte ich meinem Vater das sagen, ohne mich selbst zu verraten? Und woher wusste meine Mutter davon? Von dem Versteck unter meinen Dielen, von dem Schneiden in den Finger. Ich hatte es ihr nie gesagt und immer darauf geachtet, dass mich niemand dabei sah.
Doch irgendwie musste sie es gewusst haben.
»Was?« Papa sah mich verstört an.
»Ich kann’s dir nicht erklären, aber sie hat auf keinen Fall versucht, sich umzubringen«, versicherte ich ihm und atmete ganz tief durch. Der kalte Klumpen in meinem Bauch wurde ein bisschen wärmer.
Eigentlich änderte es nichts an der Tatsache, dass meine Mutter im OP lag und ihre Anfälle schlimmer waren denn je. Doch zu wissen, dass sie sich nicht umbringen wollte, war ein großer Trost.
»Bist du dir sicher?«, wollte Papa wissen und ich nickte energisch.
»Ja, bin ich. Wie ist Tante Laura auf solche Ideen gekommen?«
Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, da gingen die Türen neben uns auf und ein Arzt mit ernster Miene und einem Tablet in den Händen kam auf uns zu.
»Shawn Henson?«, sprach der Mann meinen Vater an und reichte ihm die Hand. »Die OP Ihrer Frau ist gut verlaufen und von den Schnitten sollten keinerlei Narben zurückbleiben«, informierte er uns, als ob wir uns wirklich Gedanken um Narben machen würden. »Sie wird gerade in Aufwachraum 303 gebracht. Wir verabreichen ihr angstlösende Medikamente, die sie in einem Dämmerzustand halten, bis sich ihr Körper ein wenig erholt hat. Über das weitere Vorgehen werden wir entscheiden, sobald uns die Ergebnisse des Bluttests vorliegen. In ihrer Akte sehe ich, dass Sie bereits einen großen Gesundheitscheck für sie beantragt haben. Den würden wir natürlich unter den gegebenen Umständen vorziehen.« Der Arzt machte eine professionelle Miene und ich klammerte mich an den Arm meines Vaters.
»Können wir zu ihr?«, platzte ich heraus, als der Doktor eine Atempause machte, und er blickte widerwillig zu mir.
»Ja. Sie ist jedoch in der nächsten Stunde nicht ansprechbar.« Seine Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf meinen Vater. »Wir würden Ihre Frau gern für die standardmäßigen Tests und ein großes psychologisches Gutachten die nächste Woche hierbehalten, wenn Sie zustimmen.«
»Aber natürlich«, ging Papa sofort darauf ein.
»Gut, der Papierkram liegt schon bereit. Nutzen Sie die Zeit bis zum Erwachen Ihrer Frau, um sich ein bisschen zu entspannen. Gehen Sie um den Block oder fahren Sie nach Hause und packen ein paar Sachen für ihren Aufenthalt hier«, redete ihm der Arzt gut zu und ich fühlte mich von dem Kerl total ignoriert. Als ob ich mir keine Sorgen machen würde.
Wieder reichte er nur meinem Vater die Hand und verschwand, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen.
Am liebsten hätte ich ihm in meinem aufgewühlten Zustand noch Gemeinheiten hinterhergerufen, doch Papa hielt mich davon ab, als er mir in dem Moment den Arm um die Schultern legte.
Er atmete tief durch und sah mich dann an. Sein Blick war durchdringend, als versuchte er etwas Bestimmtes in meinen Augen zu finden.
»Er hat recht. Ich muss hier kurz raus. Vielleicht hole ich wirklich ein paar Sachen für deine Mutter. Ihre Schwester ist auch noch bei uns und räumt auf«, seufzte er und strich sich mit der freien Hand die dunklen Haare nach hinten.
»Willst du mitkommen?«, fragte er mich und ich schüttelte den Kopf. Ich hatte kein Interesse daran, mir den blutigen Ort des Geschehens anzusehen.
»Nein. Ich werde solange hierbleiben und mich zu Mama setzen.«
»Tu das, tu das«, murmelte er, klang aber, als wäre er mit den Gedanken schon woanders.
Ich strich ihm einmal über den Rücken und spürte dabei wieder ein schlimmes Stechen im Handgelenk. Anscheinend war mein Sturz ganz schön übel gewesen, auch wenn ich mich nicht einmal erinnerte, gefallen zu sein.
Papa löste sich von meiner Seite und ging zum Fahrstuhl. Die Erschöpfung stand ihm ins Gesicht geschrieben und ich fragte mich, ob ich ihn wirklich allein gehen lassen durfte. Doch da schlossen sich auch schon die Türen und weg war er.
Unentschlossen trat ich von einem Bein aufs andere und wusste nichts mit mir anzufangen. Ich wollte ebenso gern sofort zu meiner Mutter, wie ich mich auch davor fürchtete, sie zu sehen. Ein leises Stimmchen in mir gab mir die Schuld an dem, was passiert war. Ich hatte die Bücher im Boden versteckt und mir ausgedacht, meine Auslese durch Schnitte in den Finger zu verarschen.
Als ich Schritte im Gang hinter mir vernahm und sah, wie sich der blöde Arzt wieder näherte, setzte ich mich sofort in Bewegung und verschwand hinter der Stationstür im nächsten Gang. An den Zimmern standen groß die Nummern und ich ging weiter, bis ich vor der 303 stand.
Bevor mich jemand sah, schlüpfte ich hinein.
Die Wände waren weiß mit einer rosafarbenen Bordüre und die Sonne schien durch die weißen Vorhänge. Alles war still und ich trat lautlos an das Bett heran, um die Ruhe nicht zu zerstören.
Meine Mutter lag darin und wirkte so blass wie die Bettwäsche. Ihre Arme waren mit Bandagen umwickelt, um die heilende Haut zu schützen, und eine Infusion führte von dort zu einem Gestell, an dem ein Beutel mit Flüssigkeit hing. Elektroden klebten an ihrer Brust, ein großes Pflaster hielt einen dünnen Schlauch in ihrem Hals und ein Gerät auf der anderen Seite des Bettes piepte leise im Takt ihres Herzens.
Mir zog es den Brustkorb enger zusammen bei ihrem Anblick und doch war es ein Stück weit beruhigend zu wissen, dass sie das Leben immer noch bejahte und uns nicht einfach so zurücklassen wollte.
Vorsichtig zog ich mir einen Stuhl heran, der unangenehm laut über den Boden quietschte, setzte mich neben das Bett und stellte meine Handtasche auf das nahe Tischchen.
Mein Blick ging zum Fenster, durch das ich das Schattenspiel von Blättern auf den Vorhängen beobachten konnte.
Seufzend schob ich die Hände in die Taschen der Pulloverjacke und achtete genauestens darauf, das Handgelenk nicht zu bewegen.
Was war nur los in letzter Zeit? Für mich fühlte es sich an, als würde sich ein seltsames Ereignis an das andere reihen. Wann hatte das alles angefangen? Als ich ausgezogen war? Danach, davor? Ich wusste es nicht und vielleicht war es auch gar nicht von Bedeutung.
Klar war nur, dass ich über all das schon viel zu viel nachgedacht hatte, als dass es in der nächsten Kontrolle nicht aufgezeichnet werden würde. Und obgleich ich wusste, dass sich dafür kein Schwein interessieren würde, hatte ich doch das nagende Gefühl, es wäre falsch, ihnen diese Information zu geben.
Ich schnaubte in mich hinein. Ihnen. Wer waren die denn? Ich wurde langsam wirklich paranoid.
Ich wünschte, ich könnte einfach aufhören, darüber nachzudenken, und den Dingen ihren Lauf lassen. So wie es sein sollte. Aber es kamen gerade zu viele Sachen zusammen, die sich nicht einfach ignorieren ließen. Die Anfälle meiner Mutter, meine eigenen Aussetzer, das Buch in der Wand, Ezra. Ließ sich das irgendwie zusammenbringen? Oder hatte es gar nichts miteinander zu tun?
Ich merkte erst, dass jemand den Raum betreten hatte, als ein großer Pappbecher neben meiner Handtasche auf dem Tischchen abgestellt wurde. Der Geruch von Kaffee stieg mir in die Nase und ich hob irritiert den Blick.
Hinter mir stand Oliver Grand, der auf mich herabsah.
»Oliver«, stieß ich überrascht seinen Namen aus und er lächelte mich schief an.
»Hast du mich schon vermisst?«, fragte er leise und mir fiel sofort auf, dass die gewohnte Leichtigkeit in seinem Tonfall fehlte.
»Woher weißt du, dass ich hier bin?« Irritiert starrte ich ihn an, während er sich ebenfalls einen Stuhl heranzog und dabei die gleichen lauten Geräusche verursachte wie ich zuvor.
»Luna hat’s mir gesagt«, behauptete er und ich traute meinen Ohren kaum. Ausgerechnet Luna, die so gar nichts von Oliver hielt.
»Ist es denn schon halb sechs?« Mit dem Blick suchte ich nach einer Uhr, fand aber keine. »Es tut mir so leid. Ich habe dir gar nicht Bescheid gesagt.«
»Nein, ist es nicht. Beruhig dich, Gemma«, redete er auf mich ein und sein zuvor aufgesetztes Lächeln wurde echter. »Ich war früher mit meinem Termin fertig und dachte, ich ärgere dich noch ein bisschen.«
Ich nickte nur, schaffte es nicht zurückzulächeln und sah zu meiner Mutter, die bewegungslos im Bett lag. Lediglich ihr Brustkorb hob und senkte sich, wenn man ganz genau hinsah.
»Wie geht’s dir?«, erkundigte Oliver sich ruhig.
»Beschissen.« Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück. »Es wird nur alles immer schlimmer.«
»Geht es ihr schon lange schlecht? Hat die Gedankenauslese was angekündigt?« Seine Stimmlage verriet, dass ihm vollkommen bewusst war, wie ernst dieses Thema war und ich hörte den Mediziner aus ihm sprechen.
»Sie hat nicht versucht, sich umzubringen!«, warf ich sofort ein, da ich mir vorstellen konnte, dass Luna ihm das vielleicht auch erzählt hatte. »Sie hatte nur einen schlimmen Anfall«, verteidigte ich meine Mutter.
Oliver zog fragend die Augenbrauen zusammen und faltete die Hände auf dem Schoß. »Was für einen Anfall?«
»Wenn die Ärzte das wüssten, wäre es sicher nicht so weit gekommen«, antwortete ich ihm und klang selbst in meinen Ohren viel zu müde. Mein Koffeinspiegel war auch sicher unter null und ich griff mit der nicht kaputten Hand nach dem Kaffeebecher, den Oliver mitgebracht hatte. Ich ging schwer davon aus, dass er für mich bestimmt war.
Vorsichtig nippte ich an dem heißen Getränk und genoss das warme Gefühl, das es in meinen Magen brachte. Das war genau, was ich gebraucht hatte.
»Danke für den Kaffee.«
»Den schulde ich dir doch schon ewig.« Sein leichtes Grinsen ließ mich schmunzeln.
Luna hatte ein falsches Bild von ihm. Oliver war nicht nur ein Typ, mit dem man ab und zu flirtete. Er war auch ein Freund. Sonst wäre er jetzt nicht hier.
»Ich dachte, vielleicht brauchst du ein bisschen Ablenkung. Oder Einsichten in die Akten. Oder noch mehr Kaffee«, sagte er plötzlich, als müsste er seine Anwesenheit rechtfertigen, und ich zog meine Hand hervor, um ihm freundschaftlich gegen die Schulter zu boxen. Im letzten Moment fiel mir jedoch ein, dass das wohl keine gute Idee wäre und höllisch wehtun würde.
Oliver drehte den Kopf zu mir, wohl irritiert von meiner nicht ausgeführten Bewegung, und seine Augen wurden groß, als er auf meine Hand blickte.
»Sag mal, ist dein Handgelenk blau?«, wollte er wissen und ich versuchte, die Hand sofort wieder zu verstecken.
»Ähm, ja, kann sein«, redete ich drum herum, weil es mir peinlich war. Bevor ich sie wieder in der Tasche des Pullovers verschwinden lassen konnte, griff Oliver schon nach meinem Ellenbogen und zog ihn zu sich heran.
»War das vorhin auch so?« Ohne die Hand zu berühren, begutachtete er sie mit besorgter Miene und ich entzog ihm umständlich meinen Arm. Das war jetzt wirklich das Letzte, um das ich mich kümmern wollte.
»Nein. Ich bin unten im Foyer gestolpert«, gab ich etwas patzig zurück und Röte stieg mir in die Wangen. Ich musste schrecklich ausgesehen haben, wie ich völlig fertig das Krankenhaus gestürmt und mich erst mal auf die Schnauze gelegt hatte.
Oliver schnaubte laut. »Hat sich das schon jemand angesehen?«
»Oliver, das ist nichts«, versuchte ich ihn davon abzubringen, sich um meine Hand zu kümmern, und machte eine wegwerfende Handbewegung. Die ich besser nicht gemacht hätte. Vor Schmerz musste ich die Lippen aufeinanderkneifen, um keinen Laut von mir zu geben.
Genervt zog Oliver die Augenbrauen nach oben. »Echt jetzt? Lass uns mal vorsichtshalber zum Röntgen gehen.«
»Oliver«, knurrte ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor und er atmete tief durch. Sollte er doch einfach wieder gehen, wenn ich ihm auf den Keks ging.
»Hey«, sagte er leise und seine Stimme klang weich und versöhnlich. »Es ist geschwollen und blau. Ich lass dich doch nicht mit einer gebrochenen Hand durch die Gegend laufen.« Langsam erhob er sich von seinem Stuhl und überragte mich mit seiner Körpergröße. »Die Radiologie ist auf der anderen Seite des Flügels. Das sind nur ein paar Meter.« Seine Körperhaltung war auffordernd.
Ich schenkte ihm einen bösen Blick, doch er ließ nicht locker. »Komm schon. Ich habe dir auch Kaffee mitgebracht.«
Es dauerte noch ein paar Sekunden, die wir uns anstarrten, dann senkte ich den Blick auf meine Hand. Sie war tatsächlich ziemlich blau. »Na gut«, gab ich mich kleinlaut geschlagen und stand ebenfalls auf.
»Ich komm gleich wieder«, sagte ich zu meiner Mutter, obwohl ich nicht wusste, ob sie mich überhaupt hören konnte, und strich ihr behutsam eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Es gab nicht einmal einen richtigen Grund, warum ich neben ihr saß, denn sie würde in der nächsten Zeit nicht wieder erwachen. Der Arzt hatte etwas von einem Dämmerzustand erzählt, in dem sie sie halten wollten.
Wahrscheinlich saß ich hier nur für mich.
Ich betrachtete kurz ihre geschlossenen Augenlider und die stark sichtbaren Adern auf der dünnen Haut. Ich konnte nur hoffen, dass die Ärzte herausfanden, was ihr fehlte.
Oliver ging voran in Richtung Radiologie. Weiße Wände, ein Gang sah aus wie der andere, hässliche Kunst überall. Krankenhäuser sahen seit eh und je gleich aus.
Warum hatte ich den Kaffee eigentlich nicht mitgenommen?
Es war ein komisches Gefühl, Oliver zu folgen, er in der Position des Arztes und ich als Patientin.
Vor ein paar Tagen hatte ich ihn erst bei der Gedankenauslese gesehen, ebenfalls als Arzt. Sogar mit weißem Kittel. Doch wir hatten unsere Witzchen gemacht wie immer, und jetzt gingen wir nur stumm nebeneinanderher.
Es war nicht die Zeit für Geflirte und kleine Gemeinheiten, sondern für sorgenvolle Mienen und ehrliche Worte. Und obwohl es sich fremd anfühlte, war es vielleicht auch mal gut, eine andere Facette unserer Freundschaft zu entdecken, die bisher sehr klar begrenzt gewesen war.
Oliver bog ab, grüßte eine Schwester mit Vornamen, die daraufhin dezent errötete.
»Guten Tag, Doktor Grand«, säuselte sie und mir wurde klar, dass Oliver nicht das erste Mal in diesem Krankenhaus war.
»Arbeitest du hier?«, fragte ich ihn, damit es nicht weiter so still zwischen uns blieb.
»Ich habe hier so viele von meinen Praktika abgeleistet, ich weiß nicht mal mehr, wie viele«, erklärte er mir und wir betraten einen Raum ohne Fenster, der von Tageslichtröhren erhellt wurde.
Ein Mann in weißer Arbeitskleidung sah von seinem Computerbildschirm auf, erhob sich mit einem breiten Grinsen, als er Oliver entdeckte, und begrüßte ihn mit Handschlag.
»Oliver Grand! Was führt dich zu mir, Kumpel? Und wer ist deine reizende Begleitung?«, fragte er und streckte mir die Hand hin. »Benjamin mein Name.« Sein Gesicht war unerwartet jung. Bei der Halbglatze, die er glänzend zur Schau trug, hätte ich ihn älter geschätzt.
Höflich wollte ich seine Hand ergreifen, da ließ er sie unerwartet sinken. »Ah, ich verstehe. Gebrochen?«, fragte er mich mit einem Blick auf mein geschwollenes Handgelenk und ich zuckte nur mit den Schultern. »Ich werfe mal die Laserkanone an.« Und schon war er im Nebenraum verschwunden.
»Laserkanone?«, fragte ich skeptisch und Oliver lachte nur, erklärte es mir aber nicht.
Dafür trat er an einen Schrank und holte eine dunkelgraue Schürze hervor, die er mir umhängte. Sie war unglaublich schwer und würde meine Organe vor der Strahlung des Röntgengerätes schützen.
»Honey, wenn du schwanger bist, musst du mir das jetzt gestehen«, sagte Oliver und klang dabei eine Spur zu belustigt. Doch mir war klar, dass er mich das fragen musste und es nur so formulierte, um die Situation ein wenig aufzulockern. Doch mir war noch nicht nach Flirten zumute. Dafür war ich noch zu angespannt.
»Ich bin nicht schwanger.« Wie auch. Für so was müsste man ja Sex gehabt haben.
Der Nebenraum war klein und enthielt lediglich eine Liege und ein riesenhaftes metallverkleidetes Gerät, das Benjamin bereits in Position brachte.
Ich fühlte mich fehl am Platz und unwohl in meiner Haut. Vorhin war ich ins Krankenhaus gehetzt, mit Sorge im Bauch und Panik im Nacken, die Gedanken nur bei meiner Mutter. Und jetzt stand ich hier mit Oliver Grand und einem verrückten Krankenpfleger, die um mich herumwuselten, mich auf einen Hocker setzten und meine Hand auf der Liege positionierten.
Es war mir nicht recht, dass sich diese Situation um mich drehte, weil es mein schlechtes Gewissen schürte. Es war so leicht, dabei die Sorgen zu unterdrücken und an anderes zu denken als an meine Mutter. Dabei hatte sie meine Sorge verdient, viel mehr als das.
Doch stattdessen ließ ich mir die Hand röntgen.
»Einen Moment still halten«, wies Oliver mich an und die beiden Typen verschwanden aus dem Raum.
Ich wartete, rührte mich nicht und starrte auf meine Hand, auf deren Haut ein richtiges Universum an Farben entstanden war. Vielleicht war es doch nicht so falsch gewesen, sich darum zu kümmern. Bisher war es mir so unwahrscheinlich vorgekommen, dass ich mir tatsächlich was gebrochen hatte, doch so langsam zog ich es selbst in Betracht.
Aber was wusste ich schon, ich hatte mir ja noch nie etwas gebrochen.
Nach etwa einer halben Minute, in der scheinbar nichts passiert war, kam Benjamin wieder.
»Achtung, Schmerz«, sagte er und bevor ich überhaupt verstand, was er meinte, verdrehte er mir halb die Hand.
Sternchen tanzten vor meinen Augen, als mein Handgelenk sich anfühlte, als würde es explodieren.
»Und jetzt so halten«, hörte ich Benjamin sagen und schon war er wieder verschwunden.
Wieder war eine halbe Minute Ruhe, in der ich versuchte, gleichmäßig zu atmen und nicht daran zu denken, dass meine Hand gerade mehr wehtat, als ich mir vorstellen konnte. Jemand öffnete die Tür, aber niemand kam herein.
»Sind wir fertig?«, fragte ich unsicher und bekam keine Antwort. Waren die da drüben etwa abgehauen?
Unsicher löste ich meine Hand aus der furchtbaren Position und versuchte sie so wenig wie möglich zu bewegen, als ich vom Hocker aufstand, was schwierig war, da die schwere Schürze mich beinahe nach vorn umkippen ließ.
Ich fand Oliver und Benjamin vor einem riesigen, in die Wand eingelassenen Bildschirm.
»Das ist ja krass«, raunte der Krankenhelfer und ich trat zwischen die beiden, um zu sehen, was sie so faszinierte.
Am Bildschirm war das Röntgenbild meiner Hand und einem guten Stück Arm zu sehen, was ich nicht gerade ansprechend fand. Skelette waren nicht so meins.
»Was hast du nur mit deiner Hand angestellt?«, fragte Benjamin mich schockiert und nahm mir glücklicherweise die schwere Schürze ab.
Ich bekam ein ungutes Drücken im Bauch. »Ich bin bloß hingefallen.«
Oliver legte mir sachte die Hand auf den Rücken und ging mit mir einen Schritt näher an den Bildschirm. »Schau, durchgebrochen ist diesmal nichts. Lediglich ein kleiner Haarriss«, erklärte er und zeigte auf die betreffende Stelle am Handgelenk. »Da bekommst du von uns gleich eine Tiefenwundsalbe und eine Schiene und in zwei bis drei Wochen ist das wieder wie vorher.«
Mein ungutes Gefühl wurde stärker. »Was meinst du mit ›diesmal ist nichts durchgebrochen‹? Wann soll das denn passieren?«, fragte ich und unsere Blicke trafen sich. Anscheinend waren meine Worte für ihn genauso unverständlich wie seine für mich.
»Alter Schwede. Ist dir da mal ein Kühlschrank draufgefallen?«, unterbrach Benjamin die seltsame Situation und ich verstand immer noch nicht.
»Auf die Hand? Wieso sollte es?«
»Na ja, solche Brüche holt man sich nicht beim Ballspielen«, führte er an und ich begann, an seiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln. »Vernarbung am Unterarm. Elle und Speiche durchgebrochen. Handwurzelknochen scheint zertrümmert worden zu sein und die Finger sehen auch so übel aus. Der Chirurg, der das wieder hingekriegt hat, war Weltklasse. Man sieht oberflächlich echt gar nichts.«
Ich trat einen Schritt zurück, spürte Übelkeit in mir aufsteigen, die sich mir nicht erklären ließ. In meinem Hinterkopf dröhnte der Schrei einer Frau. »Redet er von meiner Hand?«, wandte ich mich an Oliver, dem wohl nicht aufgefallen war, dass mir die Situation gerade wenig gefiel. Mein Herz schlug immer schneller und der Schweiß brach mir aus.
»Du hast da eine Menge verheilter Brüche an der Hand, ja«, bestätigte er und sah auf mich herab. »Gemma?« Seine Stimme klang alarmiert.
»Sicher?«, wollte ich mich vergewissern. Mein Brustkorb fühlte sich an, als würde er mir die Lunge zusammendrücken, und Schwindel erfasste mich. Die Erinnerung an einen Schmerz zog einmal durch meinen Oberkörper.
Meine Hand war gebrochen gewesen. Mehrfach. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass das je passiert war.
»Können wir den Rest auch röntgen?«, stieß ich hervor, als Oliver nach meinem Arm griff, mich vorsichtig rückwärtsschob und dazu brachte, mich auf einen Stuhl zu setzen.
»Tut noch mehr weh?« Er betrachtete mich ganz genau, ließ sich eine kleine Lampe von Benjamin reichen und leuchtete mir damit ohne Vorwarnung erst ins eine, dann ins andere Auge.
»Holst du uns ein Glas Wasser?«, bat er den Pfleger und dieser verschwand ohne weiteren Kommentar aus dem Zimmer.
Die Stimme in meinem Hinterkopf wurde deutlicher, schrie meinen Namen und verhallte. Ich hatte heute Nacht von ihr geträumt. Es war das Mädchen aus dem Café, das danach mit mir auf der Straße gestanden hatte, als das Monster kam, um uns zu fressen.
Ach du Scheiße!
»Kannst du den Rest von meinem Körper auch röntgen?«, wiederholte ich meine Bitte und Oliver schüttelte den Kopf.
»Ich setze dich nicht ohne Grund Strahlungen aus. Außerdem geht das hier nicht. Dafür müssten wir drüben ein CT machen. Das ist komplizierter. Wir können da nicht so reinspazieren wie hier«, versuchte er es mir auszureden, doch ich ließ ihn nicht.
»Oliver!«, rief ich ärgerlich seinen Namen und klang dabei ein bisschen zu verzweifelt. »Meine Welt steht gerade kopf. Alles dreht sich, nichts ergibt Sinn. Wenn du mir diese eine Gewissheit schenken kannst, dann tu es bitte!«
Ich musste wohl energisch genug geklungen haben, denn er schnaubte und seine Haltung wurde weniger abweisend.
»Ich als dein Arzt rate dir davon ab«, sagte er mit klaren Worten, sodass ich mir plötzlich unglaublich gut vorstellen konnte, wie er als fertiger Arzt einmal sein würde. Und er würde das gut machen.
»Ist mir egal. Wenn du es nicht machst, werde ich Benjamin bestechen«, patzte ich ihn dennoch an und setzte meine entschlossenste Miene auf.
Oliver lachte unterdrückt. »Das könnte sogar funktionieren.« Er rieb sich über die Stirn. »Komm mit«, wies er mich an und öffnete die Tür auf den Flur.
Mein Schwindel legte sich langsam wieder und ich folgte ihm mit langsamen Schritten aus dem Zimmer.
»Wir müssen auf Benjamin warten. Ich habe keine Radiologie-Fortbildung«, informierte Oliver mich, da kam der Erwartete auch schon auf uns zu.
»Geht’s dir wieder besser?«, wollte er wissen und ich nickte leicht, nahm das Wasser jedoch trotzdem gern.
»Wir brauchen ein CT.« Oliver sagte es, als wäre es eine Selbstverständlichkeit und als hätte er keinerlei Zweifel daran.
Benjamin hob skeptisch die Augenbrauen und ich fürchtete, er würde Nein sagen.
»Bitte«, seufzte ich. »Wenn das eine Geldfrage ist, dann zahle ich das.« Ich wusste zwar nicht wovon, denn bisher sah es auf meinem Konto recht mau aus, aber ich würde das schon irgendwie hinbekommen.
»Ne du, lass mal stecken. Das zahlt deine Versicherung.« Dann wandte sich der Pfleger, von dem ich mir nicht mehr so sicher war, ob er tatsächlich bloß ein Pfleger war, an Oliver.
»Sicher?«, fragte er ihn und Oliver zögerte nicht mit seiner Antwort.
»Ja, sicher.«
Erleichtert atmete ich auf und spürte gleichzeitig die unerträgliche Spannung in mir, als wir gegenüber durch eine Tür traten und uns in einem riesigen Raum wiederfanden, der durch eine Glasfront mit einem zweiten verbunden war. Dort stand ein gigantischer weißer Donut.
»Dann machen Sie sich mal frei, Frau Henson.« Oliver sah mich auffordernd an und zeigte auf einen schmalen Vorhang an der Seite, hinter dem sich eine winzige Umkleidekabine befand.
Na wunderbar.
»Bis auf die Unterwäsche entkleiden und alle Metallteile ablegen«, ergänzte Benjamin, der das Gerät einzustellen begann.
»Dazu gehören auch BH-Bügel«, ergänzte Oliver und ich streckte ihm trotz all meiner Anspannungen die Zunge raus.
»Meine BH-Bügel sind aus recyceltem Plastik«, nahm ich ihm die Illusion einer beinahe nackten Gemma und zog den Vorhang zu. Da musste ich jetzt durch, denn zwischen all den unerklärlichen Ereignissen eine Gewissheit zu erlangen war mir wichtiger, als mich vor Oliver Grand nicht zu entblößen.
Gut, dass ich den schwarzen BH trug. Jetzt hatte ich ihn wohl doch nur für ihn an. Welche Ironie.
Zum Glück war es in dem Raum mit dem Donut warm und doch stellten sich mir alle Härchen auf, als Oliver mir auf die Liege half und mein Blick sich auf das riesenhafte Gerät richtete, das sich über mir befand.
Ich schloss schnell die Augen, um nichts mehr zu sehen.
»Jetzt geht’s los«, kündigte Oliver mir an und ließ mich allein zurück.
Ich versuchte an nichts zu denken, die Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen. Eigentlich hätte ich verheilte Knochenbrüche in meiner Hand für unmöglich halten sollen, aber ich tat es nicht. Als hätte ich sie vergessen und jetzt gerade wäre mir wieder eingefallen, dass sie tatsächlich passiert sein könnten.
Oder meine Verrücktheit hatte gerade ein neues Level erreicht.
Es war schneller vorbei als gedacht und während ich umständlich in meine Hose schlüpfte, stellte ich mich schon zu den beiden Männern vor den noch viel größeren Bildschirm.
Oliver betrachtete das Skelett prüfend. Nachdenkliche Falten bildeten sich auf der Stirn. »Oberarmknochen war ebenfalls gebrochen«, begann er, obwohl ich nicht gefragt hatte. »Schulter, rechtes Schlüsselbein, linkes auch. Schädelfrakturen, quasi alle Rippen, das Becken und der rechte Oberschenkelknochen.« Er zeigte auf die jeweiligen Stellen, an denen die Verschiebungen minimal zu sehen waren.
Ich schluckte schwer, hatte den Geruch von Regen in der Nase, der auf heißem Asphalt verdampfte, und sah die großen leuchtenden Augen des Monsters vor mir, das schnaubend und kreischend auf mich zuhielt.
»Das sieht aus, als ob du von einem Lastwagen überfahren worden wärst«, schnaubte Benjamin und wollte damit wohl einen Witz machen, doch seine Worte trafen mich wie ein Blitz, der mich schmerzhaft durchzuckte.
Denn die Augen des Monsters waren Scheinwerfer.