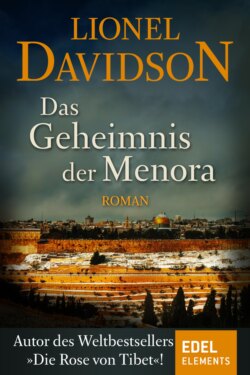Читать книгу Das Geheimnis der Menora - Lionel Davidson - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDie israelische Botschaft befindet sich in Palace Green, am einen Ende der Kensington Palace Gardens, dieser stillen, verträumten Promenade, die, fast vollständig abgeschnitten, zwischen Kensington und Bayswater liegt. Es war nach sechs und schon dunkel, als wir dort ankamen, was nicht unbeabsichtigt zu sein schien, und wir kamen von der Kensington-Seite her, auch dies war kein Zufall.
»Die Nachbarn auf der anderen Seite sind neugierig«, sagte Uri und bog in die Zufahrt ein.
Die Nachbarn auf der anderen Seite waren die Botschaften von Jordanien, dem Libanon und Saudi-Arabien. Bei ihnen rührte sich um diese Zeit jedoch keine Menschenseele. In dieser Straße schien sich überhaupt nichts zu rühren. Uri hatte seine schrullige Heimlichtuerei während der ganzen Fahrt strikt beibehalten, was in mir bereits die schlimmsten Vorahnungen geweckt hatte. Die ließen auch jetzt nicht nach, als er mit herrischer Geste das Tor der Botschaft öffnete und mich hineinscheuchte.
Die israelische Botschaft ist eine schöne Botschaft, sehr behaglich. Es herrscht dort eine demokratische, lockere Atmosphäre, mit einem Beigeschmack von Teestunde. Ein Mädchen durchquerte gerade mit einem Glas Tee die Halle, als wir eintraten, und Uri tauschte Schaloms und Bewakaschars mit ihr aus, während wir die Treppe hinaufgingen. Durch einen großen Raum gelangten wir in einen kleineren. Vier oder fünf Männer saßen dort und unterhielten sich. Einer von ihnen, stellte ich fest, war Agrot. Ich war ihm nie wirklich begegnet, aber von Buchumschlägen und Zeitungen her war mir sein Gesicht vertraut. Er löffelte Joghurt aus einem Glas, das er noch in der Hand hielt, als er sich erhob; ein großer Typ, mit Schnurrbart und leicht schiefer Nase, ähnlich wie Hunt, der Logistiker vom Everest.
Er sagte mit kräftigem Händedruck: »Schalom.«
»Schalom.«
»Schon lange wollte ich Sie einmal kennenlernen.«
»Ich wußte gar nicht, daß Sie hier sind.«
»Bin gerade angekommen. Entschuldigen Sie das hier«, sagte er. »Im Flugzeug konnte ich nichts essen. Ihre Arbeit über die Kreter hat mir gefallen.«
»Mir gefiel Ihr Bar Kochba.«
»Sie schmeicheln mir.«
Wir setzten uns, tauschten noch ein paar weitere Komplimente aus. Er löffelte weiter sein Joghurt. Irgendwann während des Gesprächs brachte mir jemand einen Drink. Ich verspürte dieses vage Unbehagen, das einen befällt, wenn man einen soeben angereisten Ausländer die eigene Muttersprache fließend sprechen hört und er dabei lebhaftes Interesse an verschiedenen Angelegenheiten zeigt, die eigentlich nur von lokaler Bedeutung sind. Die übrigen Gesichter verschwanden nach einer Weile, und nur Agrot, Uri und ich blieben übrig. Jetzt schien man zum Geschäftlichen zu kommen.
Im Plauderton fragte ich: »Und was führt Sie nun hierher, Professor Agrot?«
Er sagte: »Nun«, lutschte sich einen Joghurtklecks vom Daumen, griff in die Brusttasche und zog etwas hervor.
Es war ein kleiner Zettel, etwa zehn mal fünfzehn Zentimeter, offenbar ein Textfragment, grobe, hebräische Buchstaben, sehr schlecht geschrieben.
»Was halten Sie davon?« fragte er.
Abgesehen davon, daß einige der Wörter überraschend lang waren, so als hätte der Schreiber vergessen, Lücken zu lassen, konnte ich nichts damit anfangen. Einige hebräische Buchstaben, M und T zum Beispiel, unterschieden sich kaum voneinander – ungefähr wie etwa O und D in unserer Schrift. Wie das englische Wort ODD in undeutlicher Schrift auch als DDD, OOO, DOO oder ODO gelesen werden könnte, konnte ein handgeschriebenes hebräisches Wort, in dem M und T vorkamen, auch eine Reihe von Permutationen ergeben. Außerdem gibt es im Hebräischen keine Vokale. Eine Buchstabengruppe von drei Lettern, wie MTR, konnte daher als MOTOR, TUMOR, MATER oder AROMAT oder als Eigenname gelesen werden. Genausogut konnte sie ein Wort sein, das vor Jahrhunderten gebräuchlich und seitdem nicht wieder aufgetaucht war.
Sehr häufig konnte man sich dank der Stämme der semitischen Sprachen einen Reim auf den ungefähren Inhalt des Wortes machen und, falls man genügend solcher Wörter gefunden hatte, sie auch in sinnvollen Zusammenhang bringen. Hier waren es nicht genug, und einen bekannten Wortstamm konnte ich auch nicht entdecken.
Ich sagte: »Derjenige, der das geschrieben hat, scheint einen schlechten Tag gehabt zu haben.«
»Er war zu der Zeit ziemlich krank.«
»Hebräisch oder Aramäisch ist es jedenfalls nicht.«
»Wie gut ist Ihr Griechisch?«
Ich studierte den Zettel erneut.
»Besser als seines. Das ist kein Griechisch.«
»Versuchen Sie es rückwärts.«
Ich versuchte es rückwärts. Die Konsonantenbündel begannen plötzlich, vage vertraute Ahnungen in mir zu wecken.
»Hier«, sagte Agrot. »Eine grobe Übersetzung ins Englische von dem Abschnitt, den Sie in der Hand halten.«
Die Rohübersetzung lautete: An dieser Stelle [in dieser Gegend] von der Hand des Niedrigsten und ihm, der allein bezeugt [die gemeinen Soldaten und ich allein], damit sie es nicht im Munde führen [ohne Zeugen], ist das OEED in der Dunkelheit [vergraben].
»Interessant?« fragte Agrot.
»Sehr.«
»Was fallt Ihnen besonders ins Auge?«
»An diesem Invaliden, der in griechischer Sprache rückwärts dachte?«
»Er dachte natürlich nicht rückwärts. Er erstellte einen vorbereiteten Bericht für eine Autorität, die ihn verstehen würde.«
»Verstehe.« Seine selbstbewußte Behauptung machte deutlich, daß er von dem Zeug eine Menge mehr haben mußte.
»Sonst noch etwas?« fragte er.
»Dieses OEED meinen Sie?«
»Was glauben Sie, was es bedeutet?«
Ich sah es wieder an. Codenamen standen meist für etwas, das Priestern gehörte. In der Gegenüberstellung zu ›Dunkelheit‹ konnte es ›Licht‹ bedeuten.
»Licht?« fragte ich.
»Wir denken das gleiche.«
»In diesem Falle«, fuhr ich fort, »könnte man sich einen heiligen Gegenstand denken, ein Buch des Gesetzes oder der Propheten – irgend etwas, das im religiösen Sinn Licht auf etwas wirft.«
»Für den Transport dieses Gegenstands waren vier Männer nötig.«
»Ach.«
»Zusammen mit der dazugehörigen Ausrüstung.«
»Hm.«
»Fällt Ihnen dazu etwas ein?«
»Nicht vor dem zweiten Drink. Soviel Leistung gibt es nicht ohne Treibstoff.«
Uri stand auf und schenkte mir nach.
»Warum ist es Licht im übertragenen Sinne?«
»Wie meinen Sie das?«
»Was wirft im physikalischen Sinn Licht?«
»Ein Leuchter?«
»Bravo.«
Ich sah ihn an. »Sie denken doch hoffentlich nicht an ›den Leuchter‹?«
»Nun, das würde der Sache Pfiff geben, nicht wahr?«
»Pfiff geben.« Es schien sein voller Ernst zu sein. Ich fragte: »Haben Sie ein Datum für diese Geschichte?«
»Ein ganz exaktes Datum. März 67.«
»Dann war der Leuchter ja nicht lange vergraben.«
»Ach«, sagte Agrot. »Erklären Sie mir das.«
Er lehnte sich zurück und lächelte mild, die Nase deutete leicht nach Osten.
Ich brauchte ihm nichts zu erklären. Er wußte es, wohl besser als ich. ›Der Leuchter‹, der große, siebenarmige Leuchter, die Menora, war seit fast zweitausend Jahren das Sinnbild des Judentums; für Israel, sein Heimatland, war sie das seit etwa fünfzehn Jahren. Der römische Eroberer Titus stahl den Leuchter im August 70, als er den Tempel zerstörte. Eine Darstellung davon ist immer noch auf dem Triumphbogen in Rom zu sehen; in einem Triumphzug trägt eine Gruppe Römer das massiv goldene Objekt durch die Straßen Roms. Die Prozession hat der Historiker Flavius Josephus beobachtet und bis in kleinste Details festgehalten. Wenn Agrots Datum für ›den Leuchter‹ im Jahre 67 lag und Titus ihn 70 stahl, konnte er, wie ich gesagt hatte, nicht lange im Dunkeln geblieben sein.
»Weil Titus ihn gestohlen hat.«
»Wir fragen uns, ob er das wirklich getan hat.«
»Er hat ›den Leuchter‹ mitgenommen.«
»Er hat mit Sicherheit einen Leuchter mitgenommen«, sagte Agrot.
Ich sagte: »Ach. Hm«, und zündete mir eine Zigarette an. Außer vielleicht dem echten Kreuz und dem echten Leichentuch Jesu war die echte Menora der Gegenstand in der Geschichte, um den sich die meisten Märchen und Legenden rankten. Gestalt und Größe entsprachen selbstverständlich den Anweisungen Gottes an Moses – im ältesten Legendenwerk der Geschichte, dem Pentateuch –, bis sie schließlich im Tempel Salomons aufgestellt wurde. Dank dieser Entstehungsgeschichte hatten ihr die Gläubigen schon immer magische Kräfte zugesprochen, unter anderem auch die der Unzerstörbarkeit. Mir war nie zu Ohren gekommen, daß Agrot besonders gläubig sei, und er schien mir auch für Märchen nicht sonderlich empfänglich. Ich sah ihn an. Noch immer lächelte er mild.
»Was beschäftigt Sie?« fragte er.
»Das, wovon Sie glauben, daß es mich beschäftigt.«
»Also gut, betrachten Sie es einmal so. Wenn vorstellbar ist, daß jemand eine Kopie angefertigt hat – und das ist eine ziemlich alte Vorstellung, älter als Titus –, dann könnte man erwarten, daß man es zu jener Zeit versucht hat. Die Zeiten damals waren gefährlich.«
»Stimmt.«
»Und deshalb hat jemand das Original vergraben.«
»Und jemand hat es aus diesem Grunde geklaut, kaum, daß er es gefunden hatte.«
»Ah«, sagte Agrot. »Das beschäftigt Sie also. Verstehe. Aber wir glauben, daß sie dort, wo sie war, noch niemand gefunden hat. Wir halten es für durchaus denkbar, daß sie noch immer dort ist, wo man sie hingebracht hat.«
»Wieso?«
»Nun, es gibt Gründe dafür«, wich Agrot aus. »Aber um die zu erfahren, müssen Sie mit nach Israel kommen.« Plötzlich fiel mir ein, daß ich, wenn man mich nicht hierhergebracht hätte, um mir diese Anhäufung von Fabelzeug anzuhören, vielleicht schon mit Lady Longrigg im Bett läge. Ob diese Chance je wiederkehren würde?
»Sie sehen besorgt aus«, sagte Agrot.
»Er hat ein paar Probleme«, erklärte Uri.
Ich sagte: »Ja. Hören Sie, Professor Agrot, obwohl ich natürlich gerne ...«
»Man hat mir gesagt, Sie seien jetzt selbst Professor.«
»So ist es. Und ich muß diese Abteilung aufbauen. Es ist eine neue Universität, und daher muß ich ...«
»Dr. Silberstein besorgt die Bücher«, fiel Uri dazwischen.
»Wie?«
»Dr. Silberstein. Der König aller Bücherbeschaffer. Dr. Silberstein besorgt die Bücher.« Er sagte das sehr zuversichtlich.
Ich nahm einen Zug von meiner Zigarette und sah ihn an. Dr. Silberstein war wirklich der König aller Bücherbeschaffer. Wenn ein Buch überhaupt besorgt werden konnte, so erledigte das Dr. Silberstein. Ich hatte ihn schon in Anspruch genommen. Ich hätte ihn auch diesmal wieder in Anspruch genommen, aber Dr. Silbersteins Bücher waren immer etwas teurer. Bei ihnen fehlte allerdings auch nie die Seite 64, und alle relevanten Errata-Blätter waren eingeklebt, selbst wenn Dr. Silberstein sechs Ausgaben aus sechs verschiedenen Ländern besorgen mußte, um für Vollständigkeit zu sorgen.
Ich fragte: »Und wie kommt Dr. Silberstein an die Bücher?«
»Wie kommt Dr. Silberstein überhaupt an Bücher?« fragte Uri mit großen Augen.
»Wieso besorgt er meine Bücher? Was hat er mit der Sache überhaupt zu tun?«
»Ich habe ihn hinzugezogen«, sagte Uri. »Ich habe ihm alles berichtet, was du mir erzählt hattest. Was die Bücher angeht, so brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen.«
Mir fiel auf, daß dieser Schuft nicht nur ungeheuer raffiniert und hartnäckig war, sondern auch ungeheuer aufdringlich.
»Wer hat dich darum gebeten?« fragte ich.
Uri senkte respektvoll den Kopf.
»Ich«, sagte Agrot. »Natürlich im Einvernehmen mit der Altertumsabteilung des Ministeriums für Erziehung und Kultur.«
»Ich verstehe.«
»Nein, mein Bester, tust du nicht«, widersprach Uri. »Leider mußte alles sehr schnell gehen. Aber die Umstände waren auch ungewöhnlich günstig – die Gläubigen mögen gar von Vorsehung sprechen. Dahinter steht folgender Gedanke: Während Dr. Silberstein für dich arbeitet, arbeitest du für uns, und wir zahlen das Honorar für euch beide. Wir brauchen dich, verstehst du?«
»Dringend«, fügte Agrot hinzu.
Das mußte ich erst verdauen.
Ich fragte: »Und was ist mit Ihren eigenen Forschern?«
»Nichts«, erwiderte Agrot. »Aber ich habe Ihre Arbeit über Jericho und Megiddo wieder gelesen. Sie zeugt von einer ungewöhnlichen Begabung. Sie verfügen über einen guten Instinkt, der funktioniert. Genau das, was wir brauchen.«
»Und woher wissen Sie, daß er in diesem Fall funktioniert?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Agrot, »Sie etwa?«
Er lächelte immer noch sein mildes Lächeln. Ein Menschenkenner.
Ich fragte: »Warum ist es so dringend?«
»Unsere Abschrift ist leider nicht die einzige. Und sie ist auch sicherlich nicht die beste. Wir haben allen Grund zur Annahme, daß unsere Nachbarn eine bessere besitzen. Die haben Sie noch nicht angesprochen, nehme ich an?«
»Nein.«
»Nein. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hier aufgefallen ist.« Er nahm eine Zeitschrift aus der Tasche. »Ich habe die Seite markiert.«
Es handelte sich um die Pariser Revue de Qumran aus dem Verlag Letousey und Ane, eine unserer Fachzeitschriften. Die markierte Seite war den Leserbriefen Vorbehalten. Ein Brief mit der Unterschrift ›Khalil Sidqui, Amman, Jordanien‹ war eingekringelt. Ich fing an, ihn zu lesen, und hatte den vagen Eindruck, ihn schon einmal gesehen zu haben. Aufgrund einiger Vorfälle in Qumran kam Sidqui zu der Annahme, daß irgendwo Dokumente gefunden worden waren, die Auskunft über Ortsnamen des ersten Jahrhunderts in Nordpalästina geben könnten. Forscher hätten die Pflicht, solch wertvolles Material zu veröffentlichen. Es sei der Wissenschaft nicht dienlich, Politikern die Möglichkeit zu geben ...
Es handelte sich um die üblichen Versuche von beiden Seiten, festzustellen, ob die anderen etwas gefunden hatten.
Ich sagte: »Ja, das habe ich gelesen.«
»Kennen Sie Sidqui?«
»Ja.« Ich hatte ihn in Jordanien kennengelernt. Ein verhärmter, älterer Mann, keine besondere Klasse.
»Es steht außer Frage, daß er hier von unserer Angelegenheit redet. Dafür gibt es noch andere Belege. Jemand hat ihn darauf angesetzt.«
»Eine unglückliche Wahl. Machen Sie sich seinetwegen Sorgen?«
»Nicht um Sidqui als Person«, erwiderte Agrot, »sondern um das, was es bedeutet. Die müssen irgendwann an eine eigene Kopie gelangt sein.«
»Wann hat er das geschrieben?«
»Auf jeden Fall vor Dezember, denn da ist er gestorben.«
»Wirklich? Davon habe ich gar nichts gehört.«
»Nein. Ich habe es auch erst letzte Woche erfahren.«
»Was war mit ihm?«
»Er war krank. Bilharziose. Und noch irgend etwas anderes. Ist ja auch egal«, sagte Agrot kurz angebunden, »jedenfalls wissen wir, daß sie eine Kopie haben und sich intensiv damit beschäftigen. Wie ich höre, geben Sie nächste Woche Ihre derzeitige Stelle auf. Wenn Silberstein für Sie arbeitet, wäre ich froh, wenn Sie dann aufbrechen könnten.«
Wärst du das? Das ging mir hier alles ein bißchen zu schnell. Da drehten sich zu viele Rädchen zu laut.
Ich sagte: »Also, ich müßte natürlich zuerst mit dem Rektor sprechen ...«
»Nein«, sagte Agrot.
»Was?«
»Nein.«
Eine gewisse Stille breitete sich im Raum aus.
Ich fragte: »Wie darf ich das verstehen?«
Agrot sah Uri an. Uri sagte in beschwichtigendem Tonfall: »Weil es nicht nötig ist. Ich habe bereits erwähnt, daß alles wie durch Vorsehung gesteuert läuft. Und so ist es auch. Nächste Woche brichst du zu deiner Bibliotheken-Tour auf. Dr. Silberstein oder einer seiner Assistenten wird das für dich erledigen. Und wo immer sie auftauchen, bist du eben gerade woanders. Wer braucht schon zu wissen, wo?«
»Warum sollte man es nicht wissen dürfen?« fragte ich.
»Weil«, sagte Agrot widerwillig, »wir nicht wollen, daß es sich zu unseren Nachbarn herumspricht, daß Sie mit im Spiel sind. Und das könnte leicht passieren. Es ist besser, die wissen es nicht – und ich verlasse mich natürlich darauf, daß Sie kein Wort davon erwähnen. Einige Hintergrundinformationen in dieser Angelegenheit sind sogar geheim. Fragen Sie mich jetzt nicht, warum. Das verrate ich Ihnen in Israel, und dazu noch ein paar andere interessante Sachen. Aber erwarten Sie nicht, daß ich Sie auf Knien bitte. Wenn Sie mitkommen möchten, kommen Sie mit. Wenn nicht, müssen wir es eben ohne Sie schaffen. Das mußten wir vorher auch.«
Das sagte er sehr nüchtern, sehr vernünftig, mit jenem leichten Verdruß in der Stimme, der so typisch ist für die Israelis.
Ich sagte: »Ich muß darüber nachdenken.«
»Wer hindert Sie daran?«
»Wann fliegen Sie zurück?«
»Morgen früh. Ich bin nur hergekommen, um Sie zu treffen.«
»Dann gebe ich Ihnen Bescheid.«
»Gut. Schalom.«
»Schalom.«
»Moment noch«, sagte Uri, bestürzt über den raschen Verlauf der Ereignisse. Ich war selbst auch ein wenig bestürzt. »Dr. Silberstein ist unten. Möchtest du ihn nicht sprechen?«
»Im Augenblick nicht.«
»Aber er ist extra gekommen. Er wartet auf dich. Er sitzt dort bei einer Tasse Tee.«
»Na, hoffentlich läßt er ihn sich schmecken«, sagte Agrot ruhig und drückte mir die Hand. »Auf israelischem Boden wird niemand zu etwas gezwungen. Schalom.«
»Schalom.«
Er gab auch Uri die Hand. Ich glaube, er nahm ihn noch kurz beiseite, während ich zur Tür ging.
Nach wenigen Minuten waren wir wieder auf der Landstraße. Auf dem Nordring nahm das Ganze wieder normale Dimensionen an, und alltäglichere Dinge gingen mir durch den Kopf. »Woher hattest du ihre Nummer?«
»Lady Lulu? Von Birkett. Ich habe ihn angerufen und darum gebeten.«
Natürlich.
»War sie wirklich verabredet?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe ihr gesagt, ich wollte dich um vier treffen.«
»War sie überrascht, als du sie angerufen hast?«
»Ja. Verblüfft«, nickte Uri.
Bestens. Das Bild klärte sich auf. Noch war nicht alles verloren.
Fröhlicher sagte ich: »Was hast du für Sorgen, du Griesgram? Du bist so mürrisch.«
»Nur nachdenklich.«
»Habe ich dich enttäuscht?«
»Ich kann dir nicht vorschreiben, was für Aufträge du annimmst.«
»Es sind Hirngespinste, Uri. Das Ding kann es gar nicht geben.«
»Schon gut.«
»Außerdem bin ich Wissenschaftler, mein Bester – ein internationales Geschäft. Von uns wird erwartet, daß wir Erkenntnisse veröffentlichen und nicht geheimhalten.«
»Tu mir einen Gefallen«, knurrte Uri, »und heb dir den Quatsch für deine Studenten auf. Ich kann nicht feststellen, daß sich die Araber mit dem Veröffentlichen besonders beeilen.«
»Vielleicht haben sie sich deshalb mit Sidqui zusammengetan.«
»Vielleicht.«
Stille. Eine lange Stille.
Ich fuhr fort: »Außerdem ist es ein ernstes Wagnis, eine solche Aufgabe zu übernehmen, ohne den Rektor zu informieren.«
»Du brauchst das Wagnis ja nicht einzugehen.«
»Das kann ich nicht so hopplahopp entscheiden. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich jetzt dazu überhaupt in der Lage bin.«
»Widerspreche ich dir etwa?« sagte Uri. »Die Entscheidung liegt bei dir. Wer sucht schon eine solche Herausforderung? Du hast dir eine Stellung und Ansehen erarbeitet. Niemand behauptet, du müßtest dich vor dir selbst weiterhin bewähren.«
Agrot hatte ihm sicher Anweisungen gegeben; jetzt bedrängte man mich auf andere Weise, subtiler. Sie sind freundlich, diese Israelis, emsig, zuvorkommend und gewissenhaft, alles. Und verdammt clever.
Auch ich fiel in Schweigen.