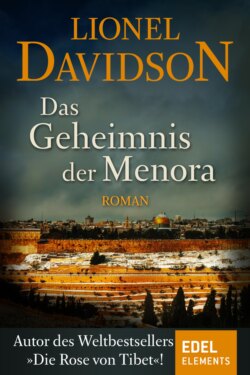Читать книгу Das Geheimnis der Menora - Lionel Davidson - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Оглавление»Es ist kein Gin mehr da. Nur noch das hier«, sagte Tanja Agrot und beäugte die Flasche mißtrauisch. »Was, zum Teufel, ist das?«
»Arrak«, sagte Agrot. »Ach, stell ihn weg. Wir haben schon genug getrunken. Niemand will Arrak.«
»Ich schon«, sagte ich. »Vielleicht legt sich dadurch meine Begriffsstutzigkeit.«
Wir befanden uns in seiner Wohnung im noblen Jerusalemer Rehavia-Viertel. Seine Frau war aus Barot gekommen, um uns zu treffen. Sie wären beide in Barot, wenn die Schriftrolle nicht plötzlich aufgetaucht wäre. Nach einer Stunde Aufmerksamkeit und zwei kräftigen Gin war meine Begriffsstutzigkeit noch immer so groß, daß ich keine Ahnung hatte, wieso die Sache überhaupt ins Rollen gekommen war. Ich trank den Arrak jetzt vorsichtig, um nur ja nicht den leisesten Hinweis zu verpassen.
Soweit ich folgen konnte, war die Schriftrolle im vergangenen November gefunden worden, das war ein ganzes Jahr her. Die Agrots hatten sie in En Gedi am Toten Meer ausgegraben, wo sie damals gerade arbeiteten. Dann war die Schriftrolle mit einem Mal brisant geworden. Wieso? Das hatte Agrot nicht verraten. Er hatte mich noch nicht in die Hintergründe eingeweiht.
Die Schriftrolle schien eine Hinterlegung von Geld und Wertsachen zu dokumentieren, die im März 67 aus dem Tempelschatz entnommen und nach Galiläa gebracht worden waren. Damals waren zahlreiche solcher Belege im Umlauf – genauso, wie in London und Paris in ähnlich gefährlichen Kriegszeiten.
Im Tempel waren damals enorme Reichtümer angehäuft, wie Agrot hervorhob, vergleichbar der heutigen Bank von England oder dem Fort Knox. Kaufleute und Bürger, die ihr Vermögen in Goldbarren in Privattresoren aufbewahrten, benutzten ihn als Bank. Aber der Tempel verfügte auch über seine eigenen Rücklagen – ungeheure Rücklagen. Damals lebte der größte Teil des jüdischen Volkes im Ausland. Sechs oder sieben Millionen lebten im Römischen Reich, und einige weitere Millionen in Parthien. Jeder einzelne Mann von ihnen mußte ab dem zwanzigsten Lebensjahr eine jährliche Abgabe an den Tempel entrichten.
Niemand hatte den Wert des Schatzes je schätzen können, aber er war mit Sicherheit gewaltig; jedenfalls so groß, daß nach dem Überfall der Römer, die den Schatz stahlen, auf dem syrischen Markt der Goldpreis um die Hälfte fiel. Zu diesem Zeitpunkt war ein großer Teil des Schatzes allerdings schon fortgebracht worden, und Agrots Dokument vermittelte einem eine Vorstellung davon, wie so etwas geschah.
Bei einem derartigen Vorgang schien man jedes Dokument dreifach ausgefertigt zu haben. Zwei wurden versteckt, das dritte (in dem der Aufbewahrungsort der beiden ersten vermerkt war) kam nach Jerusalem. Diese Ausfertigung wurde vernichtet, nachdem ihr wesentlicher Inhalt in irgendein Hauptregister übertragen worden war.
Der Grund, warum Agrot glaubte, die Menora befände sich noch immer an ihrem Platz, war folgender: Aus der Schriftrolle ging hervor, wo die beiden anderen Kopien hinterlegt waren, und diese dritte war offensichtlich nicht vernichtet worden. Sie war diejenige, die für Jerusalem bestimmt gewesen war, wo sie offensichtlich niemals angekommen war. Genauso offensichtlich war sie in der Zwischenzeit nicht gefunden worden. Das belegte ein kleines Häufchen Münzen, das daneben gefunden worden war: Keine von ihnen war später als 66 geprägt worden.
Ich fragte: »Und wo haben die Jordanier ihre Abschrift gefunden?«
»In Murabba'at, ein bißchen weiter nördlich am Toten Meer, südlich von Qumran.«
»Und wann?«
»Ein paar Wochen nachdem wir unsere fanden. Das haben wir in der vorigen Woche herausgefunden.«
»Und warum dann jetzt die Aufregung?«
Agrot griff nach dem Umschlag. »Du möchtest jetzt sicher zu Bett gehen, Tanja«, sagte er.
»Das siehst du falsch«, erwiderte Tanja. »Ich bleibe.«
Agrot sah sie über den Rand seiner Lesebrille an.
»Wir sind jetzt an einem vertraulichen Punkt angelangt«, erklärte er. »Ich möchte nicht, daß du da miteinbezogen wirst.«
»Warum müßt ihr es dann jetzt besprechen? Warum mußt du immer alles sofort tun?«
»Weil ich mir vorgenommen habe, jetzt darüber zu sprechen«, sagte er geduldig. »Und ich möchte irgendwann wieder nach Barot. Hast du Teitleman vergessen?«
»Für heute abend schon«, sagte Tanja, »Gott sei Dank.«
Teitleman, ein Immobilienkönig (dessen Machenschaften mir bekannt waren), ließ in der Gegend von Barot gerade Bauarbeiten durchführen. Die Agrots hatten es geschafft, ihm einen Baustopp von zweiundvierzig Tagen auferlegen zu lassen, eine Zeit, in der sie die biblische Fundstelle ausgraben konnten, ohne daß Teitlemans Bulldozer den Grund aufwühlten. Die zweiundvierzig Tage würden gerade so eben ausreichen, wenn es keine Unterbrechungen gab. Das war ein weiterer Grund, warum mich Agrot herbeordert hatte.
Er sah sie weiterhin geduldig an, und sie starrte wütend zurück. Sie war eine gutaussehende Frau, Mitte Dreißig, mit sympathischem amerikanischen Akzent. Sie war braungebrannt und sah gut aus in ihren Jeans und dem übergroßen Pullover. Die Wohnung war offensichtlich nach ihrem Geschmack eingerichtet. Schlicht, aber elegant, mit ein paar Kostbarkeiten: Amphoren, Kacheln, einem vergoldeten Granatapfelbaum und einem großen, angestrahlten Gemälde, einem Mané Katz an der weißen Wand. Ich blickte mich um, während der eheliche Zweikampf weiterging, und schließlich gab sie erschöpft auf.
»Macht aber nicht zu lange«, sagte sie. »Ich muß morgen früh los.«
»Ja, gut«, sagte Agrot und wartete, bis sich die Tür geschlossen hatte. Dann nahm er ein paar Papiere aus dem Umschlag und legte sie zurecht.
»Also, wissen Sie«, sagte er, »ich nehme an, das ist jetzt eine der dämlichsten Geschichten, die Sie je gehört haben.«
»Hat es mit Sidqui zu tun?« fragte ich.
»Es hat mit Sidqui zu tun. Er war hier, müssen Sie wissen. Hat sich über die Grenze geschlichen.«
In einem Ort namens Gesher, ein paar Meilen vom See Genezareth, war er über die Grenze gekommen, in einer Neumondnacht im letzten Dezember. Mit einem Begleiter hatte er den Jordan durchwatet, das Gelände des Kibbuz Gesher durchquert, die Hauptstraße nach Tiberias gekreuzt und war dann in das Hügelland zwischen der Straße und dem Berg Tabor gelangt.
Zufällig war der Kibbuz Gesher kurz zuvor ausgeraubt worden, und deshalb taten ein paar Nachtwachen Dienst. Sie entdeckten Sidqui und seinen Freund, ließen sie aber ohne Aufhebens weiterziehen. Eine der Wachen alarmierte den Grenzschutzposten im vier Meilen entfernten Ashdod Ya'acov.
Eine Stunde später waren sechs Polizisten und ein paar Fährtensucher den Eindringlingen auf den Fersen. Sie folgten ihnen drei Tage und drei Nächte lang. Die übliche Vorgehensweise der israelischen Grenzpolizei ist es, Eindringlinge nicht zu stellen oder zu überraschen, sondern ihnen zu folgen, um festzustellen, ob sie Kontakte mit Palästinensern herstellen wollen.
Sidqui und sein Freund schienen mit den Palästinensern nichts im Sinn zu haben. Die Polizisten konnten nicht herausfinden, was sie überhaupt im Sinn hatten. Zunächst glaubten sie an Sabotage bei der Staatlichen Wasserversorgung, die vom See Genezareth nach Süden führt, aber bald war eindeutig, daß sich die zwei Männer dafür nicht interessierten. Sie gruben Löcher in die Erde und zündeten, gut abgeschirmt, hin und wieder Sprengladungen. Da die Polizisten glaubten, es würden Waffen oder Signalgeräte versteckt, untersuchten sie die Löcher sorgfältig. Sie fanden nichts.
Die Männer schliefen tagsüber im Unterholz und wanderten nachts. In der dritten Nacht, als sie sich dem dichtbesiedelten Gebiet um Nazareth und Afula näherten, entschloß sich die Polizei, sie festzunehmen. Sidquis Begleiter zog eine Pistole, als man ihn anrief, ließ sie aber fallen, als ein Warnschuß abgefeuert wurde. Sidqui selbst kauerte im Unterholz und kam auch nach zwei weiteren Aufforderungen nicht heraus. Ein Unteroffizier und zwei Soldaten wurden losgeschickt, ihn zu holen.
Der Unteroffizier entdeckte Sidqui mit einem Gegenstand in der Hand, den er für ein Gewehr hielt, und feuerte einen Schuß über seinen Kopf hinweg ab. Unglücklicherweise erhob sich Sidqui im selben Augenblick, und der Schuß ging in seine Brust. Er starb auf der Stelle. Nun stellte sich auch der Grund für sein Hockenbleiben heraus: Er hatte mit heruntergelassenen Hosen dagesessen. Und was der Unteroffizier für ein Gewehr gehalten hatte, war ein ein Meter langes Stück Stahlrohr. Drei weitere Rohre lagen daneben.
Sidquis Begleiter wurde auf der Polizeiwache in Nazareth rasch identifiziert. Er hatte bereits ein paar Strafen wegen Landfriedensbruchs und Raubes abgesessen. Aber Sidqui stellte ein Problem dar. In seiner Kleidung, seinen Papieren und seinen Fingerabdrücken fand man keinen Hinweis auf seine Identität, und sein Begleiter verweigerte die Auskunft.
Er weigerte sich immer noch, etwas zu sagen, als er siebzehn Tage später in Haifa wegen Landfriedensbruchs und Sprengstoffbesitzes vor Gericht gestellt werden sollte.
In Haifa ist das Pflaster zwischen der Straße und dem Eingang des Gerichtsgebäudes dreißig Meter breit. Der Eindringling wurde in Handschellen über diese Strecke geleitet, als er plötzlich von einer Gewehrkugel tödlich in den Kopf getroffen wurde, die vom Flachdach eines Kinos an der Ecke abgefeuert worden war. Bis man die Stelle gefunden und das Gebäude abgeriegelt hatte, war der Schütze entkommen. Er wurde nie gefaßt.
Auf Amtswegen landete die Akte bei der Polizei in Nazareth und eine Kopie beim Hauptquartier der Grenzpolizei in Beit Shean. Und dort ruhte die Angelegenheit zunächst.
Sie ruhte zehn Monate – bis vor drei Wochen, als ein ehemaliger Student von Agrot, ein Spezialist für Arabisch, der zum Team gehört hatte, das die Schriftrolle von En Gedi erforscht hatte, seinen Dienst bei der Grenzpolizei antrat und dem Hauptquartier Nord in Beit Shean zugeteilt wurde. Dort sollte er, um sich mit der Arbeit vertraut zu machen, ein, zwei Wochen im Archiv verbringen. Es dauerte nicht lange, und er hatte die Akte der beiden Eindringlinge gefunden und auf dem Bild des Toten die Züge Khalil Sidquis erkannt, die ihm durch sein spezielles Forschungsgebiet vertraut waren. Knapp drei Tage später hatte er eine ziemlich genaue Vorstellung, was Sidqui im Schilde geführt hatte.
So lange dauerte es, bis er die Schritte der Eindringlinge zurückverfolgt, die Löcher im Boden gefunden und die stählernen Rohre als Teile einer Vorrichtung zum Sammeln geologischer Bodenproben erkannt hatte. Aber auf dem Rückweg nach Beit Shean war der junge Mann in eine Falle geraten: Ein Draht war über die Straße gespannt worden. Als man den Mann am Fuße einer steilen Böschung neben der Straße fand, saß er immer noch, mit gebrochenem Genick, auf seinem Motorrad. Seine Aufzeichnungen für Beit Shean waren jedoch äußerst detailliert, und sie gelangten zu Agrot; dieser hatte dann, nach weiteren eigenen Nachforschungen, die verwickelte Maschinerie in Bewegung gesetzt, der ich es verdankte, daß ich ihm jetzt, einen Arrak in der Hand, in seiner Wohnung in Rehavia gegenübersaß.
Es war israelischer Arrak, sehr viel feiner und ohne den kratzig-öligen Beigeschmack des arabischen, aber mit der gleichen Wirkung, die einem die Beine lähmte, wenn man ein paar davon intus hatte. Ich hatte drei.
»Gibt es bisher irgend etwas zu bemerken?« fragte Agrot.
Ein Gedanke schoß mir unmittelbar durch den Kopf: Den Leuten, die sich in der Gegend aufhielten, wo ich arbeiten sollte, stießen merkwürdige Dinge zu. Aber das schien er nicht hören zu wollen. Ich fragte: »Was bedeutet das mit den Gesteinsproben?«
»Man nimmt an, daß die Menora unter einer Schicht aus blauem Marmor vergraben ist. In Galiläa gibt es keinen Marmor. Man geht davon aus, daß sie danach gesucht haben.«
»Das scheint mir eine ziemlich blöde Methode zu sein.«
»Sehr blöde. Paßt gut zu Sidqui. Aber nicht ganz nutzlos«, wandte Agrot ein. »Jedenfalls hat lange keiner begriffen, wozu diese Röhren gut waren.«
»Er wollte also den Marmor finden, die Menora ausgraben und sie zurück über den Jordan schleppen?«
»Nein, nein«, erwiderte Agrot, »die wäre viel zu schwer gewesen. Sie wollten sie wohl nur aufspüren, damit man sie später holen konnte.«
»Wer?«
»Genau«, sagte Agrot. Er sah sich um. Zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer waren Doppeltüren eingebaut. Tanja hatte einen Flügel offengelassen. Er stand auf und schloß ihn.
»Eine militärische Einheit«, sagte er. »Zumindest eine paramilitärische. Dort oben gibt es immer den einen oder anderen Zwist, wissen Sie? Angriffe, Gegenangriffe. Wo eine großangelegte militärische Operation vorgesehen ist, muß im voraus über ein paar Einsatzziele entschieden werden. Ich denke, daß die Menora eines dieser Einsatzziele geworden wäre. Sie wären unter einem Tarnziel dorthin marschiert. Und es gibt auch ein paar Hinweise, die das belegen. Wir wissen zum Beispiel, daß es nach Sidqui noch zwei Versuche gab, die Menora zu finden – sie haben Proberohre zurückgelassen. Und jedesmal fand einen Monat später ein recht heftiger Angriff statt. Wir nehmen an, die Eindringlinge wußten, daß diese Angriffe auf dem Plan standen. Es sieht jetzt so aus, als könnten wir mit dem nächsten Angriff rechnen.«
»Verstehe.«
»Und es gibt ein paar störende Details. Zum einen waren die Angriffe beim letzten Mal sehr dreist. Beim Einmarschieren wurden die Männer nicht gesehen, aber beim Abzug provozierten sie ein Gefecht – was ungewöhnlich ist. Und zweitens hatten sie ein Minensuchgerät bei sich. Sie haben es in den Fluß geworfen, und wir haben es gefunden. Das hätten sie sicher nicht getan, wenn vorher nicht jemand von ihnen den Marmor gefunden hätte.«
»In der Gegend, in der Sidqui gearbeitet hat?«
»Ich weiß es nicht. Wie ich Ihnen sagte, wurden sie erst gesehen, als sie die Grenze wieder überquerten. Aber es sieht so aus, als hätten sie den Marmor lokalisiert. Wir können natürlich zweierlei tun. Wir können uns von ihnen dort hinführen lassen und sie angreifen. Aber wir wollen keine Auseinandersetzung in der Nähe der Menora. Die Mistkerle könnten sie in die Luft jagen – uns bedeutet sie mehr als denen. Oder wir finden sie zuerst.«
»Wieviel Zeit haben wir?«
»Ich würde sagen, drei Wochen.«
Ich trank meinen Arrak aus. »Ich nehme an, die sind hinter der Menora her.«
»Kein Zweifel.«
»Und warum nicht hinter dem Gold?«
»Niemals.«
»Wieso nicht?«
»Geht heute keiner mehr ins Bett?« drang ein wenig damenhaftes Knurren durch die Doppeltüren.
Agrot stand eilig auf. »Es gibt gute Gründe«, sagte er, »über die wir noch sprechen können. Aber ein andermal. Es ist schon spät.«
Das war es tatsächlich. Es war nach zwei Uhr. Ich fuhr zum Hotel zurück und ging, schon leicht taumelnd, ins Bett.