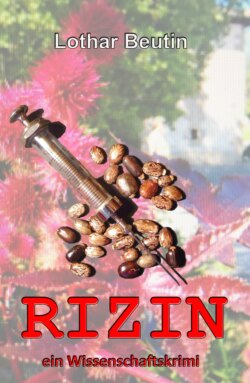Читать книгу Rizin - Lothar Beutin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.
ОглавлениеSchon eine Weile, bevor Leo Schneider zu einem dringenden Termin bei Professor Krantz, dem Direktor des IEI, gebeten wurde, hatte sich abgezeichnet, dass dem Institut einschneidende Veränderungen bevorstanden. IEI, das war das Berliner Institut für Epidemiologie und Infektionsforschung und Schneider war dort als Leiter einer bakteriologischen Forschungsgruppe angestellt. Schneider war Mitte vierzig und hatte fast zwanzig Jahre an verschiedenen Instituten in der bakteriologischen Forschung gearbeitet. Er pflegte einen familiären Umgang mit seinen Leuten, den er als Management by love bezeichnete. Leo Schneiders Arbeitsalltag verlief über die Jahre weitgehend ungestört, das sollte sich jedoch ändern, als Herbert Krantz zum Direktor des IEI ernannt wurde. An diesem Tag begann für das IEI eine neue Zeit, deren Morgenröte sich am 11. September 2001 im Schein der brennenden Twin Towers in Manhattan abzeichnete.
Leonhard Schneider war ein neugieriger Wissenschaftler, er arbeitete am besten aus Eigenmotivation, war aber kein Workaholic. Wie viele seiner Zunft quälte er sich mit der Vorstellung, zu wenige Ergebnisse zu produzieren, selbst wenn das nicht der Fall war. Viele entwickelten diesen Komplex während ihrer Ausbildung, da waren sie noch formbar und hatten wenig Selbstbewusstsein. Nach der Promotion hielten nur diejenigen weiter durch, die sich im Zwang des ewigen nie genug, zu Arbeit und Erfolg antrieben. Nachdem Schneider seine Doktorarbeit abgeschlossen hatte, musste er sich eine neue Position suchen und machte die übliche Tingeltour eines mit Zeitverträgen beschäftigten Wissenschaftlers. Zuerst noch ein paar Monate Verlängerung und dann für zwei Jahre als Postdoc in Paris.
In Paris hatte Leo Schneider seine Frau Louisa kennengelernt. Durch Zufall, wenn man es so nennen mag. Sie waren sich an der Metrostation Porte de la Chapelle begegnet. Er kannte die Stadt kaum, fragte sie nach dem Weg, und als sie sah, wie Schneider in die falsche Richtung lief, hatte sie ihn ein Stück begleitet. Louisa studierte Medizin und wurde neugierig, als sie hörte, dass Schneider an Infektionserregern arbeitete. Schließlich gingen sie in ein Café, um ihr Gespräch fortzusetzen. Schon bei dieser ersten Begegnung hatten beide das Gefühl, als wären sie miteinander vertraut. Verwandte Seelen erkennen sich schnell. Beide wollten sich wiedersehen. Nach ein paar Monaten zogen sie zusammen in eine kleine Dachwohnung in der Rue St. Vincent de Paul. Ihre Tochter Elsa kam noch in Paris zur Welt, kurz bevor Leos Vertrag am Institut Pasteur endgültig auslief. Die Familie zog nach Berlin, Leo hatte dort einen Anschlussvertrag an der Universität. Wieder und wieder arbeitete er mit befristeten Verträgen in neuen Instituten, bis er durch glückliche Umstände mit neununddreißig Jahren eine Festanstellung am IEI bekam.
Das alles lag jetzt ein paar Jahre zurück. Schneider hatte gelernt, dass der Wissenschaftsbetrieb überall ähnlich lief. Die langen Jahre mit den kurzen Arbeitsverträgen, einer unfreiwilligen Arbeitslosigkeit und der immer wiederkehrenden Aussicht auf eine ungewisse Zukunft hatten seinen Durchhaltewillen gestärkt. Durch den häufigen Institutswechsel war er Hierarchien gegenüber gleichgültig geworden. Vielleicht hatte er es deswegen versäumt, sich ein Netz von Beziehungen aufzubauen, nachdem er im IEI fest angestellt war. Das Gespräch mit seinen Vorgesetzten suchte er nur, wenn es sich nicht umgehen ließ. Es interessierte ihn auch nicht besonders, wer mit wem am Institut eine Affäre hatte. Während er im Labor stand, hatten andere ihre Zeit mit Schreiben von Anträgen, Beschwerden oder Forderungen verbracht, hatten in den Vorzimmern einflussreicher Personen geduldig gewartet, traten in Parteien und Organisationen ein und zogen auf der Karriereleiter an Schneider vorbei, auch wenn sie sonst nichts zustande gebracht hatten.
So war ihm anfänglich der neue Direktor Krantz auch keinen besonderen Gedanken wert. Schneider hatte Dekane, Direktoren, Präsidenten und Minister kommen und gehen sehen, seine eigentliche Arbeit blieb davon im Grunde unberührt. Aber das hatte sich nun geändert. Die Atmosphäre am IEI kühlte ab und selbst Schneider in seinem Labortreibhaus musste merken, dass es nicht mehr so weitergehen würde, wie bisher.
Der Vorgänger von Krantz war ein Verwaltungsjurist, den man nur als eine Zwischenlösung betrachtete. Man hoffte, ihn bald durch einen hochkarätigen Vertreter der Forscherzunft ablösen zu können. Eine solche Koryphäe wurde in der Person des Mediziners Professor Herbert Krantz, gefunden. Krantz vermittelte seiner Umgebung den Eindruck, zu den Großen in der AIDS-Forschung zu gehören. Seine Bewunderung für den als skrupellos geltenden Amerikaner Gallo, von dem man sagte, er hätte seinen französischen Kollegen Montagnier um die Entdeckung des AIDS Virus geprellt, machten ihn nicht zu einem Sympathieträger. Aber darum ging es Krantz auch nicht. Als Direktor hätte er sich um Ausgleich zwischen den verschiedenen Abteilungen im IEI bemühen müssen. Aber Krantz war Partei. Nur der Virologie galt seine ganze Unterstützung. Die dafür benötigten Mittel und das Personal zog er aus den anderen Bereichen ab. Arbeitsgruppen, die nicht in seine Vorstellungen passten, löste er komplett auf. Damit kam er auch dem nie endenden Ruf nach Reformen entgegen. Wer fragte schon danach, ob diese sinnvoll waren? Parallel dazu gestaltete er sich ein Institut nach seinem Maß. Dazu transferierte er ganze Arbeitsgruppen aus seiner alten Wirkungsstätte in das IEI. Diese neuen Gruppen bezeichnete er auf Betriebsversammlungen als sein Tafelsilber und erweckte damit bei allen anderen im Institut den Eindruck, als würden sie zum Wegwerfbesteck gehören.
Bei seinem Dienstantritt versprach der neue Direktor Krantz Bürokratieabbau und flache Hierarchien. Das klang nach Revolution und es stimmte auch. Denn bald danach gab es nur noch zwei Hierarchien, den Direktor und den Rest des Instituts. Bürokratieabbau bedeute für ihn, dass seine Anweisungen ohne Wenn und Aber vollzogen werden mussten.
Zu Terminen kam Krantz gewöhnlich etwa fünfzehn Minuten zu spät. So vermittelte er den Eindruck, ein viel beschäftigter Mann zu sein. Nach einer Viertelstunde tauchte er in dem mit Milchglaswänden abgeteilten Wartezimmer auf und murmelte etwas von dringenden Meetings, während er seinen Besuch in die edel eingerichtete Bürosuite führte. Große finanzielle Aufwendungen konnten dort besichtigt werden. Aus den ehemaligen Laborräumen hatte Krantz Wände und Decke herausreißen und alles neu gestalten lassen. Die Beleuchtung, die sich dem Tageslicht automatisch anpasste, die schweren, gepanzerten Türen, die sich leicht und lautlos wie auf Kufen bewegten und das teure, steril wirkende Mobiliar hinterließen einen bleibenden Eindruck. Für die unterkühlte Atmosphäre sorgte eine eigene Klimaanlage, die Krantz sich auf das Dach des Institutes hatte montieren lassen.
Seine Personalentscheidungen verliefen nach einem genauen Ritus. Er bat die Betroffenen eine Woche vorher zum Gespräch, ohne dass sie erfuhren, worum es ging. Für viele waren es Tage des bangen Wartens, denn Krantz war für Überraschungen gefürchtet. Bei Umsetzungsmaßnahmen nahm sein Leitungsstab teil, Personalchefin Kanter und Vizedirektor Arnold.
Frau Kanter erschien gewöhnlich erst weit nach neun Uhr im Institut und blockierte mit ihrem knallgelben Auto die Parkplätze von Mitarbeitern, die vor ihr gekommen waren. Um sein Auto auszulösen, musste man Frau Kanter anrufen und sich die Frage gefallen lassen, warum man schon so früh nach Hause ging. Vizedirektor Arnold war ein ebenso dümmlicher wie bösartiger Charakter. In seinem Gehabe erinnerte er an die Figur des Untertanen aus dem gleichnamigen Buch von Heinrich Mann. Arnold war ein Radfahrertyp, der nach oben buckelte und nach unten trat. Krantz hielt sich gewöhnlich zurück, er zog im Hintergrund die Fäden und ließ Kanter und Arnold agieren. Als Bürotäter machte er sich die Finger nicht schmutzig.
Bald war die Reihe an Schneider, bei einem dieser Dramen mitzuspielen. Nach den üblichen fünfzehn Minuten holte Krantz ihn in sein Büro, um sich bei Tee und Gebäck über personelle Überkapazitäten in Schneiders Bereich auszulassen. Die Personalchefin blätterte dabei desinteressiert in einem Aktenordner, während der Vize Arnold sich hektisch Notizen machte. Frau Daniela Schulz aus Schneiders Gruppe wurde für andere Tätigkeiten im IEI benötigt. Schneiders Einwände kommentierte Krantz mit der Bemerkung: „Sie können wohl nicht richtig kommunizieren.“ Schneider verstand das nicht. Kommunizieren, das wollte er doch. Und dem Direktor erklären, dass er Frau Schulz dringend brauchte. Ob Krantz das nicht verstehen würde. Krantz gefiel die Aufgeregtheit von Schneider nicht. Schneider sei viel zu emotional. Den Rest der Sitzung überließ er Kanter und Arnold. Als Daniela Schulz kurz danach in eine andere Arbeitsgruppe wechseln musste, hatte Schneider begriffen, dass es um seine berufliche Existenz ging.
Im Gegensatz zu den eher lässig angezogenen Wissenschaftlern am IEI war Krantz stets konservativ gekleidet, er bevorzugte den dunkelgrauen Maßanzug. Seine hohe Stirn und das seitlich heruntergekämmte, weißgraue Haar gaben ihm das Image eines Denkers. Seine Mundpartie, die von einem dünnen Schnurrbart überspannt wurde, verriet mehr von seinem wahren Charakter und verzog sich bisweilen zu einem zynischen Grinsen.
Typischerweise sprach Krantz mit leiser Stimme, ein rhetorischer Trick, den er bewusst einsetzte. So erzwang er andächtiges Zuhören. Man fürchtete, seine bedeutungsschweren Mitteilungen sonst nicht richtig zu verstehen. Den Personalrat hatte er in der Tasche, die alten Mitarbeiter hatten sich angepasst oder waren gegangen. Die neu Eingestellten wussten nicht, dass es vor Krantz kollegialere Umgangsformen am IEI gegeben hatte. Binnen weniger Monate hatte sich das IEI in ein gefügiges Instrument in den Händen seines Direktors verwandelt.
Die Unterwerfung des IEI unter seine Interessen war kein Selbstzweck, sie diente Krantz auf seinem Weg zu einer Person des öffentlichen Lebens. Seine Eitelkeit fixierte ihn wie ein Spiegelbild auf seine öffentliche Wirkung. Dabei kam ihm zugute, dass ein Institut für Infektionskrankheiten im Fokus der Medien stand. Kontakte zwischen Institutsangehörigen und Journalisten bedurften seiner persönlichen Genehmigung. Interviews gab er gerne selbst, am Telefon, da fiel es nicht auf, wenn er fachlich nicht Bescheid wusste. Hatte er doch seine wissenschaftlichen Souffleure neben sich sitzen, die ihm in den Gesprächspausen die notwendigen Stichworte ins Ohr flüsterten. So vermittelte er der Öffentlichkeit ein „Professor Allwissend“, ein modernes Universalgenie zu sein, das auf jede Frage zu Infektionskrankheiten die passende Antwort bereithatte.
Nachdem er auf diese Weise schnell zu einem landesweit bekannten Experten geworden war, ging er noch einen Schritt weiter. Nun vermittelte er seine Botschaft im Fernsehen, verpackt in Form von düsteren Zukunftsprognosen. Neue Seuchen bedrohten das Land, Massenimpfungen seien erforderlich, aber Impfstoff, Geld und gute Forscher wären Mangelware. Nur er und sein Institut könnten das Land vor dem Untergang bewahren. Szenarien mit toten Vögeln und der Entstehung neuer Todesviren, mit Seuchenzügen als Folgen von Tsunami und Wirbelstürmen wurden durch seine Reden schon Gewissheit. Ob sie jemals einträfen, war zweitrangig. Sein Bekanntheitsgrad stieg, sein Nimbus als wissenschaftliche Überkapazität wuchs zu einer festen Größe des politischen Lebens. So setzte er die Politik unter Zugzwang, spekulierte auf Zufluss von Geld und Personal und vermehrte sein Prestige.