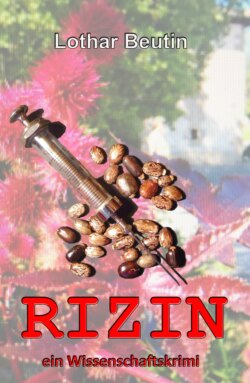Читать книгу Rizin - Lothar Beutin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеLeo Schneiders neuer Vorgesetzter, Professor Horst Griebsch war mit Anfang fünfzig fast völlig kahl. Mit seinem Kinnbart, der dicken Hornbrille und seiner gesetzten Stimme gab er das Bild eines gestandenen Mannes der Wissenschaft. Von dem eher plump auftretenden Hellman unterschied er sich durch einen jovialen Umgangston. Als typischer Alt-Achtundsechziger bot er seinen Mitarbeitern gerne das Du an. Je nach seinem Gegenüber vermittelte er das Image des guten Kumpels oder des väterlichen Freundes.
Griebsch redete viel von Loyalität. Loyalität war eine Sache, die er forderte, aber nicht bereit war zu geben. Er bat seine Mitarbeiter zu Vieraugengesprächen, in denen er mit angeblich wichtigen Informationen hausierte, die er wie Schwarzmarktware anbot. Manche ließen sich davon beeindrucken, fühlten sich geschmeichelt und machten alles, was er von ihnen wollte. Griebsch war bewusst, dass er von vielem etwas, aber nichts richtig verstand. Das machte ihn zu einem unsicheren Vorgesetzten, der seine Leute gegeneinander ausspielte. Nur so konnte er sich in seiner Position einigermaßen sicher fühlen.
Bei einem dieser Treffen sagte er zu Schneider: „Wir sind doch beide an Wissenschaft interessiert, das mit dem Bioterror ist doch nur vordergründig.“ Schneider glaubte ihm, erzählte von sich und von seinen Problemen mit Hellman und Krantz. Griebsch verstand das, versprach Unterstützung und als Zeichen der Zusammenarbeit überließ er Schneider die Betreuung seiner Studenten. Das ersparte ihm Arbeit und gleichermaßen hoffte er, davon zu profitieren. Am wichtigsten war ihm aber, er hatte den unbequemen Schneider eingebunden und glaubte, dieser würde in seinem Sinne funktionieren.
Vielleicht hätte Schneider auf diese Art auch funktioniert. Hier ein bisschen Geld für die Forschung, da ein paar Studenten und dort eine kleine Freiheit im Labor. Das Problem lag bei Griebsch, bei seinem Argwohn, der ihm als Mensch ohne Rückgrat wie eine Krücke diente. Eine Zeit lang hielt die labile Konstruktion zwischen Griebsch und Schneider, aber ein kleiner Anlass genügte, um sie zum Einsturz zu bringen.
Der Anlass hieß Rudolf Drewitz, ein früherer Vorgesetzter Schneiders. Drewitz stand kurz vor seiner Pensionierung, damit war er praktisch immun gegenüber den Disziplinierungsmaßnahmen der Leitung. Drewitz war von der Idee getrieben, die dunklen Machenschaften im IEI ans Licht zu bringen. Die von Krantz betriebene Abwickelung der Bakteriologie hatte ihm nicht gepasst. Drewitz war kurz vor dem Mauerbau aus der DDR in den Westen übergesiedelt, um dort Mitglied einer großen politischen Partei, die für Gerechtigkeit stand, zu werden. In der Partei und im Institut machte er sich bald einen Namen als Kommunikator. Er saß mehr am Telefon als im Labor. Mit seiner Partei und seiner Rolle als Kämpfer für die Gerechtigkeit stand er in Fundamentalopposition zu Krantz.
Drewitz startete eine Kampagne gegen den Vizedirektor Tobias Arnold, nachdem er auf dem Fotokopierer zufällig einen Beratervertrag gefunden hatte. Einen Vertrag, den Arnold mit einer Pharmafirma abgeschlossen und unachtsam liegen gelassen hatte. Für den Beamten Arnold konnte das Konsequenzen haben. Beraterverträge bedurften der Genehmigung des Ministeriums. Arnold hatte nicht darum ersucht. Die Geschichte wäre in einem Disziplinarverfahren geendet, wenn Krantz mit seinem Einfluss die Sache nicht heruntergespielt hätte. Arnold war ihm daraufhin so ergeben, dass er sich ein gerahmtes Porträt von Krantz neben das Foto seiner Familie auf den Schreibtisch stellte.
Drewitz, der über seine Partei Verbindungen zu Parlamentariern hatte, bohrte weiter. Immerhin ging es um ein fünfstelliges Honorar. Er brachte Arnold immer wieder in Erklärungszwang. Irgendwann hatte Drewitz Schneider davon erzählt. Drewitz sagte, es gäbe noch mehr Informationen und er könne dafür sorgen, dass Arnold nicht mehr lange als Vizedirektor tragbar wäre. Das wirkte übertrieben, aber Schneider wusste, wie viel Einfluss Drewitz in bestimmten Kreisen hatte. Drewitz Aktivitäten liefen zumeist über die Frauen von Politikern, die in dieser Zeit der Opposition angehörten. Gegenüber den Damen spielte er die Rolle des galanten Kavaliers, führte sie aus, bevorzugt in die Oper oder ins Konzert. Weil Drewitz schwul war, hatte er ein besseres Gespür für die Bedürfnisse dieser Frauen, als ihre eigenen Männer, die sich kaum noch für ihre Gattinnen interessierten.
Schneider war klar, Drewitz ging es dabei um politische Einflussnahme. Aber Arnold hatte sich ihm gegenüber mies verhalten, als Krantz ihm seine Assistentin Daniela abgezogen hatte. Aus diesem Grund fand Leo Schneider die Initiative von Drewitz auf eine Art amüsant. Aus einer Laune heraus hatte Schneider Griebsch von Drewitz Plänen erzählt. Griebsch gab ja den Anschein, distanziert gegenüber der Institutsleitung zu sein.
Als Schneider eines Nachmittags in sein Labor kam, flüsterte Tanja ihm zu: „Albino ist bei dir im Büro.“ So nannte sie Arnold, wegen der farblosen Haare und seiner Augen, die manchmal rötlich wie bei einer weißen Maus schimmerten. Schneider dachte sich nichts weiter. Als er in sein Büro kam, saß Arnold dort auf einem Stuhl. Arnold ließ ihm keine Zeit für Fragen und polterte los: „Mir wurde zugetragen, dass Herr Drewitz Ihnen gegenüber verleumderische Behauptungen über mich aufgestellt hat, mit der Absicht, meine Person zu schädigen. Ich muss Sie bitten, als Zeuge zur Verfügung zu stehen, damit wegen übler Nachrede Disziplinarmaßnahmen gegen Herrn Drewitz vorgenommen werden können.“
Schneider war perplex. Woher wusste Arnold von dieser Sache? Ob Griebsch etwas erzählt hatte? Aber zuerst musste er Arnold abwimmeln und sagte: „Wenn man alles, was einem auf dem Flur zwischen den Labortüren erzählt wird, für bare Münze nimmt, müsste man das halbe Institut wegen Beleidigung und übler Nachrede anzeigen.“
Arnold ließ sich nicht abwimmeln und drohte Schneider, er mache sich strafbar, wenn er den Verleumder Drewitz deckte. Schneiders Position im Institut sei dann gefährdet. An der Geschichte von Drewitz musste also etwas dran sein, dachte Schneider und ärgerte sich, Griebsch davon erzählt zu haben, denn nun bekam er dafür die Quittung. Ihm blieb nur zu sagen: „Wissen Sie Herr Arnold, ich kann mich an den Inhalt des Gespräches nicht mehr genau erinnern, was soll ich denn da zu Protokoll geben?“ Schneider blickte an Arnold vorbei auf seinen Computerbildschirm, auf dem es außer Schwärze nichts zu sehen gab.
Arnold wurde knallrot und richtete sich halb auf. „Denken Sie doch mal daran, wie ich damit an den Pranger gestellt werde.“ Seine Stimme stieg um einen Grad höher. „Das ist unkollegial, Herr Schneider, Sie können mich nicht einer solchen Schmutzkampagne aussetzen!“
Diese Leute redeten immer dann von Kollegialität, wenn sie selbst in der Patsche saßen, dachte Schneider. „Ich kann mich nicht an ein solches Gespräch erinnern, Herr Professor Arnold. Bedaure.“
Arnold stand ruckartig auf, der Bürostuhl rollte nach hinten und prallte an einen Tisch. Dann verließ er das Büro, ohne noch etwas zu sagen. Besser so, dachte Schneider, wer wusste schon, was er sonst noch zu Arnold gesagt hätte. Nun hatte er sich einen erklärten Feind gemacht. Noch Stunden später ging Schneider diese Sache nicht aus dem Kopf. Er ärgerte sich über die Hinterhältigkeit, mit der Griebsch ihn ins Vertrauen gezogen hatte, aber noch mehr über seine eigene Naivität.
Am gleichen Tag ging er zu Griebsch, um zu reden. Er dachte, Griebsch würde alles abstreiten, aber das Gegenteil war der Fall. „Drewitz ist doch ein Spinner, er hat dir früher soviel Ärger gemacht, warum schützt du ihn?“
Schneider fing an sich zu rechtfertigen und sagte, die Sache war nicht für Arnolds Ohren bestimmt. Er hatte gedacht, Griebsch würde das vertraulich behandeln und im Übrigen würde er niemanden anschwärzen.
Griebsch versuchte Schneider zu überreden: „Ich habe Arnold das alles doch nur in unserem Interesse erzählt. Drewitz will uns allen schaden. Wenn er mit seinen Behauptungen Gehör findet, steht das ganze IEI schlecht da, und auch du leidest darunter.“ Sein Tonfall wurde plötzlich schärfer: „Für uns alle wäre es besser, wenn Drewitz möglichst bald geht. Es bringt nichts, sich vor ihn zu stellen.“
Leo Schneider fühlte, wie er in eine Richtung gedrängt wurde, in die er nicht wollte. Hatte Griebsch nicht versprochen, dass alles vertraulich blieb? Jetzt gab er sogar zu, Arnold informiert zu haben. Vielleicht hatte Arnold jetzt wieder seine Finger drin und wollte ihn durch Griebsch dazu bringen, Drewitz doch anzuschwärzen. Schneider hatte die Lust zu weiterem Reden verloren. Griebsch schaute ihn durch seine Brille an, als erwartete er etwas von ihm. Schneider schwieg. Als die Spannung zunahm und Schneider schließlich aufstand und gehen wollte, hörte er, wie Griebsch ihm hinterher rief: „Ich halte dir den Rücken frei, aber dafür erwarte ich von dir Loyalität, vergiss das nicht!“
Leo Schneider war schon auf dem Flur, als er die Drohung begriff. Jetzt hatte er Arnold und Griebsch gegen sich. Irgendetwas musste er tun. Er dachte an Drewitz. Drewitz war nicht sein Freund, konnte aber vielleicht auf der politischen Ebene etwas erreichen. Eine Zeit lang geschah nichts. Arnold und Schneider behandelten sich wie Luft, wenn sie sich begegneten. Schneider erinnerte sich, wie er vor ein paar Jahren Arnold im Hallenbad getroffen hatte. Arnold stand nackt unter der Dusche und tat so, als würde er Schneider nicht kennen. Dabei hatte er ihn genau gesehen. Vermutlich hasste Arnold ihn seitdem, es hatte ihm nicht gefallen, dass ihm Untergeordnete einen Einblick auf seine bescheidene Männlichkeit nehmen konnten.
Nach einigen Tagen ging Schneider doch zu Drewitz und erzählte ihm von Arnolds Forderung und dem Gespräch mit Griebsch. Drewitz lachte hämisch und verzog seinen Mund zu einer Grimasse. „Der macht mir keine Angst, im Gegenteil. Arnold und Griebsch sind korrupte Existenzen, Schwächlinge, denen das Handwerk gelegt werden muss.“ Er tat einem Seitenblick, als wollte er sich vergewissern, dass niemand anderes zuhörte und flüsterte: „Und Krantz, der sich vor Arnold stellt, der ist sowieso fertig, dem haben sie nämlich die Eier abgeschnitten.“ Schneider schaute ihn mit großen Augen an. „Ja!“, betonte Drewitz genüsslich: „Sie haben ihn kastriert, ihm die Eier abgeschnitten. Totaloperation, Krebs!“ Drewitz nickte mehrmals und sah Schneider aus seinem bleichen Gesicht an, in dem die Augen tief in den Höhlen lagen. Er erinnerte Schneider an den Vampir Nosferatu aus dem Film von Fritz Lang. „Woher willst du denn das wissen?“, fragte er.
„Man hat so seine Quellen“, erwiderte Drewitz und griente, als er sah, wie seine Worte bei Schneider Wirkung zeigten. Wie schon so oft versuchte er, Schneider für seine Partei zu begeistern. Der wehrte ab. „Sei nicht töricht“, sagte Drewitz. „Du brauchst Verbündete. Wie willst du denn das alleine durchstehen?“
Schneider wollte sich keiner Organisation verpflichten. Drewitz war inzwischen der Dritte, der ihn vor seinen Karren spannen wollte. Mit jeder neuen Person, mit der er über seine Schwierigkeiten sprach, wurde seine Situation komplizierter.
„Sei nicht dumm“, bedrängte ihn Drewitz weiter, „überleg es dir.“
Schneider empfand eine tiefe Leere vor der Sinnlosigkeit dieser ganzen Intrigen. Warum ließ man ihn nicht einfach in Ruhe arbeiten? Seine Beziehung zu Drewitz war seit jener Zeit distanziert, als er und Tanja den Eindruck gewonnen hatten, dass mit Drewitz politischen Verbindungen etwas nicht stimmte. Drewitz war kurz vor dem Mauerbau aus der DDR in den Westen gekommen. Zu Mauerzeiten durfte er unbegrenzt in die DDR reisen, im Westen galt er als verfolgter Dissident. Drewitz brachte von drüben immer wieder Antiquitäten mit, Sachen, die man unmöglich legal ausführen konnte. Beide glaubten, dass er ein Agent der Stasi war. Vielleicht hatte er auch über sie beide berichtet. Als ihre Neugierde groß genug geworden war, gingen sie in die Glinkastraße, um bei der Stasiunterlagenbehörde ihre Akten einzusehen. Es dauerte Monate, bis die Nachricht kam, dass es keine Akten über sie gab. Wahrscheinlich war Drewitz zu raffiniert, als das man ihm so einfach hätte auf die Schliche kommen können. Bei ihm war alles möglich und Schneider wusste immer noch nicht, ob er ihm die Geschichte mit Krantzens abgeschnittenen Eiern glauben sollte.
Nachdem Schneider nicht auf sein Angebot reagiert hatte, verhielt sich Griebsch ihm gegenüber zunehmend reserviert. Bisweilen machte er Andeutungen, als würde er etwas erwarten. Schneider zog sich nur noch mehr zurück. Wenn Griebsch ihn ansprach, gab er nur Belanglosigkeiten von sich und vermied nach Möglichkeit jeglichen Kontakt.
Nachdem die Anthraxbriefe Geschichte waren, sah es für eine Weile so aus, als würde man Schneider in Ruhe lassen. Dann kam der Anruf aus dem Präsidialbüro. Krantz persönlich. Schneider sollte der neu eingestellten Kollegin Dr. Pflüger doch für eine Zeit lang mit einer seiner beiden Assistentinnen aushelfen. Schneider könne selbst entscheiden, welche seiner beiden Damen er entbehren wolle. Er hätte nicht viel Zeit, sagte Krantz, Einzelheiten sollte Schneider mit seinem Stellvertreter Arnold besprechen.
Natürlich ging es nicht um eine Aushilfe für kurze Zeit, das war für endgültig. Aber wie sollte Schneider das beweisen? Kollegiale Hilfe für die neu eingestellte Kollegin konnte er doch nicht ausschlagen. Schließlich suchte er doch das Gespräch mit Arnold.
„Sie wollen sich doch nicht weigern, Ihrer Kollegin Pflüger für eine Zeit mit personeller Unterstützung auszuhelfen?“, sagte Arnold. Das Gespräch bereitete ihm Vergnügen und er gab sich keine Mühe, es zu verbergen. „Handeln Sie doch einmal im Sinne der Corporate Identity.“
Corporate Identity war ein zuweilen beschworener, aber nicht existierender Instituts-Gruppengeist, der von der Leitung herbeizitiert wurde, wenn Entscheidungen gegen den Willen der Beschäftigten durchgesetzt werden sollten. Jetzt bedauerte Schneider, dass er zu Arnold gegangen war. Er wollte nicht wählen, ob Tanja oder Karin gehen musste. Zum Glück nahm Karin ihm diese Entscheidung ab. Schneiders Arbeitsgruppe war somit auf Tanja und ihn reduziert. Das würde auf Dauer nicht genügen, um ihre Selbstständigkeit zu behaupten.
Eine Zeit ging zu Ende, in der Schneider aus seiner Arbeit Kraft gewinnen konnte. Die nächste Umsetzungsmaßnahme würde ihn direkt treffen. Tanja und er schwammen bereits in einem Stellenpool, aus dem man für die nächste Umstrukturierung schöpfen würde. Es war nur noch eine Frage des Wann und nicht mehr des Ob. Vielleicht musste er dann den Messknecht für einen Wissenschaftler spielen, der zum Tafelsilber von Krantz gehörte? Diese Vorstellung erzeugte bei Schneider Panik. Seine früheren Erfolge würden bald vergessen sein, ein has been, wie man in den USA zu solchen Leuten sagte. Mit den Jahren würde man ihn wie einen zahnlosen Wolf im Institut immer mehr herumstoßen.
Diese Erwartungen brachten ihm schlaflose Nächte, eine Anzahl grauer Haare und deutlichere Falten um die Mundwinkel ein. Die nervliche Anspannung durch eine Situation, auf die er keinen Einfluss hatte, steigerte seine Unrast und seinen Bewegungsdrang. Als Reaktion kaufte er sich ein Paar Inlineskates und begann nach der Arbeit und an den Wochenenden auf einsamen Straßen auf und ab laufen. Er nahm es wie eine Medizin. Auf einer dieser Touren geschah etwas mit ihm. Vielleicht waren es die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut, die Luft, die ihm ins Gesicht wehte, oder das Lächeln der Skaterin, die ihm entgegenkam. Der Gedanke, nicht alles mit sich geschehen zu lassen, sondern selbst nach einem Ausweg zu suchen, war plötzlich da und sehr stark.
Eine Stellenausschreibung erschien ihm als die Gelegenheit, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Am IEI wurde eine neue Arbeitsgruppe Toxine, die sich mit Giftstoffen beschäftigen sollte, eingerichtet. Für die Leitung suchte man jemanden mit toxikologischen und bakteriologischen Kenntnissen. Diese neue Gruppe sollte Griebsch unterstellt sein. In der Zwischenzeit hatte Leo Schneider erfahren, dass Griebsch für die Umsetzung von Karin verantwortlich gewesen war. Drewitz hatte ihm diese Information aus dem Personalrat gesteckt. Schneider gab trotzdem sein Bewerbungsschreiben ab. Er und Tanja waren bereits Griebsch unterstellt und der würde sie beide sowieso nicht mehr lange weiterwerkeln lassen.
In der Stellenausschreibung stand etwas von Giftstoffen, von biologischer Sicherheit und Gefahrenabwehr gegen Terroranschläge. Schneider zweifelte am Erfolg seiner Bewerbung. Zwar kannte er sich mit Bakteriengiften aus, aber Arnold hatte bei der Stellenbesetzung sicherlich ein Wort mitzureden. Drewitz steckte Schneider weitere Informationen zu. Demnach gestaltete sich die Suche nach Toxikologen als schwierig. Es gab nicht viele davon und noch weniger, die bereit waren, an das IEI zu wechseln. Wenn es fähige Leute waren, erwarteten sie mehr Gehalt und Gestaltungsmöglichkeiten, als Krantz ihnen zugestehen mochte. So folgte eine Stellenausschreibung auf die andere und das Ministerium drängte immer stärker auf baldige Besetzung.
Schließlich entschloss Krantz sich zur billigsten Lösung, er akzeptierte Schneiders Bewerbung. Die AG-Toxine interessierte ihn im Grunde nicht und die Personalmittel, die er für die Neueinstellung eines externen Bewerbers gebraucht hätte, konnte er damit einsparen und in seine virologischen Projekte stecken. Für einen Misserfolg müsste Schneider verantwortlich zeichnen. Mit dieser Logik waren Arnold und Hellman überstimmt, die sich bis zuletzt gegen Schneider ausgesprochen hatten.
Leo Schneider durfte weiter mit Tanja zusammenarbeiten. Allerdings waren zwei Leute für eine Arbeitsgruppe nicht ausreichend. Arnold veranlasste, dass zusätzlich eine Wissenschaftlerin aus seiner Abteilung der AG-Toxine zugeteilt wurde. Sie war fünfzehn Jahre jünger als Schneider, Immunologin und hieß Beatrix Nagel. Beatrix, die jeder Bea nannte, bekam zu ihrer Unterstützung noch zwei technische Assistenten, Jacek und Maria. Offiziell war Beatrix Nagel Schneider nachgeordnet. Von der Leitung hatte sie den Auftrag, darauf zu achten, was Schneider trieb und sollte melden, wenn er die AG-Toxine für seine alten Forschungsprojekte benutzte. Dadurch war Schneider in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Nominell blieb er ihr Vorgesetzter und wollte die Aufgaben so verteilen, dass er und Bea sich nicht sonderlich ins Gehege kämen.