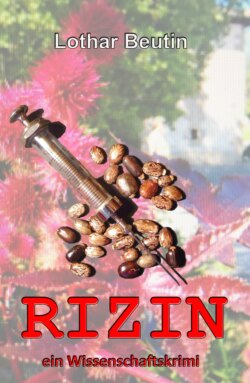Читать книгу Rizin - Lothar Beutin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.
ОглавлениеGriebsch hatte bei der Stellenbesetzung hin und her laviert. Als Opportunist merkte er, woher der Wind wehte und hatte am Ende für Schneider votiert. Allerdings gab es noch Widerstand von Hellman, mit dem Griebsch es sich nicht verscherzen wollte. Als Leiter der BIGA befürchtete Hellman Machtverlust durch eine neue Arbeitsgruppe im Bereich Bakteriologie unter Griebsch. Hellman war Virologe. Tatsächlich aber gab es mehr Bakterien und Toxine als Viren auf der Liste potenzieller Biowaffen. Einzig das Pockenvirus überstand Austrocknung, alle anderen Viren gingen in der Umwelt schnell kaputt und waren damit als B-Waffen schlecht geeignet.
Um seinen Einfluss zu wahren, verfasste Hellman genaue Auflagen, über welche Themen die AG-Toxine arbeiten sollte. In einer Liste des amerikanischen CDC waren das Pflanzengift Rizin und das Bakteriengift Botulinumtoxin als wichtigste Biowaffen beschrieben. Nachdem Krantz seinem Freund Hellman bei der Stellenbesetzung widersprochen hatte, ließ er ihm freie Hand bei der Aufgabenverteilung. Horst Griebsch hatte keine eigenen Ideen und war dankbar für Hellmans Vorschläge. Diese sahen die Entwicklung von Nachweisverfahren für Rizin und Botulinumtoxin vor. Nachweisverfahren, die so empfindlich sein sollten, dass mit ihrer Hilfe Anschläge aufgedeckt, Spuren verfolgt und Gegenmaßnahmen entwickelt werden konnten.
Hellman rechnete sich aus, dass Schneider an diesen Aufgaben scheitern würde. Dann konnte er der jungen Beatrix Nagel die Leitung der AG-Toxine zuschanzen. Aber vorher musste er diese Frau von sich abhängig machen, damit sie ihm nützlich war. Einen Hebel dazu hatte er: Beas Mann Ronald Nagel, der mit einem befristeten Vertrag in Hellmans Abteilung als Wissenschaftler angestellt war. Hellman konnte Bea mit Ronalds Vertragsverlängerung unter Druck setzen. So hatte er die Entwicklung im Griff.
Leo Schneider wurde bei der Aufgabenplanung für seine neue Arbeitsgruppe nicht befragt. Er bekam als Vorgabe mit Botulinumtoxin und Rizin zu arbeiten. Seine neue Kollegin Bea wusste nicht mehr über diese Stoffe, als er selbst. Schneider kannte sich mehr mit Bakterientoxinen aus und Bea mehr mit den Nachweismethoden. Dadurch würden sie aufeinander angewiesen sein, hoffte er.
Allerdings konnte Leo Schneider mit Beatrix auf die Dauer nicht mithalten. Sie arbeitete in der Regel zehn bis zwölf Stunden täglich. Eigentlich war sie ein zarter Typ, mit aschblonden Haaren, grauen Augen und einem schmalen Gesicht, aber mit einem starken Willen ausgestattet. Als Frau hatte sie es in der Wissenschaft doppelt so schwer, wie ein Mann. Frauen mussten mehr leisten, um anerkannt zu werden, diesen Eindruck hatte Bea gewonnen. Ihren Mann Ronald hatte sie im IEI kennengelernt. Beide waren in der gleichen Arbeitsgruppe und neu in Berlin. Beide träumten davon, später in ein renommiertes Forschungsinstitut in den USA zu gehen. Am Anfang sahen sie sich eher als Konkurrenten, doch die gegenseitige Sympathie überwog. Bedingt durch die langen Arbeitstage und Nächte im Institut fanden beide kaum die Zeit, sich einen Bekanntenkreis außerhalb ihrer Arbeitswelt aufzubauen. So nutzten sie die Möglichkeit, Arbeit und Privatleben zu verbinden. Ihre Beziehung und die baldige Heirat waren ein Gegenpol zu der ungewissen Zukunft, welche die Arbeit in der Forschung beiden bot.
Schneider erzählte Bea, dass er früher auch oft so lange im Labor gesessen hatte. Durch seine Ehe mit Louisa und seinem Bekanntenkreis in Berlin war das Institut aber nie der Mittelpunkt seines Lebens gewesen. Das Leben bestand eben nicht nur aus dem Labor. Mit Mitte vierzig wollte er nicht mehr so weitermachen, wie kurz nach seiner Doktorarbeit. Bea akzeptierte das ohne Widerspruch. Im Gegenteil, es war ihr sogar recht. Sie hoffte, den flügellahmen Schneider durch forscherisches Durchstarten früher oder später zu beerben und die Leitung der AG-Toxine zu bekommen. Dann wäre auch eine feste Stelle für Ronny in Aussicht und sie konnten ihren Kinderwunsch verwirklichen. Die Zeichen von Krantz waren doch eindeutig. Sie hatte zwei technische Assistenten bekommen, während Schneider nur mit Tanja auskommen musste.
Schneider begann, sich mit Rizin und Botulinumtoxin zu beschäftigen. Er lernte mehr über die Eigenschaften von Giftstoffen, die in der Natur vorkamen. Rizin und Botulinumtoxin waren die stärksten bekannten Gifte überhaupt. Zuerst musste er sich diese Stoffe jedoch beschaffen. Als er nach möglichen Bezugsquellen suchte, erschien es ihm leichter, mit Rizin zu beginnen. Rizin kam in den Samen des Wunderbaums vor, einer Pflanze mit dem lateinischen Namen Ricinus communis. Rizinus wurde in warmen Ländern großflächig zur Ölgewinnung angebaut. Schneider hatte Bilder der Pflanze gesehen und sie kam ihm bekannt vor. Rizinus war zwar kein einheimisches Gewächs, aber Schneider kannte die großen auffälligen Sträucher aus Parkanlagen und sie waren ihm in Erinnerung geblieben.
Die Rizinussamen waren überraschend leicht zu beschaffen. Immerhin waren die Samen sehr giftig, es genügte, ein paar davon zu verzehren, um daran zu sterben. Vögel und wilde Tiere verschmähten diese Samen instinktiv und so schützte die Pflanze ihre Nachkommenschaft. Eigentlich kam so etwas häufig in der Natur vor. Viele Pflanzen produzierten Giftstoffe gegen Fressfeinde. Der Tabak war ein gutes Beispiel, Schneider hatte früher viel geraucht. Das Nikotin in den Blättern diente zur Abwehr gegen fressgierige Insekten. Aber für den Menschen wurde der Tabak dadurch erst attraktiv. „Ob die Natur das vorgesehen hatte?“, fragte sich Schneider halb belustigt. Aber am Ende profitierte die Tabakpflanze von der menschlichen Sucht, denn deswegen wurde sie in einer Menge verbreitet, wie sie es von allein in der Natur nie geschafft hätte. Schneider dachte gerne über solche Fragen nach. Die Biologie und die Physik waren schon immer eine Herausforderung an die Philosophie gewesen.
Die Recherchen über Rizin brachten Interessantes zutage. Tatsächlich war dieser Stoff schon für kriminelle Zwecke genutzt worden. Nicht von religiösen Fanatikern oder politischen Desperados, sondern vom Geheimdienst eines regulären Staates, des damals kommunistischen Bulgarien. Ein bulgarischer Dissident namens Georgij Markov, der im Londoner Exil lebte und dessen Aktivitäten in seiner alten Heimat Missfallen erregten, sollte auf raffinierte Weise liquidiert werden. Ein Agent wurde mit einem Regenschirm ausgerüstet, dessen Spitze in einer Injektionsvorrichtung endete. Der Agent suchte die scheinbar zufällige Begegnung mit Markov im Getriebe der Londoner Innenstadt. Er stach ihm wie versehentlich mit dem Schirm ins Bein, um mit einer Entschuldigung in der Menge zu verschwinden. Markovs oberflächliche Verletzung stellte sich bald als schwerwiegend heraus. Er bekam Vergiftungserscheinungen, Fieber, Übelkeit und Erbrechen um wenige Tage nach dem Vorfall qualvoll zu sterben.
Vielleicht wusste der britische Geheimdienst MI5 mehr, als offiziell bekannt gegeben wurde. Jedenfalls wurde bei Markov eine ausführliche Autopsie durchgeführt. In der Einstichstelle fand man eine winzige hohle Metallkugel, die noch Reste von Rizin enthielt, das durch den Anschlag in seinem Körper freigesetzt wurde. Weniger als ein tausendstel Gramm davon reichten, um einen erwachsenen Menschen umzubringen.
Umso erstaunlicher schien es, dass Rizinussamen so leicht erhältlich waren. Wenn man es genauer nahm, gab es allerdings viele Giftpflanzen, die einem schon vor der eigenen Haustür begegneten. Wurde nicht Sokrates durch das Gift des einheimischen Wasserschierlings umgebracht? Im alten Ägypten tötete man Delinquenten, indem man ihnen einen Extrakt aus Aprikosenkernen zu trinken gab. Wem fiel beim Anblick eines blühenden Oleanders ein, dass diese Pflanze in anderen Ländern Pferdetod hieß? Bei Rizinus kam noch etwas hinzu, es war eine Nutzpflanze, die großflächig zur Ölgewinnung angebaut wurde.
Als Schneider die Rizinussamen in der Hand hielt, kamen sie ihm bekannt vor. Wie vollgesogene Zecken sahen sie aus, auffällig hell und dunkel gescheckt. An Halsketten, die als Hippieschmuck auf Flohmärkten in Amsterdam verkauft wurden, hatte er sie vor vielen Jahren gesehen.
Jetzt hatte er das Rohmaterial und es gab keine Ausrede mehr, nicht mit der praktischen Arbeit anzufangen. Zumal Bea schon fragte, wann die Rizinpräparationen fertig wären. Sie hatte inzwischen Rizin über den Laborfachhandel bezogen. Eine winzige Menge hoch gereinigtes Rizin, laut Etikett in einem mit der EU eng assoziierten Land hergestellt und über Chemikalienfirmen in Deutschland vertrieben. Teurer Stoff, aber sie brauchten ihn, um die Qualität des aus den Samen präparierten Rizins zu prüfen.
Schneider bearbeitete die Rizinussamen unter einer Sicherheitswerkbank, er musste vermeiden, dass ihm bei der Präparation das Gift ins Gesicht geblasen wurde. Unter der scheckigen Schale kamen weiße, wachsweiche Bohnen zutage, die sich leicht zu einem Brei zermalen ließen. Nach einer Weile setzte sich an der Oberfläche der Flüssigkeit eine Ölschicht ab. Es war Rizinusöl, der eigentliche Grund, warum man diese Pflanze großflächig kultivierte. Rizinusöl enthielt kein Rizin, aber unter der Ölschicht befand sich ein wässriger Extrakt, der das Rizin enthielt. Schneider passierte ihn durch einen Filter, der so feine Poren hatte, dass er keine Mikroorganismen durchließ. Auf diese Weise hatte er ein keimfreies Präparat. Das war notwendig, sonst würde der Extrakt von Bakterien, für die Rizin nicht schädlich war, schnell zersetzt werden.
Leo Schneider hatte lange überlegt, wie er den Extrakt auf seine giftige Wirkung prüfen konnte. Für die Bakterientoxine hatte er Zellkulturen benutzt. Zellkulturen simulierten den lebenden Organismus. Es waren Körperzellen, die ursprünglich aus Organen von Menschen isoliert worden waren und in Kulturflaschen im Labor weiter gezüchtet wurden. Im Gegensatz zum lebenden Organismus waren diese Zellen im gewissen Sinn unsterblich, denn sie vermehrten sich solange, wie man sie im Labor wachsen ließ. Es gab eine Zelllinie mit dem Namen HeLa, benannt nach den Initialen einer Frau, die vor fünfzig Jahren an Krebs gestorben war. Einige ihrer Krebszellen hatte man isoliert und bemerkt, dass sie in Nährlösung wuchsen, solange man sie regelmäßig mit Nährstoffen versorgte und ihre Ausscheidungen entfernte.
Schneider nahm eine Ampulle mit HeLa Zellen aus dem Kühltank, wo sie bei -170 °C in flüssigem Stickstoff aufbewahrt wurden. Er taute sie auf und gab sie in eine Nährlösung. Dabei fiel ihm ein, dass die Zellen von einer Frau stammten, von der seit Jahrzehnten nichts mehr übrig war. Nichts, bis auf einen Teil, der jetzt vor ihm lag und immer noch lebendig war. HeLa Zellen hatten alles, was das Leben grundsätzlich ausmachte. Sie ernährten, schieden aus und vermehrten sich. Natürlich würde aus ihnen nie wieder ein Mensch entstehen, aber wo begann das Leben eigentlich? War nicht ein Teil des Wunders, das einst zu dieser Frau gehörte, in den Zellen verblieben?
Als er nach drei Tagen genug HeLa Zellen in den Kulturschälchen vermehrt hatte, versetzte er sie mit Verdünnungen seiner Rizin Extrakte und beobachtete die Wirkung im Lichtmikroskop. Schon vierundzwanzig Stunden später sah er, was das Rizin angerichtet hatte. Je konzentrierter die Extrakte waren, desto stärker waren die HeLa Zellen zerstört. Schneider musste seine Präparate zehntausendfach verdünnen, um an den Punkt zu kommen, wo keine Giftwirkung mehr zu beobachten war.
Durch diese Versuche konnte er die Menge des Rizins bestimmen. Als er genug Extrakte hergestellt hatte, trennte Schneider das Rizin von allen anderen Stoffen und machte es durch eine spezielle Färbung sichtbar. Mit dem gereinigten Rizin konnte er Antikörper herzustellen. Um Antikörper herzustellen, musste er Tiere gegen Rizin immunisieren. Der Organismus der Tiere würde das Rizin als körperfremd erkennen, und als Reaktion darauf die entsprechenden Antikörper produzieren. Antikörper hatten die Eigenschaft, sich mit dem fremden Stoff zu verbinden und seine giftige Wirkung dadurch zu verhindern. Genau solche Antikörper brauchten sie für die Nachweisverfahren, die in der AG-Toxine entwickelt werden sollten.
Zur gleichen Zeit, als Schneider an diesen Versuchen arbeitete, traf sich in einem Konferenzraum des IEI ein nicht öffentlicher Zirkel. Die Mitglieder dieses Kreises setzten sich aus Ministerialbeamten und hochrangigen Vertretern aus Polizei und Militär zusammen. Als Experten aus dem IEI waren die Professoren Griebsch und Hellman eingeladen. Der Zweck dieser Zusammenkunft lag in der Ausarbeitung von Planspielen zu möglichen bioterroristischen Anschlägen. Genau genommen ging es um Maßnahmen zur Erkennung und Abwehr schon im Vorfeld möglicher Attentate. Allerdings hatte kaum einer der Teilnehmer entsprechende Kenntnisse, die meisten von ihnen waren Juristen und Verwaltungsbeamte. In endlosen Diskussionen vermischten sich Fantasie und Wirklichkeit zu skurrilen Szenarien, die am Ende zu Papier mit dem Vermerk „Geheim! Nur für den Dienstgebrauch!“ gebracht wurden.
Natürlich wusste niemand von ihnen, ob und welche biologischen Waffen die Terroristen einsetzen würden. Auch nicht wo noch in welcher Weise. So tappte man in den Gefilden der eigenen Fantasie herum und kam sich dabei sehr bedeutend vor. Es hieß, das Pentagon hätte Drehbuchautoren aus Hollywood beauftragt, sich Szenarien zu bioterroristischen Angriffen zu erdenken. Offenbar traute man diesen Leuten in Washington mehr Realitätssinn zu, als den Staatsbeamten und sogenannten Experten. Mit der kreativen Unterstützung von Cineasten hoffte man, auf zukünftige Bedrohungen besser vorbereitet zu sein.
In Deutschland erwartete man entsprechend kreative Ideen von den Professoren Hellman und Griebsch. Es mangelte den beiden auch nicht an Ideen und mit der inhaltlichen Gestaltung sollten sich dann die ihnen unterstellten Wissenschaftler beschäftigen. Wozu hatte man denn die ganze Belegschaft des IEI durch die Sicherheitsüberprüfung checken lassen? So gelangte diese Aufgabe auch an Schneider. Schneider zweifelte, dass man Anschläge mit biologischen Waffen vorhersehen könnte. Dazu gab es einfach zu viel verschiedene Möglichkeiten. Terroristen hatten sich bisher auch nicht die Mühe gemacht, mit biologischen Waffen anzugreifen. Warum auch? Für so etwas brauchte man Fachleute, teure Geräte und Speziallaboratorien. Die täglichen Nachrichten zeigten, dass diese Leute sich mit Schusswaffen und Sprengstoff vollauf begnügten. Beides stand ihnen doch unbegrenzt zur Verfügung. Woher die Waffen kamen, darüber sprach man selten. Wahrscheinlich, weil sie in den Ländern gefertigt wurden, die sich im Krieg mit den Terroristen befanden.
Solche Gedanken spielten in den Planungen des Zirkels jedoch keine Rolle. Hellmans Idee war, dass Terroristen Wasserspender mit Botulinumtoxin vergiften könnten. Daraus ergaben sich viele Fragen. Wie lange würde das Gift im Wasser stabil bleiben? Wie viel musste man hineinschütten, damit ein Schluck tödlich war? Wie viele würden daran sterben, bevor man wüsste, woher die Bedrohung kam? Dergleichen Planspiele gab es in Hülle und Fülle. Griebsch entwickelte ähnliche Ideen zu Rizin. Auch dazu gab es natürlich viele Fragen.
Schneider bekam diese geistigen Ergüsse auf seinen Schreibtisch und sollte sie mit Zahlen wissenschaftlich untermauern. Er empfand diese Vorstellungen gleichermaßen krank wie sinnlos. Natürlich war alles denkbar, aber das wirkliche Leben bot mehr Möglichkeiten, als die Papierwelten dieser Männer zuließen. Andere Kollegen aus dem IEI zeigten mehr Engagement und arbeiteten fleißig an ihren Hausaufgaben. Natürlich alles „Geheim, nur für den Dienstgebrauch.“ Wer diese Schriftstücke alles zu Gesicht bekam, wusste niemand. Vielleicht waren darunter Leute, die man damit erst auf entsprechende Ideen brachte? Gerade solche Leute stellten das größte Risiko dar. Geltungssüchtige Menschen wie Hellman, dem der Kamm schwoll, als ihn ein General als Biowaffenexperten titulierte. Eitle Gecken wie Krantz, die darauf warteten, durch einen Anschlag oder eine Seuche in ihren düsteren Orakeln bestätigt zu werden. Simpel gestrickte Angeber wie Griebsch, die hofften, im Fahrwasser einer großen Aktion einmal als Held ins Licht der Öffentlichkeit zu gelangen.
Es gab andere, die auch so dachten wie Schneider. Einer von ihnen war ein bekannter Experte, der manchmal auch im Fernsehen auftrat. Die Zahl der Wissenschaftler in der Biowaffenforschung war seiner Meinung nach schon viel zu groß. Das Risiko für Anschläge würde dadurch nur steigen. Ein Biologe, der sein Wissen für kriminelle Ziele einsetzen wollte, wäre gefährlicher ein Terrorist, der nichts von Biologie verstand. War nicht ein Laborant aus Fort Detrick verdächtigt, der Absender der Anthrax Briefe gewesen zu sein? Man konnte ihn nicht mehr fragen, denn er hatte, nach dem offiziellen Bericht, vor seiner Verhaftung seinem Leben ein Ende gesetzt.
Am IEI war es mittlerweile riskant, solche Ansichten offen auszusprechen. Es gab überall Leute, die für Nachrichtendienste arbeiteten. Man wusste nicht wer, aber die Frau eines Kollegen, die als Sekretärin beim BND angestellt war, hatte erzählt, in allen größeren Betrieben wären V-Leute beschäftigt. Die sollten einschätzen, wer ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellte. Ketzerische Gedanken, wie Schneider sie hatte, gehörten schon dazu.
Eigentlich hatte das Beispiel der DDR doch gezeigt, dass die Bespitzelung der Menschen dem Staat nichts erbrachte. Bis 1989 hatte man 180 km Akten in der Stasizentrale gesammelt, war aber nicht in der Lage gewesen, den eigenen Untergang vorauszusehen. Solche Gedanken ließen Schneider kopfschüttelnd zurück, als er über den Zirkel, die BIGA und die ganzen Szenarien, die dort kursierten, nachdachte. Natürlich alles „Geheim, nur für den Dienstgebrauch!“