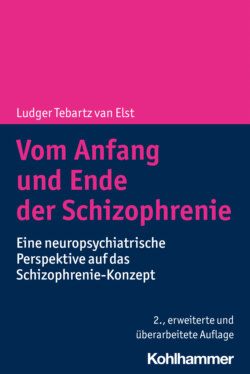Читать книгу Vom Anfang und Ende der Schizophrenie - Ludger Tebartz van Elst - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was bedeuten die Begriffe Theory of Mind, Mentalisierung, kognitive Empathie, soziale Empathie und Mitleid?
ОглавлениеDiese Begriffe spielen nicht nur im Zusammenhang mit schizophrenen Syndromen eine große Rolle, sondern sie gehören auch zu den Kernsymptomen eines autistischen Syndroms. Im Unterschied zu den Autismus-Spektrum-Störungen bestehen aber im Zusammenhang mit schizophrenen Störungen Probleme mit der kognitiven Empathie zwar häufig, aber nicht immer. Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass sie beim Autismus seit der frühen Kindheit kontinuierlich vorhanden sind, während sie sich bei schizophrenen Syndromen erst später im Leben entwickeln und auch dann nur so lange vorhanden sind, so lange auch die übrige schizophrene Symptomatik besteht. Was aber bedeuten nun die verschiedenen Begriffe genau?
Theory of Mind: Das Konzept der Theory of Mind Fähigkeit geht auf die Autoren Premack und Woodruff (1978) zurück. Es beschreibt die Fähigkeit von Menschen, aber auch von Tieren, plausible Theorien über die mentalen Zustände anderer Lebewesen zu entwickeln. Dazu müssen durch Verhaltensbeobachtungen und mithilfe von Wissen und Analogieschlüssen Annahmen darüber entwickelt werden, was der andere Mensch denkt und will. Diese Fähigkeit entwickelt sich bei Menschen meist im vierten oder fünften Lebensjahr und beinhaltet notwendig die Fähigkeit, zwischen dem eigenen Denken und dem anderer Lebewesen zu unterscheiden. Gelegentlich wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff »Perspektivübernahme« benutzt.
Mentalisierung: Dieser Begriff wurde wesentlich von dem britischen Wissenschaftler Fonagy geprägt und meint inhaltlich die fast identische Fähigkeit von Menschen, die kognitiven und intentionalen (zielgerichteten) Zustände anderer Menschen, aber auch von sich selbst, durch Zuschreibung bestimmter mentaler Eigenschaften zu interpretieren (Fonagy et al. 2002). Der Begriff bewegt sich aber mehr in einer psychoanalytischen Denktradition. Es wird nicht so sehr davon ausgegangen, dass sich diese Fähigkeit als natürlicher Prozess der Hirnreifung von alleine etwa im Alter von vier bis fünf Jahren herausbildet, sondern dass er ganz wesentlich in der sozialen Interaktion von Kindern mit ihren Bezugspersonen erlernt wird. Die theoretische Einbettung des Begriffs ist also wesentlich weiter und im Kontext der psychoanalytischen Tradition der Entwicklung des »Selbst« zu sehen, während der Theory of Mind-Begriff deskriptiver und theorieärmer konstruiert wurde.
Kognitive Empathie: Der Begriff Empathie leitet sich von dem griechischen Wort »empatheia«: Leidenschaft (»en« = ein, »patheia« = Gefühl) ab und wird auch in der Populärwissenschaft und den Medien sehr breit und mit unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht. Entscheidend für die heutige Bedeutung des Empathie-Begriffs waren die Arbeiten des Psychologen und Philosophen Theodor Lipps (1851–1914) (Montag et al. 2008). Lipps verstand unter Empathie die Fähigkeit von Menschen, die mentalen Zustände anderer zu verstehen (Einfühlung). Er vertrat die Theorie einer »inneren Imitation«, um Erkenntnisse über die mentalen Zustände anderer zu erklären (Lipps 1903).
Der heutige Begriff »kognitive Empathie« meint im Wesentlichen dasselbe wie der Begriff Theory of Mind, also die Fähigkeit, aufgrund einer komplexen Informationsverarbeitung spontan die Wahrnehmung, das Denken, Fühlen und Wollen anderer Menschen zu erschließen. Der Begriff emotionale oder affektive Empathie bezeichnet dagegen das, was in der Alltagssprache als Mitleid verstanden wird. Kognitive und emotionale Empathie sollten nicht verwechselt werden. Zwar muss man zum Beispiel dazu in der Lage sein, ein trauriges Gesicht als traurig zu erkennen (kognitive Empathie), um dann in einem zweiten Schritt Mitleid für diesen Menschen zu entwickeln (emotionale Empathie). Beide Teilleistungen sind aber nicht identisch. So haben etwa autistische Menschen typischerweise Probleme mit der kognitiven Empathie oder der Theory of Mind, sprich sie erkennen z. B. emotionale Gesichtsausdrücke nicht adäquat als traurig oder gequält. In der Folge kann es geschehen, dass sie kein Mitleid für solche Menschen entwickeln, weil sie den Affekt erst gar nicht erkannt haben. Wenn sie ihn aber erkennen, dann entwickeln sie auch Mitleid (Dziobek et al. 2008). Inwieweit dies bei Menschen mit schizophrenen Syndromen ähnlich gelagert ist, ist bislang noch nicht abschließend erforscht. Menschen mit soziopathischer Persönlichkeitsstörung dagegen erkennen zwar die emotionalen Gesichtsausdrücke (kognitive Empathie intakt), entwickeln jedoch kein Mitleid (emotionale Empathie gestört).