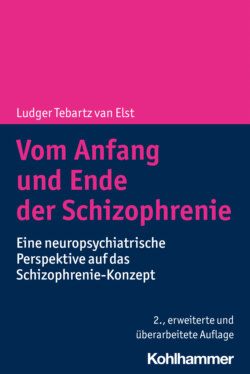Читать книгу Vom Anfang und Ende der Schizophrenie - Ludger Tebartz van Elst - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Was sind psychotische Symptome?
ОглавлениеIm ersten inhaltlichen Kapitel dieses Buches sollten die Symptome und Verläufe beschrieben und veranschaulicht werden, unter denen Menschen häufig leiden, die aktuell eine Schizophreniediagnose bekommen. Zum Abschluss dieses Kapitels muss noch der in der medizinischen Wissenschaft ebenso wie in der Laienpresse gängige Begriff der Psychose bzw. adjektivisch ausgedrückt, der psychotischen Symptome geklärt werden.
Der Begriff »Psychose« bzw. »psychotisches Symptom« ist ebenso populär wie häufig vage und unscharf definiert. Lange Zeit wurde er als Gegenbegriff zum Konzept der Neurose gewählt. In dieser Polarität meinte eine Psychose ein hirnorganisch verursachtes, psychisches Syndrom, während der Begriff Neurose aus der psychoanalytischen Tradition stammend für ein erlebnisreaktiv verursachtes Symptom oder Syndrom stand. Dies verdeutlicht, dass es sich bei den Begriffen Psychose und Neurose – so verstanden – um ätiologische Begriffe handelt, d. h. um Begriffe, die auf die erkannten oder angenommenen Ursachen psychischer Symptome Bezug nehmen.
Es existieren daneben und vermischt mit diesem kausalen Definitionsprinzip des Psychosebegriffs, aber auch noch nominale, dimensionale und funktionale Definitionen ( Tab. 2.7).
Nach der dimensionalen Definition von Psychosen handelt es sich dabei um besonders schwer ausgeprägte psychische Symptome. Dieses Konzept ist verknüpft mit der funktionalen Psychosedefinition, nach der bei einer Psychose der Wirklichkeitsbezug in Form der Einsichts-, Kritik- und Urteilsfähigkeit sowie die Steuerungsfähigkeit betroffen sind. Nach der nominalen Definition sind psychotische Symptome weitgehend gleichzusetzen mit den produktiven Symptomen (Positivsymptomen) einer schizophrenen Störung.
All diese verschiedenen Definitionsansätze des Psychosebegriffs sind praktisch in der klinischen Wirklichkeit auch insofern miteinander verbunden, als dass die klar oder zumindest sehr wahrscheinlich hirnorganisch bedingten psychischen Störungen oft mit produktiven Symptomen einhergehen, oft schwer ausgeprägt sind und oft mit einer eingeschränkten Kritik- und Steuerungsfähigkeit verbunden sind. Im Einzelfall sind die entsprechenden Definitionsversuche aber alle nicht trennscharf. So können Halluzinationen auch leicht ausgeprägt sein. Die Urteils- und Kritikfähigkeit der Betroffenen kann dann kaum oder gar nicht beeinträchtigt sein. Sie können auch abhängig von psychoreaktiven Stresserleben auftreten wie z. B. nicht selten bei autistischen Menschen und wären dann nach den hier aufgeführten inhaltlichen Kriterien am ehesten als neurotisch zu begreifen.
Im Hinblick auf den Neurosebegriff ist an dieser Stelle aber zu betonen, dass er praktisch sehr eng mit psychoanalytischen Denktraditionen und Erklärungsmodellen verknüpft ist. In der psychoanalytischen Tradition wird das neurotische Symptom als Ausdruck einer nicht gelungenen, innerpsychischen Konfliktlösung zwischen den drei Instanzen des analytischen Strukturmodells der Persönlichkeit (Ich, Es, Über-Ich) gesehen bzw. als Reaktivierung nicht gelöster kindlicher Konflikte (Hoffmann und Holzapfel 1991). Im Zuge der schwindenden Bedeutung psychoanalytischen Denkens in der modernen Psychiatrie und Psychotherapie wird der Neurosebegriff im klinischen Alltag daher kaum noch gebraucht.
Tab. 2.7: Die verschiedenen Bedeutungen der Begriffe Psychose und Neurose
DefinitionsprinzipNeurosePsychose
Anders verhält es sich mit dem Psychosebegriff, der trotz seiner Bedeutungsvielfalt, unscharfen Abgrenzung und mangelnden Operationalisierung weit verbreitet ist und viel genutzt wird. Historisch wurde im DSM-3 der noch im DSM-2 zentral verwendete Psychosebegriff zugunsten des Störungsbegriffs aufgegeben (Peters 2011a). Dies war Folge der Grundsatzentscheidung bei der Klassifikation psychischer Störungen auf kausal-ätiologische Aspekte zugunsten rein deskriptiver Einteilungsprinzipien zu verzichten (Zurückweisung des kausal-ätiologischen Definitionsprinzips des Psychosebegriffs). Gleichzeitig wurde der adjektivische Gebrauch des Begriffs deutlich ausgeweitet (z. B. Depression mit psychotischen Symptomen), ohne dass jedoch eine klare begrifflich konzeptionelle Klärung des Psychosebegriffs vorgenommen worden wäre. Die Analyse des Sprachgebrauchs zeigt aber, dass die ab DSM-III gemeinte Definition des Psychotischen vor allem auf die dimensionale, nominale und funktionale Bedeutung abhebt. Das heißt, mit psychotischen Symptomen sind vor allem Halluzinationen, Wahn, Denkzerfahrenheit und katatone Symptome gemeint, die schwer und dazu angetan sind, die Kritik- und Steuerungsfähigkeit der Betroffenen zu beeinträchtigen.
Der Begriff Psychose hat verschiedene Bedeutungen. In seiner im Alltag am häufigsten gemeinten Form bezeichnet er Halluzinationen, Wahn, Ich-Störungen und Denkzerfahrenheit, die oft mit einer Verminderung der Kritik- und Steuerungsfähigkeit einhergehen.
1 Wenn im Folgenden von Lesern, Patienten, Ärzten o. ä. die Rede ist, sind immer Leserinnen und Leser, Patientinnen und Patienten usw. gemeint. Um den Lesefluss des Textes aber nicht zu stören, wird der Einfachheit halber nur der Begriff Leser, Patient usw. gewählt werden.
2 http://www.psy-luxeuil.fr/article-schizophrenie-la-grande-insaisissable-116865765.html
3 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1683919430; Zugriff am 28.05.2021. (Übersetzung durch den Autor)
4 In deutschen und europäischen Sprachraum wird meist die ICD und nicht das DSM als Referenzsystem genutzt.
5 Diese Konzeption vom Ich entspricht weitgehend der Begriffsdefinition des »Subjekt« in früheren Textes (Tebartz van Elst 2003, S. 155). Hier soll aber beim Begriff des Ichs geblieben werden, um den Gedankengang nicht zu verkomplizieren.
6 Dieser Kasten wurde weitgehend einer anderen Buchpublikation des Autors entnommen (Tebartz van Elst 2018)