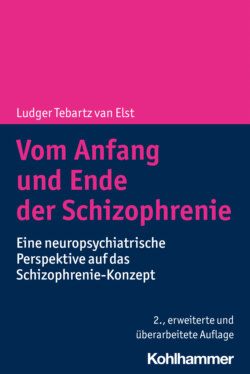Читать книгу Vom Anfang und Ende der Schizophrenie - Ludger Tebartz van Elst - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Ich und sein Selbst: Was bedeuten die Begriffe?
ОглавлениеWenn in diesem Kapitel die Auffälligkeiten des Selbst-Erlebens veranschaulicht werden sollen, muss geklärt werden, was das überhaupt sein soll, das Selbst und in welchem Bezug dieser Begriff zu einem weiteren eng verwandten Begriff, dem Ich, steht.
In der Tradition der deutschen Psychopathologie bedeutet »Ich« all das, was dem eigenen psychischen Raum als zugehörig zugeordnet wird (Peters 2011a). Beispiele wären die Wahrnehmungen, die als eigene Wahrnehmungen erlebt werden, die Gedanken, die als eigene Gedanken erlebt werden, und die Gefühle, die als eigene Gefühle erlebt werden. Davon abgegrenzt gibt es natürlich auch Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken anderer. Diese werden aber von den meisten Menschen als fremd und nicht der eigenen Person zugehörig bewertet. In der Tradition dieses Denkens ist auch der oben aufgeführte Begriff der Ich-Störungen zu verstehen, bei denen es etwa zu dem Gefühl kommt, das eigene Wahrnehmen, Fühlen und Denken werde von außen manipuliert.
Im psychoanalytischen Strukturmodell der Psyche nach Freud steht das Ich für das Realitätsprinzip des Alltagsbewusstseins. Es wird abgegrenzt gegen das Es, welches den Trieb- und Lustbereich repräsentiert, und das Über-Ich, welches als verinnerlichte moralische Instanz gedacht wird, die Wert- und Normvorstellungen repräsentiert und damit oft in einen Konflikt zum Es gerät. Das Ich muss diese widerstrebenden Impulse in einem alltäglichen situativen Prozess an die Wirklichkeiten der Gegenwart anpassen, austarieren und ökologisch angepasste Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen generieren. Auch im psychoanalytischen Denken repräsentiert das Ich einen komplexen psychobiologischen Apparat, der am ehesten mit dem psychobiologischen Bewusstseinssystem gleichgesetzt werden kann. Hier müssen die situativen Wahrnehmungen und Emotionen, die triebhaften Impulse, die internalisierten Wert- und Normvorstellungen und die innere Homöostase (Hormonhaushalt, Stoffwechsellage etc.) so verarbeitet werden, dass situationsgerechte Ziele definiert, Verhaltensstrategien entwickelt und schlussendlich konkretes motorisches Verhalten organisiert werden kann. Eine genauere Differenzierung der verschiedenen psychobiologischen Teilleistungen dieses komplexen psychobiologischen Apparates, Ich, wurde dabei in der psychoanalytischen Tradition noch nicht entwickelt, was aus dem Stand der Wissenschaft der Zeit gut nachvollzogen werden kann.
Der Begriff Selbst repräsentiert verschiedene zum Teil recht unterschiedliche Bedeutungen je nach Autor. So beschreibt er bei Jung die Gesamtheit aller psychischen Eigenschaften eines Menschen (Peters 2011b). Andere Autoren wie Karen Horney meinen damit die Persönlichkeit eines Menschen. Autoren wie Otto Kernberg betrachten das Selbst als eine intrapsychische Struktur, die einen Teil des Ichs darstellt (Peters 2011b). In diesem Denken ist also das Selbst eine psychobiologische Struktur bzw. eine Erkenntnis (Tebartz van Elst 2003, S. 56), welche vom Ich hervorgebracht wird. Diese, in meinen Augen, überzeugende Konzeption passt auch gut zu der Art und Weise, wie in der Alltagssprache Begriffe wie Selbsterfahrung, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl etc. gebraucht werden. Denn all diese Begriffe verweisen auf eine Erkenntnisbildung im Hinblick auf den eigenen Körper. Das Ich kann dann verstanden werden als der psychobiologische Apparat, mit dem Erkenntnisse überhaupt gebildet werden, insbesondere in Form der bewussten Informationsverarbeitung.5 Insofern als dass sich diese Erkenntnisbildung nicht auf die Außenwelt, sondern auf das Funktionieren des eigenen Körpers bezieht, entstehen Selbsterfahrungen, die dann Grundlage für ein sich darauf aufbauendes Selbst-Bewusstsein und eines Selbstwertgefühls sind.
In dieser Konzeption der Begriffe beschreibt das Ich also den weitgehend neurobiologisch determinierten Apparat der bewussten Erkenntnisbildung, während das Selbst das inhaltliche Ergebnis dieser Erkenntnisbildung im Hinblick auf Eigenschaften, Stärken, Schwächen und die Werthaftigkeit des eigenen Körpers repräsentiert.
Im Folgenden soll, wie oben ( Kasten 2.1) entwickelt, der Begriff Ich für den weitgehend neurobiologisch bestimmten Apparat der bewussten Erkenntnisbildung stehen. Die psychobiologische Erkenntnisbildung ist aber keine Teilleistung, sondern eine neurokognitive Komplexleistung, die auf verschiedene andere Teilleistungen aufbaut. Um im Beispiel der oben beschriebenen Kasuistik ( Kasuistik 2) zu bleiben, braucht man viele neurokognitive Teilfähigkeiten, um die Situation mit dem Mann mit der Sonnenbrille angemessen zu bewerten. Eine kurze Analyse führt zu folgenden Teilleistungen:
• Vigilanz: Der Student muss wach genug sein, um die Situation richtig zu erfassen.
• Wahrnehmung: Der Student muss sehen, hören und riechen können, um die Situation adäquat zu beurteilen. Würde er etwa nicht riechen, dass der Sonnenbrillenträger stark nach Cannabis oder Alkohol riecht, würde ihm eine wichtige Information fehlen.
• Soziale Wahrnehmung: Der Student muss erkennen, wie der andere gestimmt ist. Würde er tottraurig ausschauen und noch Tränen in den Augen haben, so würde das die Sonnenbrille schon erklären.
• Aufmerksamkeit: Für alle geordneten bewussten kognitiven Prozesse braucht es Aufmerksamkeit, um die verschiedenen Quellen der Informationsverarbeitung angemessen zusammen zu führen und irrelevante Informationen wegzufiltern.
• Wissen: Der Student sollte wissen, ob die Tram gerade an einem Messe-Gelände vorbeifährt, wo ein Reggae-Konzert stattfindet, da dieses Wissen die Bewertung der Situation beeinflusst.
• Erinnerung: Der Student muss die verschiedenen relevanten Erinnerungen mit ähnlichen Konstellationen abrufen können, um überhaupt eine Orientierung im Umgang mit solchen Situationen zu haben. Erinnert er zig ähnliche Situationen ohne jede Auffälligkeit, so ist diese Erinnerung für die Einstufung der Situation als harmlos wichtig.
• Kognitive Emapthie/Theory of Mind: Der Student muss erkennen, was sein Gegenüber im Sinn hat. Hat er ein Tabakpäckchen in der Hand aus dem ein Joint herauslugt und er wippelt unruhig mit den Beinen, so kann er es vielleicht nicht abwarten, seinen nächsten Joint zu rauchen, was eine gewisse Unruhe erklären würde. Wird dies nicht erkannt, so kann er die psychomotorische Unruhe des anderen leicht auf sich beziehen und sich bedroht fühlen.
• Assoziationsfähigkeit/Urteilsfähigkeit/Pragmatik: Schließlich braucht unser Student die Fähigkeit der Assoziation. Das bedeutet, er muss die verschiedenen Informationsquellen situationsangemessen miteinander verknüpfen können und zu naheliegenden Urteilen kommen, um in solchen Situationen angemessen bestehen zu können.
All diese genannten neurokognitiven Teilleistungen werden von dem Begriff des Ichs zusammengefasst. Diese Analyse soll illustrieren, dass das Ich bei genauer Betrachtung nicht etwas Einheitliches, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene psychobiologische Leistungen eines Menschen ist, die allesamt mehr oder weniger gut und leistungsstark ausgeprägt sein können. Der Begriff der Ich-Störungen beschreibt Auffälligkeiten im Ergebnis des komplexen Gesamtprozesses, der das Ich hervorbringt.
Diese Analyse zeigt, dass die genaue Neurophysiologie, die sich hinter den sogenannten Ich-Störungen verbirgt, sehr vielgestaltig sein könnte. Bislang ist die genaue Pathophysiologie von Ich-Störungen unklar. In den Kognitionswissenschaften beschäftigen sich aber zahlreiche Wissenschaftler weltweit damit, diese Hirnfunktionen und Leistungen besser zu verstehen. Die Analyse veranschaulicht auch, dass dabei die genauen Funktionsstörungen durchaus nicht einheitlich sein müssen, sondern auf verschiedenen Ebenen der zentralnervösen Informationsverarbeitung liegen könnten. Zwar liegt es aus rein theoretischer Perspektive nahe, dass es vor allem die Psychobiologie der Assoziations- und Urteilsfähigkeit sein könnte, die bei den Ich-Störungen beeinträchtigt ist. Aber zum einen ist noch völlig unklar, was das aus der Perspektive des Gehirns genau ist. Und zum anderen ist es durchaus denkbar, dass auch frühere Prozesse der Informationsverarbeitung etwa auf Wahrnehmungsebene oder im Kontext der sozialen Intelligenz eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Ich-Störungen spielen könnten.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass, wenn im ICD-11 von Auffälligkeiten des Selbst-Erlebens die Rede ist (z. B. das Gefühl, dass eigene Gefühle, Impulse, Gedanken, oder das Verhalten unter Kontrolle einer äußeren Macht stehen), damit inhaltlich das gemeint ist, was in der deutschen Tradition Ich-Störung genannt wird. Damit wird das komplexe Zusammenspiel verschiedener zentralnervöser Informationsverarbeitungsprozesse angesprochen, welches dazu führt, das Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle als die eigenen erlebt werden und eben nicht als fremde Gedanken oder die von anderen Menschen oder Wesen.
Mit den Auffälligkeiten des Selbst-Erlebens, auch Ich-Störungen genannt, ist das Gefühl gemeint, dass das eigene Wahrnehmen, Fühlen oder Denken von außen manipuliert wird.