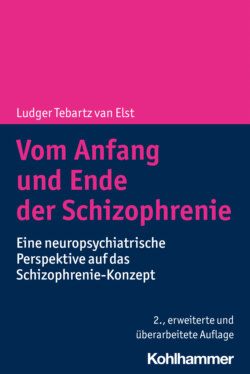Читать книгу Vom Anfang und Ende der Schizophrenie - Ludger Tebartz van Elst - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort zur 1. Auflage
ОглавлениеDie Psychiatrie ist und bleibt in meinen Augen eine besondere Disziplin innerhalb der medizinischen Fächer. Sie steht wie keine andere ihrer Schwesterdisziplinen an einer Grenze zwischen Natur- und Geisteswissenschaft, zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen Normalität, Abweichung und Ausgrenzung, zwischen erlebnisreaktiven Stressreaktionen und organischer Fehlsteuerung. Und die Tatsache, dass ein und dasselbe psychische Symptom sowohl Folge normaler, weil situationsbedingt durchschnittlicher, hirnphysiologicher Prozesse, sein kann als auch Ausdruck der teuflischten Erkrankungen, die Pandora mit der Hoffnung auf Heilung in ihrer Büchse auf die Welt brachte, ist Horror und Faszinosum in einem.
Und innerhalb der Psychiatrie spielt die Schizophrenie nach wie vor eine Sonderrolle. Ich kann mich gut erinnern, wie dieser Begriff der Alltagssprache, den auch ich als Schüler, Student und junger Arzt lange Zeit als klassische Krankheit missverstand, mich schon in meiner Jugend geängstigt hat als schweres Schicksal für Betroffene und Angehörige, gleichzeitig aber auch auf eine schwer zu beschreibende Art und Weise fasziniert hat, als mystisch-sakrale Form des Existierens, als das ganz und gar fundamental Andere im Wahrnehmen, Erleben, Fühlen und Denken, dem trotz seines Anders-Seins immer auch etwas Exotisches und Neues, Unentdecktes und abenteuerlich Spannendes innewohnen kann. Diese sakral-verborgene Vorstellung von Schizophrenie halte ich heute, einige Dekaden später, aus poetischer Perspektive zwar nach wie vor für inspirierend und attraktiv, aus meiner inzwischen entwickelten, ärztlich-wissenschaftlichen Sicht aber für einen entscheidenden Nachteil des Schizophrenie-Konzepts.
Als Student und junger Arzt meinte ich eine Weile lang, die Krankheit Schizophrenie verstanden zu haben. Die Definition über die scheinbar doch klaren Positivsymptome Halluzinationen, Wahn, Denkzerfahrenheit und Katatonie überzeugte mich in der Auffassung, die Schizophrenie sei die Krankheit, die zu eben diesen Symptomen führe. Aber wie so oft in der Medizin und insbesondere in der psychiatrischen Medizin machte die Zunahme von Wissen und Erfahrung den wissenschaftlichen Blick auf diese Erkrankung nicht klarer. Vielmehr fiel es mir immer schwerer, die vielen Einzelfälle mit ihren Gemeinsamkeiten aber auch weitreichenden Unterschieden in Symptomatik, Ursächlichkeit, Verlauf, Therapieergebnis und Prognose auf für mich überzeugende Art und Weise unter dem zumindest alltagssprachlich einheitlich daherkommenden Schizophrenie-Konzept zu fassen.
Dieses Buch ist das Ergebnis meines ganz persönlichen Ringens mit dem Phänomen Schizophrenie als Mensch, der anderen Menschen mit manchmal ganz alltäglichen und manchmal sehr ungewöhnlichen Wahrnehmungen, Denkstilen und Verhaltensweisen begegnet, die man heutzutage Schizophrenie nennt, als Arzt, der versucht in solchen Fällen die richtigen Untersuchungen zu veranlassen und die besten Therapien zu finden, und als Wissenschaftler, der versucht, die Ursächlichkeit dieser Phänomene zu verstehen. Das Buch fasst meine Sichtweise und mein Denken zum Thema Schizophrenie umfassend zusammen. Ich kann mir dabei durchaus vorstellen, dass sich hier in den weiteren Dekaden noch zahlreiche Änderungen ergeben. Denn entgegen dem, wie auch ich finde, zutreffenden Eindruck, dass sich in den letzten Dekaden wenig getan hat in der Diagnostik und Therapie der Schizophrenien, meine ich zu erkennen, dass sich in den letzten Jahren doch erhebliche Fortschritte zumindest für einige Untergruppen von Menschen abzeichnen, denen man heute noch vielerorts, sicher aber vor 10–20 Jahren ohne große Zweifel die Diagnose Schizophrenie gegeben hätte.
Dieses Buch verdankt viele Erkenntnisse jahrelangen sehr engagierten und manchmal auch sehr kontroversen Diskussionen mit Freunden und Kollegen in der Ambulanz, am Mittagstisch und an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Freiburg, aber auch an anderen Orten wie dem Institute of Neurology in London. All meinen Freunden, Förderern und Diskutanten möchte ich an dieser Stelle herzlich danken, auch wenn sie sicher nicht in allen Einzelheiten immer meine Sichtweise teilen werden wie ich weiß. Danken möchte ich vor allem aber all meinen Patientinnen und Patienten, die sich und ihr Erleben offenbarten und mir damit einen Einblick in die Vielfalt der Erlebens-, Fühlens- und Denkweisen menschlicher Existenz erlaubten.
Das Schicksal, sein Leben zeitweise oder auch langfristig mit schizophrenen Symptomen leben zu müssen, ist nicht immer schlimm, häufig ist es aber extrem belastend und für manche Menschen und ihre Angehörigen kaum zu ertragen. Dabei ist es nach meiner Wahrnehmung für fast alle von ganz zentraler Bedeutung, wie man die Besonderheiten des eigenen Erlebens deutet und interpretiert. Und so verbringe ich immer wieder viel Zeit damit, meinen Patientinnen und Patienten, aber auch ihren Angehörigen einen möglichst nüchternen und wissenschaftlichen Blick auf das Geschehen zu eröffnen. Da ich glaube, dass nicht nur der Schizophrenie-Begriff, sondern auch das zugrunde liegende Schizophrenie-Konzept in 100 Jahren nicht mehr in Gebrauch sein werden – und ich das auch gut fände –, unterscheidet sich das, was ich meinen Patienten und ihren Angehörigen erzähle, in einigen Punkten doch grundlegend von dem, was in den allgemeinen Büchern zur Psychoedukation der Schizophrenie zu lesen ist.
Gleichzeitig halte ich es nicht für klug, Menschen, die schizophrene Symptome erleben, im Gespräch und in der ärztlichen Diagnose nicht mit dem Schizophrenie-Begriff zu konfrontieren. Dies geschieht gelegentlich bei Ärzten, die befürchten, ihre Patienten oder deren Angehörige mit diesem so stigmatisierten Begriff zu verschrecken. Ich halte wenig davon, denn, wenn Menschen dialogisierende oder kommentierende Stimmen halluzinieren, so wissen sie und ihre Angehörigen ohnehin, dass die Schizophrenie im Raum steht. Dann hilft ein diesbezügliches ausklammerndes Schweigen meiner Meinung nach nicht weiter. Wohl aber möchte ich Ihnen erklären, wieso ich diesen Begriff nicht für hilfreich halte, und dass die Schizophrenie streng genommen auch schon im heutigen Denken keine Krankheit ist.
Dabei erzähle ich immer wieder ähnliche Dinge. Auch dies war eine Motivation für mich, dieses Buch zu schreiben. So können Patienten und ihre Angehörigen meine Überlegungen in Ruhe nachlesen und ich muss nicht immer wieder das gleiche erzählen.
Ich möchte mich in diesem Buch aber nicht nur an Patienten und ihre Angehörigen, sondern auch an Ärzte, Wissenschaftler, Fachärzte, Therapeuten und die interessierte Laienöffentlichkeit wenden. Das gesellschaftliche Interesse an dem Thema ist in meinen Augen gerade wegen der Sonderrolle der Psychiatrie in der Medizin und der Schizophrenie in der Psychiatrie groß. Damit versucht das Buch den Spagat, sich an ein medizinisches Fachpublikum zu wenden und gleichzeitig Ärzte, Wissenschaftler, Therapeuten, Betroffene, Angehörige und medizinische Laien anzusprechen. Dies ist natürlich im Hinblick auf die gewählte Sprache ein gewagtes Unterfangen. Und so wird es sicher so sein, dass ich nach dem Geschmack vieler zu sehr in der Fachsprache schreibe und andere sich an anderen Stellen über alltagssprachliche Formulierungen wundern. Ich möchte um Verständnis dafür werben, dass dieser Spagat nicht immer ganz leicht ist und an vielen Stellen sicher nicht optimal gelungen ist. Da nicht durchgängig auf medizinische Fachbegriffe verzichtet werden konnte, werden diese in einem Glossar und Abkürzungsverzeichnis erklärend aufgelistet.
Dieses Buch ist im Ergebnis länger geworden als ursprünglich vorgesehen. Dies liegt daran, dass die Thematik sehr grundsätzlich und umfassend entwickelt wurde. Es liegt sicher auch an den vielen Tabellen, Abbildungen, Kasuistiken und Überlegungen zu weitergehenden Themen am Rande. Die einzelnen Kapitel bauen zwar systematisch aufeinander auf, sie sind aber so gestaltet, dass sie auch jeweils für sich gelesen werden können, ohne dass das Buch systematisch von vorne bis hinten durchgearbeitet werden muss. Dies soll es angesichts der Länge des Textes Leserinnen und Lesern ermöglichen, sich in einer freien halben Stunde auch nur mit Teilaspekten der übergeordneten Thematik auseinanderzusetzen. Auch können Kapitel, die grundsätzliche und theoretische Fragestellungen betreffen, wie etwa eher philosophische Fragen nach dem Wesen des Normalen, Gesunden und Kranken oder nach der Definition von Krankheiten und Störungen in der Psychiatrie, ganz weggelassen werden, ohne dass dies die Verständlichkeit späterer Kapitel zu den Ursachen schizophrener Symptome beinträchtigen würde. Ich möchte dem Verlag und insbesondere meinen beiden unmittelbaren Ansprechpartnern, Frau Dr. Boll und Herrn Dr. Poensgen ausdrücklich dafür danken, dass sie mir diese Freiheit bei der Gestaltung des Textes gaben und dieses Projekt jederzeit wohlwollend unterstützt haben.
Ich hoffe, mit diesem Buch den mystisch-sakralen Dunstschleier, der die Schizophrenie in Fachkreisen wie in der Laienöffentlichkeit immer noch umgibt, ein wenig lichten zu können, eine Vorstellung von der Vielfalt psychischer Wirklichkeiten und ihrer Ursächlichkeiten zu vermitteln, und meine neuropsychiatrische Perspektive auf diese Vielfalt der geistigen Phänomene und Zusammenhänge zu veranschaulichen, die nach meiner Überzeugung in 100 Jahren nicht mehr Schizophrenie genannt werden. Wenn es in diesem Rahmen gelingen sollte, die Angst, das Unheimliche und die sakrale Bedrohung, die der Schizophrenie für viele innewohnt, ein wenig zu mildern, so würde mich dies freuen.
Ludger Tebartz van Elst
Freiburg, im März 2017