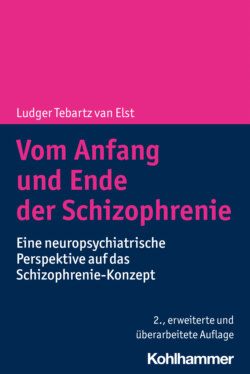Читать книгу Vom Anfang und Ende der Schizophrenie - Ludger Tebartz van Elst - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhaltliche Denkstörungen (DSM-5 Kriterium A.1: Wahn)
ОглавлениеIn der klassischen psychopathologischen Tradition werden bei den inhaltlichen Denkstörungen nicht-wahnhafte und wahnhafte Denkstörungen unterschieden.
Zu den nicht-wahnhaften Denkstörungen gehören Zwang, Hypochondrie, Phobien und überwertige Ideen ( Tab. 2.3, Stieglitz und Freyberger 2015; Ebert 2016; Scharfetter 2010).
Tab. 2.3: Nicht-wahnhafte inhaltliche Denkstörungen (modifiziert nach Ebert 2016; Stieglitz und Feyberger 2015; Scharfetter 2010).
Psychopathologischer FachbegriffSpezifizierung des GemeintenBeispiel
Nicht-wahnhafte inhaltliche Denkstörungen können sowohl im Rahmen von psychischen Störungen wie Angst- oder Zwangserkrankungen auftauchen als auch Teilaspekt der normalen Varianz (Streubreite) psychischen Erlebens sein. So sind etwa überwertige Ideen vor allem in Konfliktkonstellationen sehr häufig zu beobachten. Zum Beispiel im Rahmen von Nachbarschaftskonflikten, aber auch in politischen Konflikten, kommt es immer wieder dazu, dass einzelne Konfliktteilnehmer von der anderen Seite in einem geradezu dämonischen Licht wahrgenommen und beschrieben werden, und das Denken so weitgehend auf die Konfliktthematik einengt, dass von überwertigen Ideen, auch bei ansonsten psychisch völlig unauffälligen Menschen, gesprochen werden kann.
Anders stellt sich die Situation beim sogenannten »Wahn« dar. Der Wahn ist gerade dadurch definiert, dass inhaltliche Überzeugungen bestehen, die einer vernünftigen objektiven Prüfung der Sachlage nicht standhalten. Wenn etwa ein Mensch der Überzeugung ist, ein Arzt, der ihn vor längerer Zeit operiert hatte, befände sich nun in seinem Gehörgang und würde ihm von dort ständig Kommentare im Hinblick auf sein Alltagsverhalten einflüstern, so kann bei nicht-betroffenen Personen schnell Einigkeit darüber erzielt werden, dass dieser Sachverhalt aus objektiver Perspektive nicht wirklich so sein kann. Die Überzeugung, dass der eigene Computer und alle eigenen Tätigkeiten von der amerikanischen NSA überwacht werden, ist dagegen für einen Außenstehenden erkennbar schwerer zu bewerten. Handelt es sich um einen Wahn oder könnte der Sachverhalt tatsächlich zutreffen?
Ein wichtiges analytisches Kriterium zur Beurteilung wahnhafter Phänomene ist die Frage nach dem Bezugspunkt des möglicherweise wahnhaften Denkens: handelt es sich um ein Gefühl oder ein Urteil? Etwa bei depressiven Menschen kann schnell das Gefühl aufkommen, an einer unheilbaren Krankheit zu leiden oder zu verarmen. Es kann in solchen Konstellationen ein subjektives Gewissheitsgefühl bestehen. Aber dennoch sind sich die Betroffenen darüber im Klaren, dass es sich um ein Gefühl und nicht um ein Urteil über einen objektiven Sachverhalt handelt. Anders würde sich die Situation dann darstellen, wenn ein Betroffener sich sicher wäre, dass Befunde über seinen unmittelbar bevorstehenden Tod vorlägen, die aber in einem Komplott von Ärzten, Angehörigen und Freunden vor ihm verheimlicht würden. Insofern, als dass sich diese Kognitionen auf einen unterstellten faktischen Sachverhalt beziehen, liegt in einer solchen Konstellation ein Wahn vor. Die folgende Tabelle ( Tab. 2.4) fasst die psychopathologischen Kriterien eines Wahns zusammen.
Tab. 2.4: Kriterien des Wahns (modifiziert nach Ebert 2008)
Was ist Wahn?Bemerkung
Aus theoretischer Perspektive kann der Wahn also auch als ein systematisches und starres Fehlurteil über einen einfachen oder komplexen Sachverhalt verstanden werden. Das charakteristische des Wahns ist dabei, dass es sich aus psychobiologischer Perspektive nicht um freies Verhalten handelt (Tebartz van Elst 2015, S. 135 ff.). Sämtliche Stigmata der Unfreiheit können identifiziert werden. D. h., dass im Wahn das urteilende Denken nicht mehr situativ an die wechselnden Rand- und Rahmenbedingungen der individuellen Lebenssituation angepasst werden, sondern an einer Überzeugung, unabhängig von solchen Randbedingungen, stereotypisch festgehalten wird. Gerade diese Unangepasstheit des urteilenden Denkens macht das Wesen des Wahns im Kern aus.
In den Extremformen kann wahnhaftes Denken dabei auch von Laien gut von nicht-wahnhaftem Denken unterschieden werden. Dies ist vor allem bei bizarren Wahninhalten der Fall, etwa wenn ein Mensch wie oben angedeutet glaubt, ein ehemals behandelnder Arzt sei in sein Ohr eingedrungen, lebe dort nun und spreche mit ihm. Bei anderen klassischen Wahnthemen wie einem Verfolgungswahn, einem Verarmungswahn oder einem Eifersuchtswahn kann es aber für Ärzte und andere Außenstehende im Einzelfall auch sehr schwer sein zu bewerten, ob das urteilende Denken anderer Menschen als angemessen oder im Sinne eines Wahns begriffen werden sollte. Hier ist es wieder das situationsunabhängige und überdauernd starre, rigide und unangepasste Denken ganz im Sinne der in Tabelle 2.4 ( Tab. 2.4) festgehaltenen Kriterien, welches für einen Wahn spricht. Die anschließende Tabelle ( Tab. 2.5) fasst die klassischen Wahnthemen zusammen und illustriert sie an Beispielen.
Tab. 2.5: Zusammenfassung und Illustration klassischer Wahnthemen (vgl. auch Scharfetter 2010)
WahnVerstärkende RandbedingungenBeispiel
Die o. g. Beispiele illustrieren auf der einen Seite, wie abstrus und abwegig die Wahninhalte im Einzelfall sein können. Auf der anderen Seite zeigen sie aber auch, dass die Inhalte des wahnhaften Denkens in die bunte Vielfalt und Dynamik des sich entfaltenden Lebens so komplex eingewoben sind, dass es im Einzelfall immer wieder auch schwer ist, wahnhaftes von nicht-wahnhaftem Denken zu trennen.
Auch kann gerade bei klassischen Wahnthemen, wie dem Verfolgungs- und Beeinträchtigungswahn, aber auch beim hypochondrischen Wahn, eine klare Grenze zwischen wahnhaftem, d. h. nicht situationsangepasstem Denken, und nicht-wahnhaftem, d. h. situationsangepasstem Denken, nicht immer überzeugend gezogen werden. Gerade die Charakterisierung des urteilenden Denkens von Menschen zwischen einem paranoid-misstrauischem Pol auf der einen Seite und einem naiv-vertrauensseligem Pol auf der anderen Seite kann in seinen vielfältigen alltäglichen Variationen durchaus als dimensional organisiert gedacht werden. Die Verortung des eigenen urteilenden Denkens an irgendeinem dimensionalen Punkt, zwischen den extremen Polen misstrauisch-paranoidem Urteilens auf der einen und naiv-vertrauensseligem Denkens auf der anderen Seite, ist dabei wahrscheinlich, wie viele andere Persönlichkeitseigenschaften auch, wesentlich durch multigenetische Komponenten begründet. D. h., dass die Organisation dieser dann als Eigenschaft des Körpers gesehenen Variable wie bei der körperlichen Eigenschaft Größe oder der geistig-seelischen Eigenschaft des autistisch-versus-holistisch-strukturiert-Seins Folge des Einflusses zahlreicher – wahrscheinlich mehrerer Hundert – Gene mit jeweils kleiner Effektstärke auf das sich entwickelnde Gehirn ist. Ein solcher, sehr wahrscheinlicher, multigenetischer Einfluss auf die Disposition des eigenen urteilenden Denkens darf dabei aber nicht verwechselt werden mit den Phänomenen und Mechanismen einer monogenetischen Mendel’schen Vererbung, wie sie bei den klassischen Erbkrankheiten gesehen wird ( Kap. 7.6; Tebartz van Elst 2018, S. 115 ff.).
Diese familiäre, genetische Disposition zu einem bestimmten kognitiven Stil kann in Analogie zur familiären Disposition zu einer bestimmten Körpergröße als vergleichsweise starre und in einer gegebenen Situation wenig modulierbaren Einflussgröße auf den Stil des eigenen urteilenden Denkens gedacht werden. Aber natürlich spielen auch andere Einflussfaktoren wie etwa biografische Erfahrungen und auch die Rand- und Rahmenbedingungen der spezifischen Situationen des Denkens eine jeweils wichtige Rolle. So entwickeln Menschen, die immer wieder Missbrauchs- und Verfolgungserfahrungen in ihrem Leben machen mussten in Reaktion auf solche Erfahrungen sicher einen misstrauischeren Denk- und Urteilsstil. Und auch die situativen Bedingungen des Denkens sind offensichtlich von zentraler Bedeutung. So ist es gut belegt und auch gut nachvollziehbar, dass Immigranten in einem Land eher zu einem misstrauisch-paranoidem Urteilsstil gelangen, weil sie die kommunikativen Feinheiten des Gastlandes nur begrenzt erfassen und verstehen können und nicht zuletzt, weil sie mit Wahrscheinlichkeit immer wieder mit Ablehnung, Feindschaft und Verfolgung konfrontiert werden. Die folgende Abbildung ( Abb. 2.2) fasst diese verschiedenen Einflussfaktoren auf die psychobiologische Dynamik des urteilenden Denkens grafisch zusammen.
Sie ( Abb. 2.2) illustriert nun aber nur die individuell unterschiedliche Disposition eines Denkstils zwischen einem misstrauisch-paranoidem und einem naiv-vertrauensseligem Pol. All diese unterschiedlichen Denkstile an sich sind – obwohl sie im Einzelfall als vergleichsweise starre Persönlichkeitseigenschaft eines Menschen gut erkannt werden können – noch kein Merkmal eines Wahns. Sowohl ein naiv-vertrauensseliger Mensch als auch ein misstrauisch-paranoid strukturierter Mensch kann in seinem urteilenden Denken frei oder wahnhaft gefangen sein (vgl. Tebartz van Elst 2015, S. 47 ff.). Entscheidend im Hinblick auf die Bewertung der Wahnhaftigkeit des Denkens ist nicht so sehr die gegebene Veranlagung oder Disposition eines Menschen (Denkstil), sondern vielmehr, wie sehr das konkrete Denken und Urteilen in einer Situation an die individuell vorhandenen Erfahrungen, Zukunftsabschätzungen und vor allem die situativen Rahmen- und Randbedingungen angepasst ist. Das Spezifische des wahnhaften Denkens bzw. Urteilens kann dabei gerade darin gesehen werden, dass im wahnhaften Denken die situative Anpassung des Denkens in der konkreten Situation sich löst von den situativen Faktizitäten und Wirklichkeiten.
Abb. 2.2: Illustration der Einflussfaktoren auf die Verortung des individuellen Denkstils zwischen einem angenommenen misstrauisch-paranoidem und naiv-vertrauensseligem Pol.
Wahnhaftes Denken und Urteilen ist gekennzeichnet durch eine Entkoppelung des individuellen Urteils von situativen, faktischen Wirklichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Es kann als situativ unangepasstes Denken verstanden werden.