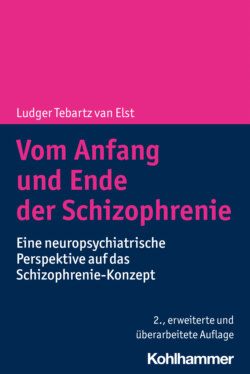Читать книгу Vom Anfang und Ende der Schizophrenie - Ludger Tebartz van Elst - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Die Symptome und Verläufe der Schizophrenie 2.1 Schizophrenie in der Lebenswirklichkeit
ОглавлениеWas ist die Schizophrenie in unserer Welt? Medizinische Begriffe haben in der alltäglichen Lebenswelt oft vielfältige Bedeutungen, die über den Kern der wissenschaftlichen Definition weit hinausreichen. Aber für kaum einen medizinischen Begriff gilt dies so sehr wie für den Schizophrenie-Begriff. Was bedeutet es in der alltäglichen Lebenswirklichkeit, eine Schizophreniediagnose zu bekommen?
Zunächst einmal ist eine Schizophrenie für viele Menschen eine große Angst. Denn hinter der bangen Frage »Bin ich verrückt?« verbirgt sich nicht nur eine Verunsicherung dem eigenen Körper gegenüber, die nicht wenige Leserinnen und Leser aus eigener Erfahrung kennen werden.1 Die Verunsicherung über das Symptom reicht viel weiter als wenn ein Mensch mit übergroßem Durst sich sorgenvoll fragt: »Habe ich einen Diabetes?«. Denn auch wenn die Psyche im wissenschaftlichen und populären Denken der Postmoderne meist als körperliches Phänomen begriffen wird, so ist doch unbestreitbar, dass psychiatrische Diagnosen das Selbstbild, die eigene Identität, das Selbstwertgefühl und die Stellung des Betroffenen in der Gesellschaft viel weitreichender beeinflussen als somatische Diagnosen. Und so zielt die sorgenvolle Frage »Bin ich verrückt?« eben nicht nur auf das Symptom an sich, sondern auf das Unheil in der Gesellschaft, welches mit der offiziellen Diagnose einer Schizophrenie von vielen befürchtet wird – teilweise sicher zu Recht.
Darüber hinaus ist mit der Schizophreniediagnose auch eine Drohung verbunden. Denn es schwingt auch die Zuordnung mit: »Du bist verrückt!« Die Schizophreniediagnose steht wie kein anderer Begriff für das Verrückt-Sein in der gesellschaftlichen Wirklichkeit unserer Zeit. Die Epochen, in denen Menschen, die Stimmen hören, sich unter Umständen auch als auserwählt und begnadet begreifen durften – zumindest solange die übrigen kognitiven Funktionen intakt blieben –, sind lange vorbei. Die meisten Betroffenen haben den »Verrückheits-Begriff« selbst oft in alltäglichen Auseinandersetzungen als Vorwurf und Schimpfwort benutzt, nicht ahnend, dass er eines Tages auf sie zurückfallen würde.
Schließlich ist die Schizophrenie ein Stigma, ein Mal: »Der da, die da, ist verrückt! Von dem kann man nichts erwarten!« Menschen, die in den Gesellschaften unserer Zeit als schizophren markiert wurden, wird mit Misstrauen und Vorsicht begegnet. »Kann ich diesem Mann trauen?« »Muss ich vorsichtig sein?« »Kann ich dieser Frau meine Kinder anvertrauen, wenn sie doch eine Schizophrenie-Diagnose hat?« Solche Fragen beschäftigen Menschen, wenn sie anderen begegnen, von denen sie wissen, dass sie an einer Schizophrenie leiden.
Weitreichendere Folgen als die Stigmatisierung durch die Gesellschaft hat die Selbst-Stigmatisierung (Rüsch 2021), denn sie greift in das Binnen-Verhältnis, den Selbst-Bezug betroffener Menschen ein. Sie betrifft nicht die Beziehung zwischen Außenstehenden und der eigenen Person, sondern die Beziehung der Betroffenen zu sich selbst. »Kann ich mir trauen?« »Kann es sein, dass ich die Kontrolle über mein Leben, mein Denken, mein Handeln verliere?« »Bin ich noch in hinreichendem Ausmaß frei und zurechnungsfähig?« All diese Fragen könnten viele nicht-schizophrene Menschen sich mit guter Begründung stellen, denen es nie in den Sinn käme. Zu nennen sind hier etwa Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken – und gelegentlich auch deutlich zu viel – Menschen, die einen Diabetes haben, ein hohes Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko, Menschen, die Drogen nehmen usw. Keine dieser medizinischen Konstellationen ist aber auch nur im entferntesten Sinne in einem vergleichbaren Ausmaß mit dem Problem der Selbststigmatisierung behaftet, wie dies bei den Schizophrenien der Fall ist.
Ein Großteil dieser Stigmatisierung speist sich aus dem alltäglichen Gebrauch des Schizophrenie-Begriffs als Schimpfwort: »Diese Politik ist schizophren!« Mit Schlagzeilen dieser Art werden wir leider nicht nur in der Boulevard-Presse, sondern auch in Medien konfrontiert, von denen man das eigentlich nicht erwarten würde.
Und Hand aufs Herz, verehrte Leserin, verehrter Leser, haben Sie nicht auch selbst das Schimpfwort so oder in ähnlicher Form (»Du bist ja verrückt!«) schon häufiger benutzt. Wer ahnt schon, dass dieser nachlässige Sprachgebrauch und vor allem die damit verbundenen Assoziationen einmal auf Freunde, Angehörige oder gar die eigene Person zurückfallen könnte? Wenn es dann aber so weit ist, d. h., wenn eine Schizophreniediagnose im Raum steht, so fällt dieser Sprachgebrauch, der im Kern darin besteht, den anderen auszugrenzen, anstatt sich inhaltlich mit seinen Problemen und seinem Erleben auseinanderzusetzen, auf den als schizophren markierten Menschen und sein Umfeld zurück.
Schließlich kann der Schizophrenie-Begriff auch als Angstabwehr verstanden werden. Etwa wenn schwer nachvollziehbare Straftaten oft mit ausgeprägter Brutalität unter der Überschrift »Schizophrener Patient beging ein Massaker« berichtet werden. Dann mag die Ausgrenzung des Unfassbaren, aber Geschehenen, in eine »andere Welt«, die von der »der Gesunden« in Form des Begriffs Schizophrenie abtgetrennt ist, auch dabei helfen, die Angst vor der Unbegreiflichkeit und Zufälligkeit des Schicksals – mit der wir alle immer wieder konfrontiert werden – einzudämmen.
Die Aufzählung illustriert, dass der Schizophrenie-Begriff und das Gemeinte dieses Begriffs, das Schizophrenie-Konzept, viele sehr unterschiedliche Bedeutungen in unserer alltäglichen, gesellschaftlichen Wirklichkeit haben, die den Rahmen der Medizin weit überschreiten. Aber davon abgesehen ist er eben auch ein medizinischer Fachbegriff, mit dessen Hilfe Wissenschaftler und Ärzte versuchen, die komplexe psychobiologische Wirklichkeit fassbar zu machen, welche sich in Form der schizophrenen Symptome und Verläufe hinter diesem Begriff verbergen.
Die Schizophrenie bzw. das mit diesem Begriff gemeinte ist also mehr als der Name für eine Gruppe von Krankheiten. Sie ist eine Angst, ein Vorwurf, ein Stigma, ein politischer Kampfbegriff, ein soziologisches Regulativ, eine juristisch relevante Kategorie – aber eben auch ein Krankheitsbegriff, ein Name, für eine Gruppe im Detail sehr unterschiedlicher psychobiologischer Phänomene und Verläufe.
Die Schizophrenie ist mehr: sie ist eine Angst, ein Vorwurf, ein Stigma, ein Kampfbegriff, ein Ausgrenzungsprinzip usw. Aber sie ist eben auch ein medizinischer Fachbegriff.
Was ist nun aber eine Schizophrenie in der Medizin? Die Schizophrenie wird im Französischen auch als die große Ungreifbare, »la grande insaissisable« beschrieben (Peters 2014, S. 7).2 Diese Beschreibung erscheint mir nicht ganz unangemessen. Denn auf die simple Frage des Laien »Was ist denn überhaupt eine Schizophrenie?« geraten die Experten nicht selten ins Zaudern und kämpfen damit, diesen Begriff, der doch in aller Munde ist, klar und anschaulich zu erklären. Meist wird dann der Weg gewählt, die Krankheit Schizophrenie über die Symptome zu erklären. Erste Näherungsversuche an eine Antwort lauten dann etwa: »Schizophrenie ist, wenn man Halluzinationen hat und Stimmen hört, die in Wirklichkeit gar nicht da sind.« oder: »Schizophrenie ist, wenn Menschen an Wahnvorstellungen leiden, das Gefühl haben, verfolgt zu werden, abgehört zu werden, manipuliert zu werden, beobachtet zu werden, obwohl dies gar nicht stimmt.«
Dieser Weg soll auch in diesem Buch gewählt werden. D. h., dass die erste Annäherung an den Schizophrenie-Begriff unserer Zeit so erfolgen soll, dass all die Symptome, die eine Schizophrenie nach heutigem Verständnis ausmachen, vorgestellt werden sollen.