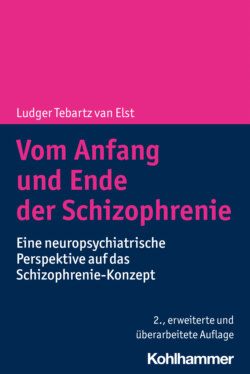Читать книгу Vom Anfang und Ende der Schizophrenie - Ludger Tebartz van Elst - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
1 Einleitung
Die Schizophrenie gehört zu den dramatischsten Diagnosen der Medizin der Neuzeit, denn sie scheint nicht nur defizitäre Körperfunktionen, sondern den Wesenskern des Menschseins zu berühren. Sie fungiert nicht nur als Bezeichnung für ein psychiatrisches Symptomgemenge, sondern hat darüber hinaus weitreichende gesellschaftliche Implikationen. Kaum eine andere Diagnose der Medizin wird so sehr gefürchtet und von Betroffenen wie Angehörigen als Makel, Stigmatisierung und Omen einer umfassenden gesellschaftlichen Ausgrenzung erlebt.
Während schizophrene Symptome so alt sind wie die Menschheit selbst, wurde das Konzept der Schizophrenie in seinen Grundzügen vor etwas über 100 Jahren geprägt. Der Begriff setzte sich einige Dekaden später durch und ist nicht nur im medizinischen Denken, sondern auch im gesellschaftlichen Diskurs der Gegenwart fest verankert. Dabei besteht inzwischen unter Wissenschaftlern und Medizinern weitgehende Einigkeit darüber, dass es die Krankheit Schizophrenie so gar nicht gibt. Vielmehr wird sie heute – anders als noch vor 100 Jahren – als Sammelbegriff für eine Gruppe von unterschiedlich verursachten teils vorübergehenden, teils chronischen zerebralen Funktionsstörungen verstanden. Dementsprechend ist im Zusammenhang mit der Überarbeitung der großen psychiatrischen Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11 eine Diskussion darüber entbrannt, ob der Begriff und das Konzept der Schizophrenie nun nach etwa 100 Jahren seiner Existenz abgeschafft werden sollten. In Japan wurde die Abschaffung des Schizophrenie-Begriffs seit Anfang des neuen Jahrtausends bereits umgesetzt.
Vor diesem Hintergrund werden in dieser Buchpublikation zunächst die verschiedenen Phänomene und Symptome beschrieben, die eine Schizophrenie nach den aktuell gültigen Klassifikationssystemen ausmachen. Darauf aufbauend wird die Kultur- und Medizingeschichte der Schizophrenie skizziert. Denn während die Symptome und Phänomene der Schizophrenie so alt sind wie die Menschheit, so sind das Krankheitskonzept und der Begriff der Schizophrenie doch zeitgeschichtliche Phänomene.
An dieser Stelle schließen sich drei Kapitel an, in denen grundlegende medizintheoretische Fragen thematisiert werden. Zunächst wird dabei der Frage nachgegangen, was es überhaupt bedeutet, dass ein Phänomen normal ist. In diesem Zusammenhang werden drei Bedeutungsbereiche von Normalität herausgearbeitet. Zunächst einmal kann Normalität als statistische Größe verstanden werden. Dies ist in der Medizin, aber auch in der Physik und Technik dann der Fall, wenn die Eigenschaft, deren Normalität infrage steht, einer Normalverteilung folgt. Dies ist bei zahlreichen biologischen Eigenschaften wie z. B. der Körpergröße der Fall. Solche Eigenschaften sind also nicht entweder gegeben oder nicht, sondern sie sind dimensional strukturiert, d. h. die fragliche Eigenschaft, wie die Körpergröße, ist mehr oder weniger stark ausgeprägt. Fehlende Normalität kann dann recht objektiv über statistische Maße wie Mittelwert und Standardabweichung definiert und gemessen werden. Bei der technischen Norm geht es dagegen um funktionale Eigenschaften von Geräten, Maschinen oder auch Körpern. So kann etwa die Lautsprechanlage funktionieren oder nicht, das Rücklicht am Auto leuchtet oder nicht, ein Mensch kann sehen oder nicht. Solche technischen Normbegriffe sind meist kategorial strukturiert, d. h. die interessierende Eigenschaft ist nicht mehr oder weniger vorhanden, sondern sie ist vorhanden oder nicht. Auch für die technische Norm gibt es im Bereich der Biologie zahlreiche Beispiele. So kann etwa nach einer Entzündung des Sehnervs das Sehvermögen ausfallen, was einer fehlenden Normalität im Sinne der kategorialen oder technischen Norm entspräche. Schließlich gibt es gerade im Bereich des Psychischen und der Organisation von Gesellschaften auch die soziale Norm. Die soziale Norm definiert Normalität auf der Grundlage von Erwünschtheit aus der Sicht einer Gruppe oder definiert durch Machthaber. Weder die medizinische Wissenschaft noch das ärztliche Handeln kann auf Normalitätsbegriffe verzichten. Nach humanistischem Grundverständnis sollte aber bei der Definition von Krankheiten auf soziale bzw. moralische Normen möglichst verzichtet werden. Ob das in der Psychiatrie tatsächlich immer gelingt, wird dann im Folgenden thematisiert, wenn der Frage nachgegangen wird, was nach medizinischem Verständnis überhaupt eine psychische Störung ist. Dabei zeigt es sich, dass die Medizin im Allgemeinen, aber auch die Psychiatrie im Speziellen, mit je nach Konstellation unterschiedlichen Normbegriffen operiert. Sie können sich auf dimensional ausgeprägte, mehr oder weniger stark vorhandene Eigenschaften des Körpers beziehen und damit statistisch organisiert sein. Sie können sich aber auch auf funktionale Aspekte beziehen und damit kategorial bzw. technisch verfasst sein. Gerade in der Psychiatrie, wo es u. a. auch um die Bewertung von Verhaltensweisen bei der Definition und Klassifikation von Krankheiten bzw. Störungen ankommt, wird teilweise offen, teilweise verdeckt, aber auch auf soziale Normen zurückgegriffen. Dies wird im 6. Kapitel des Buches in seiner ganzen Zwiespältigkeit klar herausgearbeitet.
Auf der Basis dieser grundlegenden medizintheoretischen Überlegungen wird dann der Frage nach der Ursächlichkeit schizophrener Symptome nachgegangen. Dabei wird das Wissen über die verschiedenen Kausalstränge, die das Entstehen schizophrener Phänomene begünstigen können, umfassend zusammengefasst und vorgestellt. Es werden die funktionelle Neuroanatomie höherer mentaler Leistungen und ihrer Störungen ebenso herausgearbeitet wie die klassische dopaminerge und glutamaterge Hypothese der Schizophrenie, bildgebende, genetische, aber auch umweltbedingte, psychoreaktive und persönlichkeitsstrukturelle Ursachen der schizophrenen Störungen. Gerade im Hinblick auf die genetischen Aspekte der Schizophrenien wird dabei verdeutlicht, dass genetische Ursachen schizophrener Syndrome sowohl im klassischen, kategorialen Sinne in Form monogenetischer Erkrankungen als auch aber eben deutlich häufiger im dimensionalen Sinne in Form von multigenetischen Normvarianten gegeben sind. Es ist dabei ein zentrales Anliegen dieses Buches, zu erklären und darauf hinzuweisen, dass es gerade bei multigenetischen Verursachungen problematisch ist, von Krankheiten im klassischen Sinne zu sprechen.
Im daran anschließenden 8. Kapitel des Buches werden neue neuropsychiatrische Entwicklungen auf dem Gebiet der Schizophrenie vorgestellt. Wie im gesamten Buch wird gerade auch hier anhand von zahlreichen Kasuistiken veranschaulicht, dass bei vielen Einzelfällen, bei denen noch vor 20 Jahren dem Wissensstand entsprechend zu Recht eine Schizophrenie diagnostiziert wurde, heute neuropsychiatrische Krankheitsdiagnosen im engeren Sinne möglich sind. So können – zumindest auf Einzelfallebene – Stoffwechselerkrankungen wie die Niemann-Pick-Typ C Erkrankung, immunologische Erkrankungen wie die limbischen Enzephalitiden oder die Hashimoto-Enzephalopathie oder paraepileptische schizophrene Störungen identifiziert und oft auch kausal behandelt werden. Gerade diese jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Neuropsychiatrie illustrieren dabei anschaulich, dass es sich bei der Schizophrenie um einen Sammelbegriff für zahlreiche, unterschiedlich verursachte, meist noch unverstandene, neuropsychiatrische Erkrankungen handelt.
In diesem Zusammenhang wird dann der Frage nachgegangen, ob gerade im multigenetischen Bereich, schizophrene Erlebensweisen nicht auch als Normvariante menschlichen Wahrnehmens und Erlebens verstanden werden sollten. Dafür spricht etwa die Tatsache, dass epidemiologischen Befunden zufolge 6–7 % der gesunden Allgemeinbevölkerung zumindest einmal im Leben schizophrene Symptome aufweisen, ohne dass nach psychiatrischen Kriterien eine psychische Störung diagnostiziert werden könnte.
Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen und Überlegungen wird dann im 9. Kapitel das Für und Wider der Schizophrenie gegeneinander abgewogen. Perspektivisch wird nach Abwägung der Vor- und Nachteile das Urteil vertreten, dass der Schizophrenie-Begriff und – viel wichtiger noch – das Schizophrenie-Konzept in den Köpfen aller Akteure mehr Nachteile haben als dass sie nutzen. Damit ist das übergeordnete Ziel dieses Buches ein Unbescheidenes, nämlich die Abschaffung des Begriffs und des Konzepts der Schizophrenie in den Köpfen der Leserinnen und Leser – zumindest für den Fall, dass meine Argumentation und Sichtweise überzeugen sollten. Umso wichtiger ist es mir, zu betonen, dass die meisten der hier vorgetragenen und entwickelten Gedanken nicht wirklich neu und exotisch sind, sondern dem Diskurs der Zeit entspringen, was in Kapitel 10 dargelegt wird.