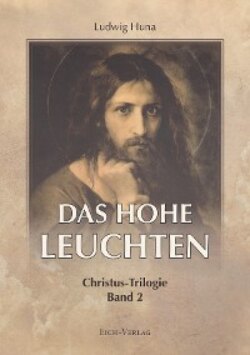Читать книгу Das hohe Leuchten - Ludwig Huna - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFünftes Kapitel
Jesus legt die Jätehacke beiseite, sein Rücken schmerzt, er hat viel Unkraut aus dem nahen Acker gestochen, und der Feierabend holt ihn nun heim zur Mutter. Ohne rechts und links zu sehen, geht er vorbei an bekannten Gestalten, die wie er nach Ruhe dürsten.
Ein Händler aus dem nahen Sephoris, mit dem er den Gruß gewechselt, bleibt stehen und sinnt ihm nach. Er weiß, dass die Leute von Nazareth seltsame Dinge über den Menschen sprechen, der da eben an ihm vorbeigegangen. Sie nennen ihn einen Eigenbrötler, Sonderling, Fürsichgeher, mit dem sich keiner so recht anfreunden kann. Der Händler weiß auch, dass der Zimmermann das Handwerk seinem nächst jüngeren Bruder übergeben hat, dem heiteren Jakobus, und dass er sich selbst lieber mit der Ackerbestellung zu schaffen macht. Es gibt gleichwohl manche in dem Städtchen, die seine stille, sanfte Art lieben, ohne mit ihr etwas Rechtes anfangen zu können.
Der Händler versucht ihm nachzupfeifen. Jesus bleibt richtig stehen. Ja, nun erkennt er den Händler, der früher einmal in Nazareth war.
„Du bist Hadad, der Tuchhändler aus Sephoris?“
„Du warst lange nicht in meiner Stadt; kommst du einmal, geh nicht an meinem Laden vorbei.“
„Ich werde nicht sobald nach Sephoris kommen“, sagt Jesus einfach.
„Du warst, irre ich nicht, ein paar Jahre fort? Liebst du die Heimat nicht?“
„Ich liebe die Menschen mehr als meine Heimat, und drum geh ich zu ihnen.“
Hadad macht große Augen. „Zu den Menschen? In Sephoris sagt man, du zögest dich gern von ihnen zurück.“
„Das war einmal so. Nun suche ich sie auf.“
„Das ist recht und gut!“ Hadad lächelt still in sich hinein wie einer, der sich über eine Schrulle eines anderen lustig macht. Er streckt ihm die Hand hin und geht dann seines Weges.
Jesus blickt ihm nun nach. Der arme Mann, denkt er, sollte mit seinem Bruder, dem Kameltreiber, Frieden machen, dann würde sein Handel mehr blühen. Dass die Menschen so schwer mit ihren ureigensten Brüdern in Frieden leben können. Ich will das den Menschen sagen, wenn –.“
Seine Gedanken unterbricht der Mutter Ruf, die bei der Haustür steht und schon auf ihn zu warten scheint. An ihrer Seite lehnt Jakobus am Türstock und schärft das Hobelmesser.
„Es war einer da, der dich von Engaddi her kennt“, sagt der Bruder. „Sedazur nennt er sich, ein Ägypter.“
Ja, Jesus erinnert sich des einstigen Gefährten aus der Lehrzeit des Geistes. „Du hättest mich holen sollen.“
„Er hatte es eilig, er muss zur Nacht in Kana sein, den schwerkranken Vater zu sehen.“
„So so. Mutter – ich esse heute nicht zu Hause.“
„Wohin willst du, Joschua?“
„Wieder aufs Feld.“
„Du kommst doch daher. Was willst du bei Nacht auf dem Feld?“
„Ich möchte unter der Hut der Sterne einen Entschluss reifen lassen, den ich schon lange unter meinem Scheitel bewege.“
Die Mutter sieht bekümmert. Wenn er so verhalten spricht, gärt etwas Besonderes in ihm, das weiß sie; aber sie ahnt auch gleich, dass, was er brütet, ihr Mutterherz ängstigen wird. Es war das immer so. „Willst du wieder nach Jerusalem?“, tastet sie bang in seine Gedanken.
„Nein, es treibt mich etwas gen Sonnenaufgang. Es weht ein Ton aus des Jordans Niederung herauf bis in die galiläischen Berge, und er klingt mit dem zusammen, der in meinem eigenen Herzen schwingt. Mutter, hast du von Johannes gehört?“
Maria lauscht dem Namen mit gespanntem Herzen. ,.Meinst du Zacharias’ Sohn? Seine Mutter, meine Base Elisabeth, ist schon lange tot. Und von Zacharias weiß ich nichts mehr.“
„Es gehen allerlei Gerüchte über diesen deinen Johannes durch Galiläa. Fischer vom See sind nach dem Jordan gegangen und zurückgekommen und wissen Seltsames über den Mann zu erzählen, der dort den Willigen Buße predigt.“
Maria spannt den Atem an. „Das Amt hat ihm ein Engel Gottes bei seiner Geburt prophezeit. So scheint es sich erfüllt zu haben.“
„Er soll selbst Prophet sein. Seit zwei Jahren verkündet er Gottes heiligen Willen. Er wechselt oft das Ufer und zieht bald nach Nord, bald nach Süd. Ich möchte – ach, Mutter, ich weiß nicht, ob du mich verstehen wirst – es drängt mich ein wunderlicher Geist zu Johannes dem Täufer. Den Hobel hab ich längst in Jakobus’ Hände gelegt, da mich das Werkzeug beengt, den Acker geb ich nun in Johannes’ Hut, und dich selbst, Mutter, in die Hut Gottes und der Deinen. Lass mich an den Jordan.“
Maria presst es das Herz zusammen. Wenn er ihr nun wieder jahrelang fortblieb wie damals, als er nach dem Salzmeer ging? „Sohn, mir ist bang um dich. Gehörst du denn nicht mehr zu uns, oder willst du mir nicht mehr gehören?“
Und Jesus mit herzlicher Bedrängnis: „Mutter, ich gehöre wahrscheinlich nicht dir allein, sondern allen Menschen. Und besonders denen, die guten Willens sind.“
Die guten Willens sind! Das Wort klingt aus der Brunnentiefe der Erinnerung an ihr Ohr. War das nicht damals den Hirten ins Ohr gesungen worden von Engellippen, als sie das Knäblein an ihren verausgabten, warmen Leib gedrückt in der Stallhöhle zu Bethlehem? Wenigstens hatten sich einige von ihnen so ausgedrückt. Nun hatte es der Sohn mit seinen Gedanken eingefangen und ihm eine neue Prägung gegeben. Damals war es mit dem Wort Frieden verquickt, jetzt aber mit dem unruhigen Herzensdrang des erwachsenen Mannes, ihres Sohnes. Aber wie einst schon einmal, klingt zugleich eine Absage an ihre Mutterangst, ja an ihr Mutterrecht, in ihr Gemüt: Ich gehöre nicht dir allein. Das lässt abermals eine Saite in ihrem Herzen reißen. Ihr Auge blickt in die innere Not, und die großen Wimpern senken sich darüber, als wollten sie ihr Inneres von der Welt abschließen.
Da mengt sich auch Jakobus drein. „Mutter, er ist nun einmal anders als wir. Du selbst hast ihn, wie du uns immer erzähltest, in wunderbarer Weise, die nur Gott versteht, zur Welt gebracht. Drum wundere dich nicht, wenn er anders geworden ist als die anderen. Wir verstehen seine Art schwer oder gar nicht. Aber was eines Engels Geist über ihn in deiner schweren Stunde gesprochen, rechtfertigt jetzt sein sonderliches Tun. Wie lange willst du fortbleiben?“
Jesus drückt ihm dankbar die Hand. „Es kann Tage, es kann Wochen dauern. Mein Ziel ist – o wie soll ich dir’s sagen, Bruder? – ich möchte so gern die Kraft suchen, die uns schuf und erhält. Vielleicht kann ich sie Vater nennen, denn sie wirkt wahrhaftig väterlich.“
Jakobus und die Mutter sehen einander ungläubig an. „Meinst du damit Gott?“ Löst es sich zäh von des Bruders Lippen. Er hat nie viel über hohe Dinge gegrübelt; aber nun taucht er doch, wenn auch tastend und scheu, in die Seele des älteren Bruders hinein.
Jesus blickt sinnend in die Weite. „Das Göttliche ist zugleich das Väterliche. Es ist im Menschen und doch außer ihm. Doch ich möchte mit euch beiden irdisch denken. Ich will dir, Jakobus, noch bei der letzten Bestellung aus Magdala an die Hand gehen, will noch einmal das Schabeisen, die Säge, die Raspel, das Winkelmaß meistern, dann aber will ich den Weg gehen, den einst Engelmund der Mutter gewiesen und den der Weisen Verkündigung vor dir gezeichnet hat. Ich schätze deine Arbeit nicht gering, Jakobus, und ich sage dir, du wirst Meister werden in deinem Werk, und das Heil, von mir für dieses Haus gedanklich erfleht, wird über deiner Hände Schaffen liegen.“
Maria ist der Wasserschlauch aus den Händen geglitten, und nun weint sie still in sich hinein, denn sein sorgendes Wort, sein hütender Gedanke, sein fester Wille schließt zugleich Liebe für sie ein, ohne dass er es geradezu auszusprechen braucht. Sie fühlt aber auch, dass er im Begriffe ist, seine Vergangenheit in Nazareth in sich selbst auszulöschen und sein Herz in einer für sie noch unverstandenen Art an die Menschen zu verschenken. Will er ihnen etwas geben, woran teilzunehmen Marias Sinn noch nicht fähig ist? Sie weiß es nicht. Alle ihre Grübelei über des Sohnes geistiges Treiben und Drängen stößt sich an den Mauern der Verständnislosigkeit wund. Maria, die stets nur ihrer Hauswirtschaft strenge Last auf sich genommen und die Betreuung ihrer Kinder mit mütterlicher Rechtschaffenheit vor Gottes Antlitz Tag für Tag zum Inhalt ihres Lebens gemacht hatte, fühlt nun schmerzlich, dass ihr der älteste Sohn zu entgleiten droht, indem er aus der Enge der häuslichen und werktätigen Gebundenheit in die Welt flüchtet. Nur gab er dieser Flucht einen merkwürdigen Namen, indem er vorgab, sich an Gottes väterliches Herz zu werfen. Wie er das machen wollte, blieb wohl ihm als auch der Mutter noch verborgen.
Der Ruf der Allmacht ist an ihn ergangen, dass er sich und sein Herz im Namen dieser Macht an die Menschen verschenke. Das Ende des Weges verbirgt sich ihm noch, da er kaum erst am Anfang steht. Und dennoch kommen Augenblicke, da er sich seine Sendung als ein völliges Ausbluten seines Menschen vorstellt; aber der bangt nicht vor der Schwere der irdischen Wanderung, über der der Abglanz der Himmel zu liegen scheint. Vorerst glaubt er eines zu wissen: Nach ihm sehnen sich schon die dürstenden Herzen, alle, die vertrockneten Geistes, verkümmerter Seele sind. Wird er die Kraft haben, sie zu stärken? Seine Arbeit an den Menschen beginnt mit bangen Fragen, das irdische Wesen klammert sich noch fest an ihn und stellt sich hindernd vor die Durchdringung mit dem göttlichen Geist. Dort unten am Jordan hofft er Antwort zu finden auf die Zweifelsfragen banger Stunden.
Und ein anderes stellt sich fast bildhaft in seinen Gedankenweg hinein. Er unterscheidet vorahnend die Kraftgruppen seiner Feinde, die verschiedenen Verkörperungen des Bösen, das hemmend seinen Weg verstellen wird. Er erblickt geistig die starre Wand der Pharisäerseelen, das stechende Leuchten des Sadduzäerhochmuts, den Priesterdünkel der satten Zeremonienverwalter und Tempeldiener, der Bewahrer der mosaischen Überlieferung und aller herzlosen, empfindungsarmen Feinde des Guten, der Verstandestüchtigen mit den Spöttermienen und der Buchstabendeuter und verstockten Gewissen. Aber all diese inneren Bilder verbirgt er vor der Mutter.
Maria findet nur schwer aus ihrer Herzensnot heraus. „Was ist das mit der Taufe da unten?“
Jesus ist im Begriff, seine Reisehabe zu sammeln. „So wie sie Johannes vornimmt, ist sie wohl nur ein Sinnbild der inneren Wandlung des Menschen vom Bösen zum Guten. Das Wasser soll die reinigende Kraft des Geistes darstellen, es ist ein Zeichen, nicht mehr. Es vermag an sich nur den Körper zu reinigen, aber das Feuer des Geistes soll die Seele ergreifen. Dieses Feuer steht über dem Wasser, das nur ein Bereiter des Feuergeistes ist. Darum muss ich wohl selbst durch die Wassertaufe gehen, um vor dem Volk die Weihe für die Feuertaufe zu erhalten. Aber am Ende ist alles äußere Geschehen nur Sinnbild für das innere Weben, und die Zeichen Wasser, Feuer, Blut, Brot und Wein, sie bekommen ihre Kraft erst durch die geistige Bedeutung.“
Der Bruder Jakobus versucht das Gehörte zu verarbeiten. „Versteh ich dich recht, so ist die Wassertaufe gleichnisweise zu begreifen. So wie das Wasser den Schmutz vom Leibe nimmt, so nimmt das lebendige Wasser des Willens zur Umkehr alles böse Wünschen und Wollen hinweg. Und ein Name und ein Zeichen an sich heiligt noch nicht die Seele des Menschen.“
„Du sprichst wahr, Jakobus“, sagt Jesus mit freundlichem Ernst, „und mich dünkt, wir werden uns einmal ganz verstehen. Dies also nimm zum Abschied: Die Taufe ist die Wiedergeburt des guten Geistes, den der böse erstickt hat.“ Er fährt mit der Hand nach der Stirn, als wolle er den hohen Gedankengang irdisch unterbrechen. „Mutter, bereite mein Bündel, gib mir Gurt und Stock und mein Essäergewand.“
Der Mutter schneidet es ins Herz.
Eine Stunde darauf wandert Jesus in die Nacht hinaus, wo er Zwiesprache mit dem großen Unbekannten hält, der ihn gerufen durch die Kraft der inneren Stimme. Ein Brausen und Gären und Wogen ist in ihm, das ihn zu keiner Sammlung kommen lässt. Spät nachts kehrt er heim und wälzt sich unruhig auf seiner Schlafmatte.
Am anderen Morgen zieht er aus dem Brunnentor in das sonnenfreundlich erhellte Bergland hinaus. Bald verschwindet er dem Tränenauge Marias, den Blicken der ernst gewordenen Brüder, die sein Scheiden weniger innerlich als vielmehr als einen Ausfall einer Arbeitskraft empfinden. Jakobus tröstet die Mutter. „Er überantwortet sich Jahve“, sagt er schlicht. „Wie er das brauchbar tun wird, ist sein Geheimnis, und es steht uns nicht an, uns deshalb zu vergrübeln.“
Jesus schreitet nun von Nazareths Bergen in die grünflutende, vom Wind leise überfächelte Ebene von Jezreel hinab, wo sein Fuß längs wellenden Weizenfeldern vorwärts geht, während sein unbeschwerter Wandersinn mit dem Jubel der Lerche spielt, die sich im Steilflug zu azurnen Höhen schwingt. Aber nur ein paar Schritte weit hält dieses freifrohe Sinnen an, dann fällt er mit seinen Gedanken wieder in seine Sendung zurück, die ihn nun rascher vorwärts treibt, dem Süden zu; über Samariens Berge hin. Und sein drängendes Herz liebt sich schon dem Manne entgegen, der in der Nähe des Jordanschlammes mit unbegreiflicher Ahnung seiner harrt und von dem Jesus nichts weiß, als dass er die Sünder zur Buße bekehren will. Wird dieser Mann seinem Willen gerecht werden? Und wie wird das Wort des geistigen Erkennens lauten? Jesus fühlt im Weiterschreiten, dass dort aus den Wüsteneien des Jordans ein unsichtbarer Tempel emporwächst, der den sichtbaren der Pharisäer zu bedrohen scheint.