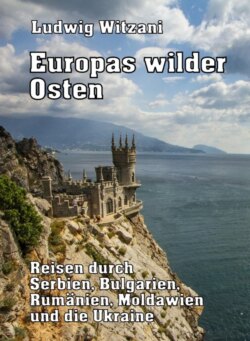Читать книгу Europas wilder Osten - Ludwig Witzani - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Stadt,
in der die Revolution ausbrach In Temeswar,
der Hauptstadt des Banat
ОглавлениеSeit Wochen lag eine Bullenhitze über dem gesamten Donauraum. Hochsommerliches Steppenklima hatte sich in das Zentrum Europas verirrt. In Belgrad und Budapest war das Wasser knapp geworden, und die ersten Bewässerungsanlagen waren bereits versickert. Ich durchfuhr Südungarn auf dem Weg nach Temeswar und erblickte vertrocknete Gärten innerhalb umzäunter Höfe. Auf den staubigen Dorfstraßen fuhren die Männer auf ihren Fahrrädern mit freiem Oberkörper umher. Hin und wieder standen Bauersfrauen mit ihren Melonen, Pflaumen und Apfelsinen am Wegesrand. Es war noch keine 11:00 Uhr und bereits 35 Grad Celsius.
An der ungarisch-rumänischen Grenze war wenig los. Wo sich jahrhundertelang Ungarn und Rumänen angefeindet hatten, war europäischer Friede eingekehrt. Lässig wurde ich durchgewunken. Willkommen in Rumänien. Willkommen im Banat.
Knapp dreißigtausend Quadratkilometer umfasste das Banat, eine der zentralen europäischen Kulturlandschaften, die nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Serbien und Rumänien geteilt wurde. Flach wie eine Flunder erstreckte sich die Landschaft bis zum Horizont. Die Hitze flimmerte über dem Asphalt, und auf den abgeernteten Feldern verdorrten die Stoppeln.
Hier und da sah ich Bauernhöfe, über denen die deutsche Fahne wehte. Schwarzrotgold in der westlichsten Provinz Rumäniens. Eine Werbeaktion, mit der die Landwirte durchreisende Touristen aus Deutschland auf ihre Höfe locken wollten, um ihnen Obst und Gemüse zu verkaufen. Tatsächlich waren viele Deutsche auf den Durchgangsstraßen unterwegs. Sie durchquerten eine Region, in der einst Hunderttausende Deutsche gelebt hatten, die inzwischen fast vollständig verschwunden waren. Einst waren sie als „Banater Schwaben“ die bedeutendste Volksgruppe des Banat gewesen, dann hatte sie die Geschichte zermalmt.
Die Geschichte des Banat aber reichte weit hinter die Epoche der deutschen Einwanderung zurück. Die flache Ebene zwischen Donau und Südkarpaten, gleichsam der Türspalt, durch den asiatische Reitervölker an den Karpaten vorbei in das Herz Europas vordringen konnten, war im frühen Mittelalter das Durchzugsgebiet von Hunnen, Awaren, Ungarn und Petschenegen gewesen. Dann hatte der Überfall der Mongolen 1241 die gesamte Region entvölkert. Seitdem war die Geschichte des Banat eigentlich nur noch eine Zuwanderungsgeschichte.
Die größte Zuwanderungswelle hatten die österreichischen Habsburger nach ihrem Sieg über die Türken am Ende des 17. und am Beginn des 18. Jahrhunderts ins Werk gesetzt. Die sogenannten „Donauschwaben“ kamen, vornehmlich Rheinländer und Süddeutsche, die sich zu Hunderttausenden im gesamten Donauraum und ganz besonders im Banat niederließen. Mit der ihnen eigenen Mischung aus Disziplin und Fleiß verwandelten sie das Banat in die „Kornkammer des Balkans“, was sich wie eine Erfolgsgeschichte anhört, aber bald zu anhaltenden Reibereien mit anderen Volksgruppen führte. Die Ungarn hatten vor dem Ersten Weltkrieg vergeblich versucht, das Banat zu magyarisieren; die Rumänen, die seit 1918 den größten Teil des Banat besaßen, gewährten den Rumäniendeutschen größere Freiheiten, wurden aber von diesen verachtet. Und zur Wahrheit gehört auch: Zwischen den Weltkriegen erlagen viele Banater Schwaben den Einflüsterungen des Nationalsozialismus und kollaborierten während des Zeiten Weltkrieges in vielfältiger Weise mit Nazi-Deutschland.
Die Rache der Sieger war furchtbar. Im serbischen Teil des Banat wurden die Deutschen praktisch ausgerottet, zu Zehntausenden in Todeslagern planmäßig ermordet. Im rumänischen Teil wurden die Banater Schwaben ausnahmslos enteignet und zu großen Teilen für Jahre in Arbeitslager nach Ostrumänien oder Russland verschleppt.
Kein Wunder, dass sich der Rest der Banater Schwaben in Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg um die Ausreise nach Deutschland bemühte. Für Zehntausende folgte einem solchen Ausreiseantrag jahrelanges Warten und Stigmatisierung, ehe sich die kommunistische Regierung gegen hohe Lösegeldzahlungen aus der Bundesrepublik aus reiner Geldgier dazu herabließ, häppchenweise volksdeutsche Rumänen ausreisen zu lassen.
Soweit die Geschichte des Banat, von deren Gräueln an diesem hochsommerlichen Tag nichts mehr zu sehen war. Zu Hunderten standen die Garben zum Abtransport auf den Feldern bereit. In einigen Dörfern wurden bereits die Vorbereitungen für das Erntedankfest getroffen. Kurz vor Temeswar parkte ich an einem Gasthof und trank einen starken schwarzen Kaffee. Um mich herum saßen rüstige Kerle im Bauernkittel. Ihre Gesichter waren von einer geschichtslosen Gegenwärtigkeit.
In Temeswar fand ich auf Anhieb ein gutes Hotel in der Innenstadt. Der Rezeptionist sah aus wie ein Küss-die-Hand-Concierge und besaß den Humor eines Kölner Köbes.
„Sprechen Sie Deutsch ?“, fragte ich ihn.
„Gerade genug um die Gäste zu bescheißen“, erwiderte er lachend und gab mir ein erstklassiges Zimmer, in dem alles funktionierte.
Gleich neben dem Eingang des Hotels begann die Fußgängerzone von Temeswar. Sommerliche Stimmung, flanierende Passanten, Werbeplakate allenthalben. Unter den Sonnenschirmen eines Straßenrestaurants saßen Muskelprotze im Unterhemd an den Tischen, neben ihnen zwitscherten ihre blutjungen Freundinnen, fast jede von ihnen mit Kettchen behangen. Junge Kellnerinnen liefen sich die Hacken ab und ließen sich reihenweise Anraunzer von Seiten der Gäste gefallen.
Trat man aus dem Schatten, war die Hitze kaum zu ertragen, denn die Sonne stand nun senkrecht über der Stadt. Das Thermometer bewegte sich auf die 40 Grad Marke zu, und die Menschen schienen sich in Zeitlupe durch die Straßen zu bewegen. Tauben flüchteten sich in den Schatten der Bäume, manche lagen auch, vom Hitzschlag getroffen, tot auf dem heißen Asphalt.
Das urbane Zentrum Temeswars bestand aus drei großen Plätzen und zahlreichen Parks. Eine ansehnliche Stadt im Würgegriff eines Balkan-Hochs. Der größte Platz war „Platz der Freiheit“ (Piața Literatiji), in dessen Mitte sich die Staue des heiligen Nepomuk und der Jungfrau Maria erhob. Solche Mahnmale existierten im gesamten ehemaligen österreichisch-ungarischen Kulturraum zur Erinnerung an überstandene Pestepidemien. Der „Platz des Sieges“(Piața Victoreii) war eine lang gezogene Fußgängerzone zwischen Oper und Kathedrale mit zahlreichen Cafés und Restaurants, in denen die Leute zusammengedrängt im Schatten saßen und nach Luft schnappten.
Der schönste Platz Temeswars ist der „Platz der Einheit“ (Piața Unitii). Er besitzt einen rechteckigen Grundriss und einen Rasen in seiner Mitte. Umgeben war er von teilweise restaurierten, teilweise pittoresk vor sich hin vergammelnden Gebäuden an seinen Rändern. Eingerahmt wurde der Platz an seinen Längsseiten von einer griechisch-katholischen und einer römisch-katholischen Kathedrale, die ich nacheinander besuchte, nicht so sehr aus religiösem Interesse, sondern, weil es in ihrem Innern schattig und kühl war. Vor der römisch-katholischen Kathedrale traf ich eine Reisegruppe aus Deutschland. Es handelte sich um zwei Dutzend älterer Herrschaften, denen die Hitze sichtlich zusetzte.
In einer Seitengasse des Platzes der Einheit betrat ich eine Buchhandlung und fragte nach deutschen Büchern. Die Buchhändlerin, eine junge Frau, die fließend Deutsch sprach, schien sich über mein Interesse zu freuen und zeigte mir eine ganze Wand mit deutschsprachiger Literatur. Sie trug die dunkelblonden Haare hochgesteckt, was ihr ein aristokratisches Aussehen verlieh, ihr Gesicht war schmal, die Augen groß und ausdrucksstark. Eine Schöne von Temeswar.
„Welche Bücher würden Sie einem Deutschen ohne Vorkenntnis über das Banat empfehlen?“ fragte ich.
„Sachbücher oder Romane?“
„Lieber Romane“
Die Buchhändlerin trat vor die Bücherwand und durchmusterte die Regale. Nach einigem Überlegen griff sie zu drei Büchern und legte sie vor mir auf einen kleinen Tisch. Richard Wagners Roman „Habseligkeiten“, Eginald Schlattners Buch „Der geköpfte Hahn“, und die „Atemschaukel“ von Herta Müller.
Ich betrachtete die Bücher. „Warum gerade diese drei?“
Die Buchhändlerin kniff die Augen zusammen und kräuselte die Nase, als schien sie zu überlegen, wie ahnungslos ich war. Dann griff sie zu Wagners Roman „Habseligkeiten“. „Das Thema dieses Buches ist die Familiengeschichte des Autors seit dem 19. Jahrhundert“, begann sie. „Es beschreibt den dörflichen Alltag der Banater Schwaben im Laufe eines Jahrhunderts bis heute. Wenn Sie Dorftratsch und Familiengeschichten schätzen und es lieben, wenn dabei im Hintergrund die Weltgeschichte vorüberzieht, dann sind sie bei diesem Buch gut aufgehoben.“
Ich nickte. Nun bemerkte ich doch eine gewisse Härte im sprachlichen Ausdruck, gerade so als würden die Konsonanten im Vergleich zu den Vokalen überbetont.
„Noch besser gefällt mir Eginald Schlattners Roman `Der geköpfte Hahn´“, fuhr die Buchhändlerin fort. „Im Mittelpunkt dieses Buches steht der 23. August 1944, der Tag, als Rumänien im Zweiten Weltkrieg die Seiten wechselte und vom Verbündeten Deutschlands zum Gegner wurde, was für die Deutschen im Land katastrophale Folgen mit sich brachte.“
„Waren Ihre Eltern oder Großeltern auch davon betroffen?“ fragte ich, um gleich hinzuzufügen: „Bitte, halten Sie mich nicht für indiskret, Ich nehme an, Sie sind auch deutschstämmig?“
„Ist schon Ordnung“, gab sie zurück und lächelte. „Fragen sie ruhig. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Ungar. Aber der Vater meiner Mutter wurde nach seiner Rückkehr aus dem Krieg zur Zwangsarbeit in einem Arbeitslager verurteilt“, erklärte die Buchhändlerin. „Davon handelt übrigens das dritte Buch `Atemschaukel´ von Herta Müller. Dieser Roman erzählt vom Hunger und der Not der Deutschen, die nach dem Krieg in russische und rumänische Arbeitslager verschleppt wurden. Nicht zuletzt wegen dieses Romans hat Herta Müller den Nobelpreis für Literatur erhalten.“
„Welches der Bücher würden sie mir empfehlen?“
„Als Einleitung für den Anfang am besten „Habseligkeiten“, das Buch von Richard Wagner. Es ist eigenwillig, aber in ihm kommt die Geschichte der letzten hundert Jahre am besten zum Tragen.
Ich folgte ihrer Empfehlung und erwarb das Buch.
„Sind Sie aus Temeswar?“ fragte ich, als wir an der Kasse standen. Vielleicht sollte ich sie zum Essen einladen. Aber nein, sie trug einen Ehering.
Sie nickte. „Ich stamme aus einem Dorf in der Nähe von Temeswar. Nicht weit von unserem Dorf wurde übrigens Herta Müller geboren.“
„Hier ist man wohl sehr stolz auf Herta Müller?“ mutmaßte ich.
„Teils, teils“, erwiderte die Buchhändlerin. „In ihren Büchern beschreibt sie Rumänen wie Deutsche ja recht kritisch. Außerdem hat sie sich, seitdem sie den Nobelpreis erhalten hat, kaum noch in Temeswar blicken lassen. Bei ihrem letzten Besuch war sie derart von offiziellen Empfängen in Beschlag genommen, dass sie nicht einmal Zeit fand, die Kinder zu empfangen, die etwas für sie vorbereitet hatten.“
„Sie sprechen ein ausgezeichnetes Deutsch“, sagte ich. „Sind sie deutschsprachig aufgewachsen?“
„Ich bin mehrsprachig aufgewachsen. Rumänisch spreche ich im Alltag, Ungarisch mit meinem Vater und richtig Deutsch habe ich auf der deutschen Schule hier in Temeswar gelernt. Ich war sogar als Schülerin für ein Jahr zum Schüleraustausch in Baden- Württemberg.“
„Eine deutsche Schule?“ wunderte ich mich. „Sind denn die Deutschen in Temeswar noch so zahlreich, dass sich ein eigener Schulbetrieb lohnt?“
„Nein, es dürften inzwischen kaum noch drei- oder viertausend Deutschstämmige in Temeswar und Umgebung leben. Die Schule wird hauptsächlich von Rumänen und Ungarn besucht. Viele von ihnen verlassen nach dem Ende ihrer Schulzeit und ihres Studiums das Land.“
„Aber Sie sind geblieben.“
„Natürlich“ erwiderte sie. „Hier ist meine Heimat, hier leben meine Freunde, hier ist meine Familie. Außerdem existiert keine nationale Diskriminierung mehr. Und seitdem wir in der Europäischen Union sind, geht es auch wirtschaftlich aufwärts. Budapest und Wien sind nicht weit.“
Ich nickte und bedankte mich für die Auskünfte. „Schade, dass Sie außerhalb der Spielzeit in der Stadt sind“, sagte die Buchhändlerin zum Abschied. „Sonst könnten Sie eine Vorstellung unseres deutschen Theaters besuchen.“
Draußen schlug sofort wieder die Hitze über mir zusammen. Ich erwarb eine Flasche Mineralwasser, setzte mich in den Schatten und trank sie in einem Zug leer. Die Buchhändlerin blieb mit ihrer Familie also freiwillig im Land, was vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung war. Nicht jeder Rücksiedler war begeistert von dem, was er in Deutschland sah. Aber das war wieder ein anderes Thema.
Ich spazierte, jeglichen Schatten ausnutzend, zurück zum Platz des Sieges. An seinem südlichen Ende hätte ich beinahe die „Gedenkstätte der Helden der Revolution von 1989“ übersehen, ein abstraktes Mahnmal aus Steinblöcken, Inschriften und Skulpturen, vor dem Blumensträuße lagen. Enthusiastische Erinnerungskultur sah anders aus.
Genau hier, im Herzen der Stadt Temeswar, war im Dezember 1989 die rumänische Revolution ausgebrochen. Alles hatte mit dem mutigen Protest eines Pfarrers und der brutale Gewaltanwendung der Polizei begonnen. Trotz persönlicher Lebensgefahr hatte der ungarische Pfarrer Laszlo Tökes im Dezember 1989 in Temeswar öffentlich die politische Unterdrückung, die Verelendung der Bevölkerung und den irrwitzigen Personenkult des kommunistischen Staatschefs kritisiert. Als die Regierung den Pfarrer seines Amtes enthob, hatten die Mitglieder seiner Gemeinde protestiert und eine Mahnwache vor seiner Wohnung eingerichtet.
Aus dieser Mahnwache entwickelten sich immer größere regimekritische Kundgebungen, bis sich am 15. Dezember 1989 über zehntausend Menschen auf dem heutigen „Platz des Sieges“ versammelten und den Rücktritt Ceausescus forderten. Der Diktator ließ diese Demonstranten durch seine Polizeitruppen zusammenschießen. Vierzig Menschen, unter ihnen viele Kinder, starben im Kugelhagel.
Sofort nach diesem Blutbad war in Temeswar der Bürgerkrieg ausgebrochen. Teile der Ordnungskräfte liefen zu den Aufständischen über. Tagelang tobte der Kampf, bis die Anhänger des Regimes aus der Stadt flohen. Am 20. Dezember erklärte ein revolutionäres Komitee Temeswar zur freien Stadt und forderte den Sturz des Diktators.
Der Rest war bekannt. Zwei Tage später griffen die Unruhen auf die Hauptstad Bukarest über. Ceausescu floh zusammen mit seiner Frau in einem Hubschrauber aus der Stadt, wurde auf der Flucht von seinen eigenen Spießgesellen in Târgoviște verhaftet und nach einem Schnellverfahren standrechtlich erschossen.
Inzwischen war der frühe Abend angebrochen. Die Hitze hatte etwas nahgelassen, und die Zahl der Menschen auf den Straßen nahm zu. Musik ertönte aus Restaurants. Gaukler vollführten ihre Kunststücke unter den Arkaden. Ich musterte die Fassaden des Freiheitsplatzes und suchte die Einschusslöcher, die an die Kämpfe des 1989 erinnerten. Obwohl es überall hieß, sie seien noch vorhanden, entdeckte ich sie nicht. Stattdessen zog sich ein wunderbares Abendrot über den Himmel. Vielleicht ein Abglanz des Feuers, in dem der Diktator in der Hölle briet.