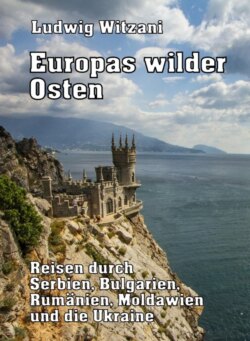Читать книгу Europas wilder Osten - Ludwig Witzani - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORSPIEL:
Große Männer in kleinen Autos Serbische Ouvertüre
ОглавлениеDer Zug fuhr durch weiteres, ebenes Land. Wir passierten, Weinfelder, Sickergruben und kleine Dörfer, in denen die Kirchtürme wie widerspenstige Wächter das Land überragten. Auf den Bahnsteigen roch es nach Kohl. Die Frauen wirkten resolut, und die Grenzbeamten marschierten durch den Zug wie eine Schwadron Texas Rangers. Sie waren kurzgeschoren, völlig ohrenfrei, und freundlich, als wunderten sie sich darüber, dass Mitteleuropäer ihr umstrittenes Land besuchten.
Viele Touristen waren es nicht, die in diesem Zug von Budapest nach Belgrad reisten, denn seien wir ehrlich: Serbien besitzt keinen besonders guten Ruf in Europa. Nicht wenige betrachten die Serben auf dem Balkan als das, was die Deutschen lange Zeit in Europa waren: als die Spitzbuben der Völkergemeinschaft, die immer nur Kriege anzetteln und ihre Nachbarn nicht in Ruhe lassen wollen. Die Balkankriege und der Kosovokonflikt hatten die Serben einmal mehr an den Schandpfahl der Welt genagelt, was mir ungerecht vorkam, weil jeder, der sich auch nur ein wenig mit den Einzelheiten dieser Konflikte beschäftigte, entdecken musste, dass Gut und Böse bei weitem nicht so säuberlich getrennt waren, wie es die öffentliche Meinung vorgab.
Nach dem Grenzübertritt durchquerte der Zug die Wojwodina, einen flachen und extrem fruchtbaren Teil der pannonischen Tiefebene. Raps, Sonnenblumen, Getreide- und Gemüsefelder, soweit das Auge reichte. Im jugoslawischen Vielvölkerstaat war die Wojwodina eine autonome Region Serbiens mit einem hohen ungarischen und kroatischen Bevölkerungsanteil gewesen. Die deutsche Bevölkerung, die als Donauschwaben zum Teil jahrhundertelang in diesem Gebiet ansässig gewesen war, hatte man schon nach dem Zweiten Weltkrieg entrechtet, ermordet oder vertrieben. Auch ein blutiges Kapitel der Weltgeschichte, über das niemand mehr spricht.
Bei Novi Sad wurden Berge sichtbar. Langsam durchfuhr der Zug die zweitgrößte Stadt Serbiens. Unbefestigte, halb überwachsene Uferpfade, Eckensteher, schrottreife Autos vor der Ampel. Nichts deutete heute noch darauf hin, dass in der Gegend von Novi Sad, die Geschichte des Balkans „gekippt“ war. Die österreichischen Truppen unter der Führung von Prinz Eugen hatten 1697 die Türken in der Schlacht von Zenta vernichtend geschlagen und die Donaufestung von Peterwardein gegründet, aus der später die Stadt Neusatz (serbisch Novi Sad) entstehen sollte. Als die Türken fast zwanzig Jahre später noch einmal an der Donau erschienen, wurden sie 1716 in der Schlacht von Peterwardein wieder besiegt. Ihre Zeit war abgelaufen, die türkische Dünung, die fast ein halbes Jahrtausend die christlichen Völker des Balkans überspült hatte, war rückläufig.
Bald lag Novi Sad hinter uns, und der Zug nahm Kurs auf Belgrad. In gemächlicher Geschwindigkeit schlängelte er sich durch eine verbuschte Landschaft mit winzigen Weilern neben Tümpeln und Teichen. Im Regen erreichten wir schließlich die serbische Hauptstadt Belgrad, zuerst die Trabantenstädte von Novi Beograd, dann die Innenstadt.
Es ist immer ein spannender Moment, zum ersten Mal den Bahnhof einer fremden Stadt zu betreten. Es ist wie der erste Händedruck mit einem fremden Menschen, der einen dauerhaften Eindruck hinterlässt. Auf dem Bahnhof von Belgrad spürte ich nichts. Die große Halle lag in Dämmerlicht, vor winzigen Schaltern standen die Leute nach Fahrkarten an. Ohne Probleme gelang es mir, ein Schlafwagenticket für die Weitereise nach Sofia zu reservieren. Dann mietete ich mich ins „Hotel Beograd“ ein, einem alten, abgewohnten sozialistischen Bums, vollkommen überteuert, aber immerhin mit funktionierenden Duschen ausgestattet.
Auf meinen Studentenreisen nach Griechenland war ich auf dem sogenannten „Auto-Put“ immer nur mit dem Bleifuß auf dem Gaspedal an Belgrad vorbeigerauscht. Graue Betonklötze oberhalb der Unterführungen war das einzige gewesen, was ich von Belgrad gesehen hatte. Was mochte diese Stadt zu bieten haben, hatte ich oft gedacht. Diesmal sah ich es, und was ich sah, war wenig erbaulich. In der Umgebung des Bahnhofs standen zweifelhafte Gestalten neben heruntergekommenen Hotels mit unverschämten Preisen. Männer und Frauen besaßen die harten Gesichter von Menschen, die ihr Leben lang gezwungen gewesen waren, unter dem Diktat der Knappheit ihre Ellenbogen einzusetzen. Kein Wunder, dass die Übervorteilung regierte, wohin ich auch kam, im Hotel, beim Getränkeeinkauf, beim Essen, im Taxi und selbst beim Ticketverkauf im Bus, als sei das das Gesetz, das die Menschen weiter brächte.
Als ich am Morgen in meinem kargen Hotelzimmer erwachte und den trüben Himmel über der Stadt erblickte, war alles hässlich: die Betten, die Aussicht, die Tapeten, und selbst der Becher im Bad kam mir verdächtig vor. Wer hatte aus diesem Becherlein vor mir getrunken? Das Wasser unter der Dusche roch penetrant nach Chlor. Nachdem ich mir die Haare gewaschen hatte, saß die Frisur wie ein Helm auf meinem Kopf. Noch nicht einmal den Morgenkaffee konnte ich kochen, weil der Stromanschluss defekt war. Ohne Kaffee am Morgen war ich aber nichts wert, und so nahm die klassische Reiseeröffnungsdepression ihren Lauf. Sie überfällt mich manchmal in der ersten Reisewoche, lässt aber nach einigen Schnäpsen schnell nach.
Beim Frühstück saßen lauter angesäuselte Kerle vor ihrem Schnaps und ihren Würsten. Ich notierte: Die Serben sind ein fleischfressendes Volk und beginnen ihren Verzehr schon am frühen Morgen. Auf der anderen Seite trinken sie gerne einen Slivovitz zu früher Stunde, und das kam mir in meiner derzeitigen Verfassung gerade recht.
Als ich das Hotel verließ, lag ein bleigrauer Himmel über der Stadt. Das einzig Bunte, was es auf der Bahnhofsstraße zu sehen gab waren grelle Pornoplakate, auf denen es dicke serbische Männer und Frauen miteinander trieben. Ich blieb sehen, um zu sehen, wer vor den Pornoplakaten stehenblieb. Niemand. Es schien den Passanten peinlich zu sein.
Fast schon den Rang einer Sehenswürdigkeit besaß das durch die NATO Angriffe zerstörte Gebäude des Verteidigungsministeriums. Treppenhäuser hingen inmitten aufgerissener Fassaden in schwindelnder Höhe halb im Freien, während unter ihnen der Verkehr weiterbrauste.
Einen Anblick besondere Art bot die Sveti Sava, eine orthodoxe Kirche von solchen Ausmaßen, dass sie von fast jedem Punkt der Stadt aus zu sehen war. Das ganze eben erwähnte Verteidigungsministerium hätte spielend unter die Kuppel der Kirche gepasst. An der Spitze eines circa 30 Meter hohen Krans turnten Arbeiter vor irgendeinem Fries herum. Als ich eine Passantin vor der Kirche nach dem Namen des Gotteshauses fragte, wusste sie ihn nicht.
Fünf Minuten von der Sveti Sava Kirche entfernt, befand sich in der Mitte eines Parks und durch kein Hinweisschild erschlossen, das Grab von Josef Brosz, genannt Tito, dem im Westen hochverehrten Nationalkommunisten und jugoslawischen Staatsgründer, nach dem gleichwohl heute kein Hahn mehr kräht. Dabei hatte er für einen kurzen geschichtlichen Moment den Traum der Südslawen vom einheitlichen Staat erfüllt. Allerdings hatte es schon kurz nach seinem Tod ein blutiges Erwachen aus diesem Traum gegeben, und ein gnädiges Geschick hatte es Tito erspart, das Auseinanderbrechen Jugoslawiens miterleben zu müssen. Seine sterblichen Überreste befanden sich in einem weißen Marmorsarg unter einem Baldachin. Eine Gruppe von Veteranen, einer wackliger als der andere, stand salutierend vor dem Sarg, als ich den Grabbezirk betrat.
Nach dem Besuch des Tito-Grabes fuhr ich mit dem Bus in die Innenstadt, die aussah wie die Innenstadt von Castrop-Rauxel, womit ich nichts gegen Castrop-Rauxel gesagt haben möchte. In den Fußgängerzonen dominierte der Kolchosflair sozialistischer Zeiten, bevölkert von Passanten, die mit verschlossenen Gesichtern aneinander vorbeirannten. Die Frauen, denen ich in der Innenstadt begegnete machten einen erschöpften Eindruck. So schwer die Geschicke der Völker auch sein möchten, am härtesten traf es immer die Frauen. Die Männer sahen gesünder aus, geradezu stattlich. Kriegergesichter, breiter Gang, eine Variante europäischer Maskulinität, mit der möglicherweise nicht gut Kirschen essen war. Umso merkwürdiger, dass sie fast alle in winzigen Autos durch die Gegend fuhren - mit Gesichtern, die auszudrücken schienen: „Warte nur ab, bald fahre ich mit einer großen Limousine durch die Stadt.“
Da ich schon einmal da war, besuchte ich die Belgrader Festung, einen seit uralten Zeiten umkämpften Platz am Zusammenfluss von Sava und Donau, über den sich zu diesem Zeitpunkt ein Balkangewitter zusammenzog. So sah ich diesen Ort, um den Germanen, Römer, Hunnen, Ungarn, Serben, Türken und Habsburger gekämpft hatten, vor der Kulisse einer anbrandenden schwarzen Wolkenfront.
Vor dem bald einsetzenden Regenguss floh ich in das militärgeschichtliche Museum, das in der Zitadelle der Festung untergebracht war. In dieser sehenswerten Ausstellung wurde die stürmische Geschichte Serbiens von der Einwanderung bis in die Gegenwart darstellt. Folgte man dem Tenor der Museumsdidaktik, dann hatte das kleine, aber heldenhafte Volk der Serben im letzten Jahrtausend nur ganz wenig zu lachen gehabt. Nach der der kurzen Glanzzeit eines sogenannten „serbischen Großreiches“ im späten Mittelalter begann mit der Schlacht auf dem Amselfeld im Jahre 1389 die lange Nacht der türkischen Fremdherrschaft. Die Blüte des serbischen Adels, die am 28.6.1389 auf dem Amselfeld im heutigen Kosovo gegen die osmanische Übermacht angetreten war, wurde vernichtet, für die Serben eine nationale Katastrophe, die bis auf den heutigen Tag nichts von ihrer Eindringlichkeit verloren hat. In der Folgezeit wurden die Serben aus dem heutigen Kosovo und der Region rund um den Ohridsee nach Norden vertrieben, das heißt, sie verloren ihre angestammte Heimat und mussten mitansehen, wie sich in ihr moslemische Albaner und Türken ausbreiteten. Die Verbissenheit und Härte, mit der die Serben im Kosovokonflikt ihre Restpräsenz in dieser Region verteidigten, muss vor diesem Hintergrund verstanden werden. Kein Wunder, dass sich die Serben als ein „einsames“ Volk begreifen, das von Europa immer wieder im Stich gelassen wurde. Wieso zum Beispiel fand der Aufstand der Serben gegen den Sultan im Jahre 1815 nicht die Unterstützung der mächtigen christlichen Monarchen, die sich zur gleichen Zeit in Wien zum Kongress versammelt hatten? Weil nach den Prinzipien von „Gottesgnadentum“ und „Legitimität“ auch den christlichen Untertanen eines muslimischen Sultans der Aufstand verboten war. So sprach Metternich, und die Folge war, dass Serbien 1815 nur eine partielle Autonomie errang und bis 1878 im osmanischen Reichsverband verbleiben musste. Erst als die Griechen sich 1821 erhoben, zerbrach die religionsübergreifende Legitimitätstheorie der reaktionären europäischen Monarchien. Die verhängnisvolle Rolle, die der chauvinistische serbische Staat bei der Entfesselung des Ersten Weltkrieges gespielt hatte, wurde in dem Museum leider nicht beleuchtet.
So lief ich in dem Museum durch die Jahrhunderte, während draußen der Donner krachte. Am Ende des Rundgangs, am Rande der Gegenwart angekommen, erwartete mich eine große, bunte Karte aus dem Jahre 1999. Sie zeigte die Luftangriffe der NATO, die das Regime des serbischen Präsidenten Milošević zum Rückzug aus dem Kosovo gezwungen hatte. Nun kamen also die Schläge nicht mehr aus dem Süden, sondern aus dem Westen. Derweil verrottete im Hof der Zitadelle das von der NATO erbeutete Kriegsgerät im Regen.
In Sweti Marko, der zweitgrößten Kirche Belgrads, befinden sich zwei Gräber, die die ganze Spannweite der serbischen Geschichte repräsentieren: das Grab von Stefan Dusan und das Grab von Aleksandar Obrenović. In der Regierungszeit Stefan Dusans (1331-1355) erblicken die Serben bis heute das Goldene Zeitalter ihrer Geschichte. Stefan Dusan besiegte die Türken, Bulgaren und Byzantiner, eroberte Mazedonien, große Teile Albaniens, Nordgriechenlands, Bosniens und das damals noch unbedeutende Belgrad. Von seinen Hauptstädten Skopje (heute Mazedonien) und Pizen (heute Kosovo) aus regierte er als mächtigster Herrscher Südosteuropas ein weit ausgedehntes Balkanreich, verkündete eine der ersten Gesetzessammlungen Europas und ließ sich schließlich von einer neu gegründeten serbischen Nationalkirche zum serbischen Zaren (Kaiser) krönen. Wer hätte ahnen können, dass sich der Glanz dieses serbischen Imperiums weniger zwei Generationen nach Stefans Dusans Tod auf dem Amselfeld in nichts auflösen würde?
Das zweite Grab der Markuskirche beherbergt die sterblichen Überreste König Aleksandar Obrenovićs, der im Jahre 1903 mitsamt seiner Gattin von serbischen Offizieren in seinem Palast in Belgrad abgeschlachtet worden war. Dieser Mord, der damals ganz Europa erschütterte, war das Präludium zum Ersten Weltkrieg, denn er bewirkte das Umschwenken Serbiens vom österreichischen ins russische Lager. Einer der Mörder des Königs, der Serbe Dragutin Dimitrijevic, sollte später als „Apis“ die Terrororganisation „Schwarze Hand“ gründen, die 1914 das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand organisierte.
Die Inbrunst der Besucher von Sveti Marko war bestürzend, ganz gleich, ob sie den Heiligenbildern oder den Gräbern galt. Vor manche Ikonen legten die Gläubigen Pflaumen, Birnen und Äpfel ab, ehe sie die Bilder küssten. Fast wie im Orient warfen sich einige Besucher vor den Heiligenbildern zu Boden, ehe sie die Kirche verließen. Manche mochten über solche Gesten die Nase rümpfen. Vielleicht aber zeigte sich in der demütigen Frömmigkeit, die in solchen Gebärden zum Ausdruck kam, auch eine Kraft, die die meisten Menschen des Westens verloren haben, ohne zu wissen, dass ihnen etwas fehlt.
Religionen haben überall in der Welt dazu beigetragen, Nationen zu erhalten. Man denke etwa an die katholischen Polen im Vergleich zu den protestantischen Preußen und den orthodoxen Russen - oder an die katholischen Iren im Vergleich zu den anglikanischen Engländern und den protestantischen Schotten. Sie haben aber auch dazu beigetragen, Völkerschaften zu spalten - am ehesten nachweisbar etwa an der Auseinanderentwicklung der orthodoxen Serben und der katholischen Kroaten, die ansonsten die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Sportarten lieben und die gleichen Suppen löffeln.
Am Abend vor der Weiterreise nach Sofia aß ich serbische Bohnensuppe und Cevapcici und dachte an die vielen entspannten Abende, die wir früher „beim Jugoslawen“ zugebracht hatten. Dieses Jugoslawien gab es nicht mehr. In einer Zeit, in der die maßgeblichen Protagonisten der europäischen Politik auf supranationale Einigungen setzten, hatte die Geschichte des Balkans eine gegenläufige Entwicklung eingeschlagen.
Zehntausend Dinare hatte ich als Geldreserve in meinen Pass gelegt. Mitten in der Nacht, als die serbische Passkontrolle an der serbisch-bulgarischen Grenze unsere Kabinentür pochte, hatte ich das vergessen. Der Zöllner stempelte die Pässe für die Ausreise ab und kassierte die Scheine. Ein wenig Balkan-Kolorit zum Abschied. Ansonsten brachte mich der Nachtzug planmäßig von Belgrad nach Sofia. Als der Morgen graute, durchfuhren wir wildes Karl-May-Land und erreichten schließlich den Bahnhof von Sofia.