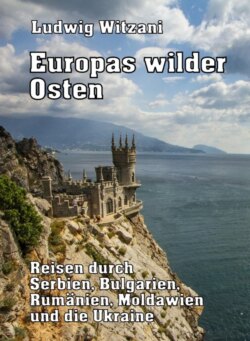Читать книгу Europas wilder Osten - Ludwig Witzani - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der wahre Dracula Mit Vollgas durch die Walachei
ОглавлениеHinter Temeswar öffnete sich die flache Landschaft des südlichen Banat. Die Dörfer bestanden aus Häusern mit Schieferdächern, die sich wie ängstliche Herden um die Kirchtürme zusammendrängten. Dann tauchten am linken und rechten Horizont dunstige Bergketten auf, zwischen denen ich der Walachei entgegenfuhr. Schließlich führte die Straße höher und durchquerte eine dicht bewaldete Mittelgebirgslandschaft mit zahlreichen Teichen und kleinen Flüssen. Einen dieser Flüsse, den Cerna, fuhr ich auf einer schmalen Stichstraße hoch und erreichte das „Herkulesbad“ (Baie Herculane), einen uralten Ort, in dem in der Antike Besucher aus nah und fern in den jod- und bromhaltigen Quellen Linderung von ihren Leiden gesucht hatten. Nach der Antike war der Ort verfallen, um erst im 19. Jahrhundert unter der Herrschaft der österreichischen Habsburger als mondäner Kurort wiederaufzuerstehen.
Da Herkules in den altvorderen Zeiten in den Quellen am Cerna gebadet haben soll, hatten die Österreicher aus dem Metall erbeuteter Türkenkanonen einen massiven bronzenen Herkules geschmiedet, der nun mit seiner Keule wie ein Cerberus den Ortseingang bewachte. Allerdings hatte er nicht viel zu bewachen, denn es war nichts los im Herkulesbad. Außer ein paar armen Schluckern, die schon am frühen Morgen besäuselt im Schatten saßen, waren die Straßen leer. Solange der rumänische Massenwohlstand noch auf sich warten ließ, würde sich Baie Herculane noch gedulden müssen.
Nicht weit von Baie Herculane befand sich eine der großen Naturattraktionen des Balkans, das „Eiserne Tor“ oder weniger martialisch: der Donaudurchbruch, eine fast einhundert Kilometer lange Schlucht, durch die sich die Donau erst in die Linkskurve legt, um dann Ihren Weg nach Osten fortzusetzen. Zu beiden Seiten des Flusses, sowohl auf der serbischen wie auf der rumänischen Seite, türmten sich steile Bergwände hunderte Meter in die Höhe. Der Fluss verengte und weitete sich wie ein gigantischer Blasebalg, ehe er sich bei Drobeta Turnu Severin über einen gewaltigen Stausee in die flachen Ebenen der Walachei ergoss. Während auf der serbischen Seite das Gebiet als Donau-Nationalpark geschützt war, hatte der rumänische Staat jenseits der Stadt Orsova eine Küstenstraße direkt an den Fluss gebaut und für den Fremdenverkehr freigegeben.
Ich fuhr diese Straße einige Stunden herauf und herunter, hielt an Kapellen, Landzungen und Gaststätten und erblickte ein Gesicht der Donau, das ich noch nicht kannte. Die Donau war idyllisch in der Wachau, fast mickrig bei Russe und gewaltig in ihrem Delta, das ich auf dieser Reise noch erleben sollte. Am Eisernen Tor offenbarte sie ihre monumentale Gestalt.
Eine ganze Stunde verbrachte ich am großen Decebalus-Denkmal in der Nähe der Donau. Der Dakerkönig Decebalus nimmt für die Rumänen in etwa die gleiche Position ein wie Arminius der Cherusker für die Deutschen: er wird als nationaler Freiheitskämpfer aus einer Zeit verehrt, in der es die Nation überhaupt noch nicht gab. Den weltweiten Nachruhm heimste sein Gegner ein, der römische Kaiser Trajan (98-117), unter dem das römische Weltreich seine größte Ausdehnung erreichte. In seiner Regierungszeit überschritten die römischen Legionen am Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrhundert die Donau und setzten sich in der heutigen Walachei und in den Karpaten fest. Ihnen stand die von Decebalus geführte Stammeskonföderation der Daker gegenüber, der es zeitweise gelang, die Römer zurückzudrängen. Am Ende erging es Decebalus und seinen Dakern wie Vercingetorix und seinen Galliern.
Decebalus-Monument am Donauknie
Sie wurden besiegt. Der geschlagene König floh in die Berge und nahm sich, um der Gefangenschaft zu entgehen, das Leben.
Ob der tapfere Decebalus genauso ausgesehen hatte, wie ihn das große Felsenporträt an der Donau zeigte, wusste niemand. Er hatte weder Dokumente hinterlassen, noch Münzen ausgegeben, auf denen sein Konterfei der Nachwelt überliefert worden wäre. So entsprang seine Felsen-Physiognomie lediglich der Fantasie eines historisch interessierten rumänischen Sponsors, der dieses Monument auf eigene Kosten in den Berg hatte meißeln lassen. Der über dreißig Meter große Riesenkopf besaß tote Augen, einen Rauschebart und blickte wie ein dakischer Rübezahl auf die Touristen herab, die ihn vom Parkplatz aus bewunderten. Besonders authentisch war das natürlich nicht, auf der anderen Seite erinnerte das Monument die Besucher an die lateinischen Anfänge Rumäniens, anderthalbtausend Jahre, bevor es Rumänien überhaupt gab.
Ich schlief in Drobeta Turnu Severin, einer Stadt im hintersten Winkel Rumäniens, die Einiges zu bieten hatte. Zunächst einmal ihren Namen, in dem sich die geschichtlichen Bezugspunkte der Stadt vereinten, denn „Drobeta“ hieß der Ort in der Antike, und „Turnu Severin“ nannte man die Stadt im Mittelalter zu Ehren des heiligen Severin von Noricum. Eine nachgebaute römische Brücke in Drobeta Turnu Severin erinnerte an Kaiser Trajan, eine Kanone gemahnte an die wilden Zeiten der Freiheitskämpfe, und die herrschaftlichen Häuserzeilen in der Innenstadt stammten aus der rumänischen Belle Epoque, als vor dem Ersten Weltkrieg die Donau als Schifffahrtsweg immer mehr an Bedeutung gewann.
Wie kleine Fettaugen auf der Suppe der Gegenwart und unberührt von jeder Geschichte tummelten sich die Angehörigen der jungen Generation in den angesagten Cafés des Stadtzentrums. Die Jungs begrüßen sich mit Brustrammen und Gimme-Five, und die Mädchen waren herausgeputzt wie kleine Rosen kurz vor der Blüte. Ihnen gegenüber fielen die Erwachsenen etwas ab, sie saßen gebannt vor großen Flachbildschirmen in den Wirtshäusern und verfolgten ein Fußballspiel.
Leider erhielt ich in Drobeta Turnu Severin nur ein Hotelzimmer ohne Aircondition. Das war angesichts der fast tropischen Temperaturen eine Herausforderung, die ich ohne meine Indien-Erfahrungen nicht bewältigt hätte. Da ich das Fenster wegen der aggressiven Donaumücken nicht öffnen konnte, duschte ich mich eiskalt und gründlich und legte mich nass und nackt ins Bett. Zu meiner Freude funktionierte diese Methode schon beim zweiten Versuch, und ich schlief fünf Stunden am Stück. Gegen 4:00 Uhr in der Frühe wachte ich auf, öffnete die Zimmertüre zum Flur, um dann noch einmal zwei Stunden weiterzuschlafen. So wurde es schließlich 6:00 Uhr als ich aufstand, um mir den ersten Morgenkaffee zu brühen. Als ich am Fenster stand, sah ich, dass die Menschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite auch aufgestanden waren. Gemeinsam begannen wir einen weiteren glutheißen Sommertag.
Hinter Drobeta Turnu Severin begann die Walachei, eine Landschaft, die im mitteleuropäischen Sprachgebrauch ganz unabhängig von ihrer konkreten Geografie zum Inbegriff eines weit entfernten und absolut eintönigen Landes geworden ist. In Wolfgang Hermdorfs Jugendbuch „Tschick“ war die Reise zum „Onkel in die Walachei“ gleichbedeutend mit einer Reise ins Nirgendwo. Das war natürlich ungerecht, denn eintönig war die Walachei ganz sicher nicht. Hinter Drobeta Turnu Severin ging es erst einmal eine sanft gewellte Hügellandschaft hoch, dann eine Zeitlang geradeaus, bis sich die Straße wieder auf eine Ebene absenkte, die aussah wie der verbrannte Boden einer Bratpfanne auf einem voll aufgedrehten Herd. Alles war schwarz und verkohlt. Scharfe Schatten verschluckten die Fuhrwerke, die mit Holz und Heu beladen, den Verkehr behinderten. Dann wurde es noch trister. Ich durchfuhr eine Mondlandschaft mit Industrieabfall der übelsten Sorte: oxidiert, explodiert, zerschlagen passierte ich ausgemusterte Technik auf dem Rückweg in die Natur.
Craiova, die Hauptstadt der rumänischen Bierproduktion kündigte sich bereits lange vor der Stadteinfahrt durch Strommasten und Elektrizitätswerke an. Eine futuristische Überführung führte auf eine Umgehungsstraße, auf der ich an Craiova vorüberfuhr. Nun war das 120 Kilometer entfernte Pitești das nächste Ziel. Schnurgerade zog sich die gut ausgebaute Straße durch flache Landschaften. Links und rechts schossen rumänische Fahrzeuge an mir vorüber, und selbst popelige Kleinwagen setzten zu Überholmanövern an. Manchmal, wenn ich meinerseits überholte, merkte ich allerdings, dass der Rumäne zwar ein geborener Überholer war, selbst aber nicht so gerne überholt werden wollte. Er gab dann Gas und verfolgte einen, als hätte man ihm die Ehre gestohlen. Hinzu kam, dass der rumänische Autofahrer am liebsten in der Mitte der Fahrbahn fuhr, und das gleich aus mehreren Gründen. Erstens hatte das etwas Herrschaftliches, denn schließlich kam der Kaiser von China auch immer nur durch die Mitte, zweitens war es fahrzeugschonender, denn die wenigsten Schlaglöcher befanden sich in der Mitte der Fahrbahn, und drittens war es auch sicherer, weil man nie wusste, ob aus den Höfen am Straßenrand plötzlich ein Hund, eine Kuh oder ein Kind hervorpreschen würde.
Bei Slatina überquerte ich den Oil, einen an sich recht bedeutungslosen Fluss, der die „kleine“ von der „großen“ Walachei trennt. Dazu fiel mir das kleine und das große Latinum ein, mit dem ich mich als Schüler hatte herumschlagen müssen. Während das kleine Latinum keine Sache gewesen war, hatte ich mich mit dem großen Latinum ganz schön herumquälen müssen. Bei der kleinen und der großen Walachei verhielt es sich anders. Hier waren „groß“ und „klein“ keine Qualitäts- sondern reine Größenbegriffe. Westlich des Oil, woher ich kam, befand sich die kleine Walachei, östlich, also da, wohin ich wollte, die große Walachei. Einen äußerlich erkennbaren Unterschied im Landschaftsbild gab es nicht.
Gegen Mittag hatte ich bereits Pitești in der großen Walachei erreicht. Lohnte sich ein Stopp in dieser Stadt? Nein entschied ich, es war viel zu heiß und viel zu flach. Das einzige, womit sich die Stadt Pitești in die Annalen der Geschichte eingetragen hatte, war ein spezielles Trainingsprogramm des rumänischen Geheimdienstes Securitate, mit dem Inhaftierten beigebracht wurde, sich gegenseitig mit gutem Gewissen zu foltern. Aber auch das war gottlob Geschichte.
Apropos Geschichte. Wie verhielt es sich überhaupt mit der Geschichte der Walachei? Ganz ähnlich wie mit vielen Regionen zwischen Ungarn, Serbien und dem Osmanischen Reich. Irgendwann entstanden Machtzentren wie Fettflecke auf dem großen Teppich der Lokalgeschichte, verschwanden wieder oder breiteten sich aus, bis sie eine gewisse Stabilität erreichten. So war es auch mit der Walachei gewesen, einer Region zwischen Donau und Karpaten, die im 14. Jhdt. von einem örtlichen Haudrauf mit Namen Basarab I gegründet und gegen eine ungarische Intervention verteidigt wurde. Seitdem herrschten die Nachfolger Basarabs I als Wojwoden (Fürsten oder Herzöge) jahrhundertelang in der Walachei, von Mord und Totschlag in der eigenen Familie ebenso gebeutelt wie vom Kampf gegen den einheimischen Adel (die Bojaren) oder die Türken.
Jenseits von Pitești bog ich links von der Bukarester Autobahn ab, um dem berühmtesten Fürsten der Walachei einen Besuch abzustatten: ich fuhr nach Târgoviște, der Hauptstadt von Vlad III, genannt „Draculea“, dem historischen Vorbild des Dracula-Mythos.
Târgoviște, die ehemalige Hauptstadt der Walachei, war eine gemütliche Kleinstadt, der man ihre stürmische Geschichte nicht ansah. In ihrem Zentrum befand sich der sogenannte „Prinzenpalast“, die Residenz der walachischen Fürsten zwischen dem 15, und 17. Jahrhundert. Von diesem Fürstenpalast waren außer seinen Ruinen nur noch die Maria-Himmelfahrtskirche und der Chindiei Turm erhalten.
Vlad III, genannt „Țepeș“ („Pfähler“), hatte hier als Wojowde der Walachei zwischen 1456 bis 1462 regiert und eine wahre Blutspur hinterlassen. Der Sachbuchautor Ralf-Peter Märtin hatte in seinem Buch „Dracula. Das Leben des Fürsten Vlad Țepeș“ eine spannende Biografie des Pfähler-Wojwoden vorgelegt. Aus ihm stammen die Einzelheiten, die ich im Folgenden als ein Drama in drei Akten schildere.
Vlad III war als Sohn des walachischen Wojwoden Vlad II „Dracul“ in stürmischen Zeiten geboren worden. Die Türken standen an den Grenzen, und Vlad II war gezwungen, seinen Sohn Vlad (III) als Geisel an die Türken auszuliefern. Möglich, dass die Auspeitschungen, die der junge Prinz bei den Türken zu erleiden hatte, zur Ausformung seines psychopathische Charakters beigetrugen. Als Prinz Vlad gerade 17 Jahre alt war, kam es noch dicker. Sein Vater Vlad II wurde von Bojaren bestialisch ermordet. Seinem älteren Bruder Mircea hatte man bei dieser Gelegenheit mit glühendem Eisen geblendet, um ihn anschließend lebendig zu begraben. Der junge Vlad floh zu den Ungarn, die ihn militärisch unterstützten und 1456 als Wojwoden in die Walachei zurückführten. Ende des ersten Aktes.
Ein schwer gestörter junger Mann saß nun an den Schalthebeln der Macht und zögerte nicht, seine Neigungen auszuleben. An den Bojaren, die seinen Vater und seinen Bruder ermordet hatten, erprobte er eine Hinrichtungsart, die zu seinem Markenzeichen werden sollte: er ließ sie öffentlich pfählen, was nach dem damaligen Verständnis als der mit Abstand grausamste und schändlichste Tod galt. Gepfählt wurden aufständische Bürger aus Kronstadt, „unkeusche Frauenzimmer“, Kleinkriminelle oder Steuerschuldner. Wer es versäumte, den Hut vor dem Wojwoden zu ziehen, dem ließ er den Hut in den Kopf nageln. Die türkische Gesandtschaft, die in Tarogviste erschien, um den vereinbarten Tribut einzutreiben, wurde umgebracht. Der folgende Türkenkrieg machte Vlad III zum Schrecken der Osmanen. Gefangenen moslemischen Soldaten ließ er vor dem Pfählen die Augen ausstechen, damit sie im Paradies die verheißenen Jungfrauen nicht sehen konnten. Sultan Mehmet II, der Eroberer Konstantinopels und selbst kein Kind von Traurigkeit, musste nach einem erfolglosen Feldzug mit seinen demoralisierten Truppen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ende des zweiten Aktes.
Auf dem Zenit folgte der Absturz. 1462 wurde Vlad III von den Bojaren gestürzt, weil diese eine neue, noch größere Türkeninvasion befürchteten. Vlad III floh wieder nach Ungarn, um Hilfe zu holen, wurde diesmal aber von König Matthias Cornivius inhaftiert und wegen diverser Verbrechen 12 Jahr lang eingekerkert. Erst 1474 wurde Vlad III wieder freigelassen und in die Walachei zurückgeschickt, um die Türken zu bekämpfen. Dort fiel er, ob er ermordet oder auf der Flucht erschlagen, war unbekannt. Sein Kopf wurde in Honig eingelegt und als Trophäe dem Sultan nach Konstantinopel geschickt. Ende des dritten Aktes.
Fast noch bizarrer als die Geschichte des pfählenden Wojwoden sollte sein Nachruhm werden, denn das Volk erinnerte sich an Vlad III mit einer Mischung aus Grauen und Bewunderung - nicht zuletzt, weil er unter den Bojaren mächtig aufgeräumt hatte und mitunter die Güter seiner Opfer unter die Armen verteilen ließ. Auf der anderen Seite wurde auch seine unerhörte Grausamkeit nicht vergessen. Das Gedenken an die Blutexzesse Vlads III vermischte sich mit den Schauergeschichten alter siebenbürger Chroniken. Sie berichteten von einem blutsaugenden Vampir, der in den Tiefen der Karpaten sein Unwesen trieb und nur dadurch getötet werden konnte, dass man einen Pfahl in sein Herz trieb. Die etymologische Verbindung zu dem Namen „Dracula“ ergab sich aus einer Reihe von Missverständnissen, die mit Vlads III Vater Vlad II zusammenhingen. Vlad II hatte den Beinnamen „Dracul“ getragen, weil er Mitglied des Drachenordens gewesen war. Aus diesem Grund wurde sein Sohn Vlad III Țepeș auch als „Draculea“, als Sohn des Drachen, bezeichnet.
Von diesem pseudohistorischem Mischmasch, in dem sich eine konkrete geschichtliche Person, nämlich Vlad III, der Beiname seines Vaters Vlad II und die Schauermär einer siebenbürger Chronik sich zur Legende eines blutsaufenden Vampirs verdichtet hatten, erfuhr im Jahre 1890 der irische Schriftseller Bram Stoker. Sieben Jahre später überraschte Bram Stoker die Welt mit seinem Vampirroman „Dracula“. In einer Zeit, in der in Mitteleuropa die Straßenbeleuchtung die Dunkelheit langsam aus dem Innern der Städte vertrieb, beschwor der Roman vormoderne Urängste und lokalisierte in düstere Örtlichkeiten in „Transylvanien“ am Rand der zivilisierten europäischen Welt. Bram Stoker selbst war niemals in Rumänien gewesen und war mit der Geschichte Vlads III nicht sonderlich gut vertraut. Der Einbildungskraft späterer Zeiten blieb es vorbehalten, seine Romanfigur mit der geschichtlichen Gestalt des walachischen Wojwoden so stark zu verbinden, dass Vlad III und die blutsaugende Vampirfiktion zu einer Einheit verschmolzen.
Von der realen Geschichte Vlad des Pfählers war in Târgoviște nicht mehr viel zu sehen, wenn man einmal vom Chindiei Turm absah, den Vlad III als Wehr- und Aussichtsturm hinter seinem Palast hatte errichten lassen. Er war 27 Meter hoch und informierte in einem seiner Stockwerke über das Leben des Walachenfürsten - leider auf Rumänisch, so dass sich der auswärtige Besucher auf die rein visuellen Eindrücke beschränken musste. In Erinnerung geblieben ist mir ein Portraitgemälde aus späteren Zeiten, auf dem Vlad III den Besucher mit eiskalten Reptilienaugen anblickte. Ob er wirklich so ausgesehen hatte, war natürlich nicht ausgemacht.
Ein halbes Jahrtausend verging, ehe noch einmal das Scheinwerferlicht der Geschichte auf Târgoviște fiel. Auf der Flucht vor der Revolution war der rumänische Diktator Ceausescu am 22.12.1989 von seinen ehemaligen Spießgesellen in Târgoviște gefangengenommen worden. Dass Ceausescu ausgerechnet in der Stadt des Pfählers gefangen genommen wurde, besaß Hintersinn, denn der Diktator hatte in seinen späten Jahren einen regelrechten Vlad Țepeș Kult betrieben. Immerhin wurde er von dem Schnellgericht, das am 25.12.1989 in der Militärkaserne von Târgoviște zusammentrat, nicht zur Pfählung sondern mitsamt seiner Gattin zur sofortigen Erschießung verurteilt. Ein makabres Video, auf dem zu sehen war, wie das Ehepaar Ceuasescu laut schreiend gegen das Urteil protestierte, ging damals um die Welt. Vor drei Tagen hatten sie noch die absolute Macht besessen, nun waren sie des Todes.
Manch einer mag damals Mitleid mit den Verurteilten gehabt und die zigtausendfachen Morde vergessen haben, derer sich Ceausescu schuldig gemacht hatte. Aber in seinem Fall hatte das Schicksal eine Ausnahme gemacht. Ähnlich wie Gaddafi wurde Ceausescu von seinen Untaten eingeholt, bevor seine Zeit vorüber war. Am eigenen Leib erlebte der Diktator plötzlich ein Gerichtsverfahren, wie es unter seiner Herrschaft Zehntausenden zuteil geworden war: ein Verfahren, bei dem das Urteil von vorne herein feststand und gegen das es keine Berufung gab. Elena Ceausescus, die Gattin des Diktators, die ein gutes Leben auf den Knochen des Volkes gelebt hatte, folgte ihrem Gatten in den Tod. Beurteilen mag das jeder, wie er möchte.
Heute war der Zutritt zur Garnison von Târgoviște verboten. Selbst das Fotografieren des Gebäudes war untersagt, woran sich aber niemand hielt. Als ich das Gebäude besuchte, stand eine halbes Dutzend rumänischer Touristen vor dem Gebäude und fotografierte munter drauf los, ohne von den Wachmannschaften gehindert zu werden.