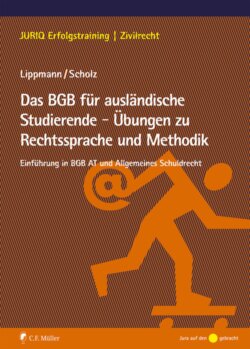Читать книгу Das BGB für ausländische Studierende - Übungen zu Rechtssprache und Methodik - Lydia Scholz - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Übung Auslegungsmethoden, Verweis und Analogie
Оглавление17
a) Lesen Sie folgende Texte zu den Auslegungsmethoden, dem Verweis und der Analogie.
Die Auslegungsmethoden
Da die Normen des BGB abstrakt formuliert sind, müssen sie in den meisten Fällen interpretiert (= ausgelegt) werden. Die Methoden, die dabei anzuwenden sind, heißen Auslegungsmethoden.
Manchmal findet sich im BGB eine Definition eines solchen abstrakten bzw. unbestimmten Rechtsbegriffs. Eine Definition dieser Art heißt Legaldefinition. In vielen Normen des BGB findet sich beispielsweise das Wort Sache. Dieser Begriff wird in § 90 BGB legaldefiniert. In den meisten Fällen gibt es jedoch keine Legaldefinition. Dann muss man diese Wörter interpretieren, um zu verstehen, was sie bedeuten sollen.
Beispiel
§ 823 Abs. 1 BGB
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Hier stellt sich die Frage, was ein sonstiges Recht ist. Eine Legaldefinition hierfür gibt es nicht. Der Begriff muss daher interpretiert werden.
Hierzu gibt es verschiedene juristische Methoden, die Auslegungsmethoden heißen.
Die folgende Tabelle enthält sechs Auslegungsmethoden. Am häufigsten wird der Studierende die Wortlautauslegung, die teleologische Auslegung und die systematische Auslegung anwenden, um eine Norm des BGB zu interpretieren. Man beginnt immer mit der Wortlautauslegung.
| Auslegungsmethode | Erklärung |
|---|---|
| Wortlautauslegung / grammatikalische Auslegung | Es wird das Wort nach seinem Sinn / seiner Semantik interpretiert. Man beginnt immer mit der Wortlautauslegung. Oft sind zur Bestimmung des Wortsinns die weiteren Auslegungsmethoden erforderlich. Diese Auslegungsmethoden dürfen jedoch nicht zu dem Ergebnis führen, dass die Interpretation außerhalb des Wortsinns liegt. |
| Teleologische Auslegung | Man stellt den Sinn und Zweck der Norm fest (also die Aufgabe, die die Norm hat) und interpretiert die Wörter in der Norm so, dass der Sinn und Zweck erreicht werden kann. |
| Systematische Auslegung | Es wird überprüft, wo eine Norm steht. Man berücksichtigt, in welchem Zusammenhang eine Norm zu anderen Normen steht, welche Wertungswidersprüche zu anderen Normen bestehen und welchen Regelungszusammenhang sie selbst für sich hat. |
| Historische Auslegung | Man schaut sich an, in welchem historischen Kontext die Norm entstanden ist. |
| Genetische Auslegung | Hier wird die Entstehungsgeschichte der Norm berücksichtigt. Man benötigt dafür die Dokumente der Staatsorgane, die am Rechtssetzungsverfahren beteiligt waren. In Deutschland nennt man diese Materialien Motive des BGB. Sie sind frei zugänglich. |
| Europarechtskonforme Auslegung | Da Deutschland ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, müssen alle Normen des BGB so ausgelegt werden, dass sie mit dem Europarecht im Einklang stehen. |
Es kann sein, dass eine Auslegungsmethode dazu führt, dass eine größtmögliche Zahl von Lebenssachverhalten erfasst wird, und eine andere Auslegungsmethode dazu führt, dass eine kleinere Zahl von Lebenssachverhalten erfasst wird. Wenn viele Lebenssachverhalte erfasst werden, sagt man, dass die Norm weit ausgelegt wurde. Wenn wenige Lebenssachverhalte erfasst werden, sagt man, dass die Norm eng ausgelegt wurde. Ausnahmevorschriften sind generell eng auszulegen, weil der Gesetzgeber schon durch den Ausnahmecharakter den Auslegungsspielraum eingeengt hat.
Beispiel
Nach der Wortlautauslegung und auch der teleologischen Auslegung kann ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB jedes Recht sein. Legt man die Norm hingegen systematisch aus, muss man ihren Regelungszusammenhang betrachten. Man schaut sich die anderen genannten Rechte wie Leben, Körper, Gesundheit usw. an und stellt fest, dass diese Rechte sogenannte absolute Rechte sind. Nach der systematischen Auslegung muss ein sonstiges Recht im Sinne der Norm daher ebenfalls ein absolutes Recht sein. Aus diesem Grund ist der Besitz als absolutes Recht ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB.
18
Die Gesetzesanalogie
Mit einer Analogie wird eine Lücke im Gesetz geschlossen. Eine Analogie bedeutet, dass die Rechtsfolge einer Norm auf einen Fall entsprechend angewendet wird, selbst wenn nicht alle Tatbestandsvoraussetzungen der Norm erfüllt sind. Es kommt vor, dass eine Situation nicht von den Normen des BGB erfasst ist, auch wenn man die Normen weit auslegt. Man sagt, dass es dann eine Regelungslücke gibt. Der Gesetzgeber hat diese bestimmte Situation nicht geregelt. Sofern der Gesetzgeber das nicht beabsichtigt und nicht geplant hat (die Regelungslücke also planwidrig ist), können andere vergleichbare Normen analog angewendet werden, wenn die Interessenlage gebietet, dass die Lücke geschlossen wird.
19
Der Verweis
Schließlich kann eine Norm auch auf eine andere Norm hinweisen. Dies wird Verweis genannt. Wenn auf die gesamte andere Norm verwiesen wird, also auf deren Tatbestand und die Rechtsfolge, so handelt es sich um eine sogenannte Rechtsgrundverweisung. Wenn nur auf die Rechtsfolge verwiesen wird, so liegt eine Rechtsfolgenverweisung vor.
b) Beantworten Sie folgende Fragen zu den Texten.
(1) Was ist eine Legaldefinition?
(2) Wann spricht man davon, dass eine Norm eng ausgelegt wird?
(3) Was versteht man unter einer planwidrigen Regelungslücke?
(4) Welche Auslegungsmethode wendet man immer zuerst an?
(5) Bei welcher Auslegungsmethode berücksichtigt man den Sinn und Zweck der Norm?
(6) Was ist eine Rechtsgrundverweisung?
(7) Ist eine Interpretation entgegen dem Wortsinn möglich?
20
c) Üben Sie nun die Auslegungsmethoden, den Verweis und die Analogie. Lesen Sie hierzu zunächst das folgende fiktive Gesetz.
Das Flüssigkeitshaushaltsgesetz von Trockenland
In Trockenland ist das Wasser knapp geworden. Es gibt nur eine einzige Wasserstelle, an der die Tiere trinken können. Das Parlament von Trockenland hat daher das folgende Flüssigkeitshaushaltsgesetz erlassen, das sicherstellen soll, dass die Tiere, die in der Wildnis leben und um die sich kein Mensch kümmert, Zugang zur Wasserstelle haben.
Flüssigkeitshaushaltsgesetzbuch (FHG) Allgemeiner Teil
§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt den Zugang zur Wasserstelle.
§ 2 Tiere
(1) Tiere im Sinne dieses Gesetzes sind nur wilde Tiere.
(2) Haustiere und Tiere, die in Begleitung eines Menschen sind, sind keine wilden Tiere.
§ 3 Zugang zur Wasserstelle
Die Tiere haben nach den Vorschriften dieses Gesetzes Zugang zur Wasserstelle.
§ 4 Verwaltung der Wasserstelle
Die Wasserstelle wird vom Krokodil verwaltet.
Besonderer Teil § 5 Säugetiere
(1) Kamele dürfen jeden zehnten Tag an der Wasserstelle trinken.
(2) Alle übrigen Säugetiere dürfen einmal am Tag an der Wasserstelle trinken.
§ 6 Reptilien
Auf Reptilien finden die für Säugetiere geltenden Vorschriften Anwendung.
§ 7 Falsche Angaben
Macht ein Tier falsche Angaben zu seiner Gattung, um dadurch häufiger an der Wasserstelle trinken zu dürfen, so darf es einen Monat lang nicht an der Wasserstelle trinken.
d) Vervollständigen Sie folgende Sätze mit den Wörtern bzw. Wortgruppen aus dem Kasten. Achten Sie auf die richtige Endung am Adjektiv und konjugieren Sie die Verben.
| Regelungslücke – teleologische Auslegung – weit – grammatikalische Auslegung – verweisen – systematische Auslegung – planwidrig – Interessenlage – legaldefiniert – Sinn und Zweck – eng – analog |
In § 2 FHG ist der Begriff des Tieres . . . . . . . . . . . . . . .(1).
Nach der . . . . . . . . . . . . . . .(2) sind Haustiere solche Tiere, die in einem Haus leben.
. . . . . . . . . . . . . . .(3) des § 2 Abs. 2 FHG ist jedoch, solche Tiere von der Wasserstelle auszuschließen, um die sich ein Mensch kümmert und die daher von einem Menschen Wasser bekommen. Nach der . . . . . . . . . . . . . . .(4) können Haustiere deshalb nur solche Tiere sein, die sich mit dem Wissen und dem Willen der Bewohner eines Hauses dort aufhalten.
Legt man den Begriff des Haustieres . . . . . . . . . . . . . . .(5) aus, so sind alle Tiere erfasst, die in einem Haus leben. Legt man hingegen den Begriff des Haustieres . . . . . . . . . . . . . . .(6) aus, so erfasst er nur solche Tiere, die mit dem Wissen und Willen der Hausbewohner dort leben.
Nach einer . . . . . . . . . . . . . . .(7) sind von § 5 FHG nur solche Säugetiere erfasst, die wilde Tiere sind.
§ 6 FHG . . . . . . . . . . . . . . .(8) auf § 5 FHG.
§ 7 FHG gilt nur für den Fall, dass ein Tier falsche Angaben zu seiner Gattung gemacht hat, nicht aber für den Fall, dass ein Tier den Irrtum eines anderen über seine Gattung aufrechterhält. Es besteht insofern eine . . . . . . . . . . . . . . .(9). Das Aufrechterhalten eines Irrtums kann mit einer Falschangabe verglichen werden. Daher besteht beim Aufrechterhalten eines Irrtums eine zu § 7 FHG vergleichbare . . . . . . . . . . . . . . .(10). Es kann davon ausgegangen werden, dass das Parlament von Trockenland nicht beabsichtigt hatte, dass das Aufrechterhalten eines Irrtums von § 7 FHG nicht erfasst ist. Die Regelungslücke ist demzufolge . . . . . . . . . . . . . . .(11). Damit sind die Voraussetzungen einer Gesetzesanalogie erfüllt. § 7 FHG kann daher auf das Aufrechterhalten eines Irrtums . . . . . . . . . . . . . . .(12) angewendet werden.