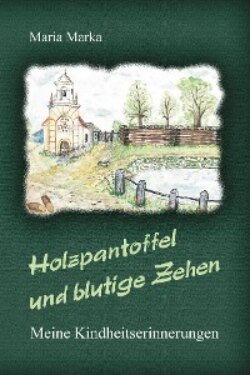Читать книгу Holzpantoffel und blutige Zehen - Maria Marka - Страница 10
Marias Kindheit – in der „Schmied“ und im „Deitschnhof (Swina)“
ОглавлениеNoch kann ich nicht sitzen und muss getragen werden, sofern ich nicht irgendwo liege. Auch Hansens Frau nahm mich manchmal auf. Einmal stand sie mit mir unter dem Hoftor und trug mich unter dem Arm – mit dem Kopf nach hinten! Sie sprach mit der Nachbarin. Die sagte zu ihr: „Nimm halt das Kinnerl ordentlich auf den Arm, nicht wie ein Packl Stroh.“ „Für einen Bankert taugt’s !“ war die Antwort. Meine Mama, jetzt 20 Jahre alt, hat das gehört. Am Sonntag erzählte sie es ihrer zukünftigen Schwiegermutter in Swina. Und am Montag stand diese in Techlowitz vor der Haustür und verlangte die Herausgabe ihres Enkelkindes. Zwar hatte sie selbst sechs Kinder, vier davon noch im Schulalter, mein Vater war mit zweiundzwanzig Jahren der Älteste, aber einen Bankert ließ sie aus ihrem Enkelkind nicht machen. Sie nahm mich mit – und so kam ich zu meiner Großmutter. Meine Mutter konnte erst später nachziehen als eine Wohnung beim „Deitschen“ gefunden war und meine Eltern heiraten konnten. Nun hieß ich nicht mehr Maria-Anna Deimling, sondern Maria-Anna Gebert. Aber keiner nannte mich so. Ich war einfach das Schmied-Marerl. Das kam daher, weil meine Großeltern die aufgelassene Dorfschmiede zum Wohnhaus umgebaut hatten. Lange vor meiner Zeit.
Ich hatte zwar immer noch keinen Kinderwagen, aber dafür einen Haufen Leute um mich. Die Großeltern, meine Onkel und Tanten, wenn auch Tante Emmi nur sieben Jahre älter war und mit Puppen spielte. Swina und die „Schmied“ bedeuten mir noch heute Kinderzeit.
Wenn ich „Heimat“ denke, denke ich an „Zwinger“ (den Deutschen passte das tschechische „Swina“ nicht so recht in den Mund). Zu meiner und auch schon zu meines Vaters Zeit hat in Zwinger keiner tschechisch gesprochen, aber zweifellos war das ganz früher anders. Die Hussitenkriege hatten einst das Land verwüstet, man denke nur an das verschwundene Dörfchen Doubrawa, von dem nichts als das Petruskirchlein übrig blieb und der Friedhof, auf dem drei Dörfer ihre Toten begruben. Auch meine Gebert-Großmutter liegt in dieser Erde.
Der Silber- und Bleibergbau um Mies herum zog mit kaiserlichem Wohlwollen viele Deutsche ins Land. Als meines Vaters Vorfahren sich in Zwinger einkauften, bekam der Hof den Namen „Beim Deutschen“ und dabei blieb es bis zur Aussiedlung 1945.
Der „alte Deitsch“, mein Urgroßvater, hatte zwei Söhne und eine Tochter. Der älteste bekam den Hof, mein Großvater Anton Gebert wurde ausgezahlt und baute die „Schmiede“ aus. Die Tochter heiratete einen Eisenbahner und zog in die Stadt. Sie war meine Firmpatin und schenkte mir ein vergoldetes Halskettchen mit Kreuz, das ich leider verlor. Ich hatte auf eine Armbanduhr gehofft, aber so viel Geld hatte sie wahrscheinlich nicht. Armbanduhren waren 1934 noch recht teuer. Ich habe diese Großtante selten gesehen. Meine Erinnerung beschränkt sich darauf, dass sie kinderlos blieb und ständig an Kopfweh litt. Deswegen trug sie oft zwei Kopftücher übereinander. Wind vertrug sie gar nicht. Ich vermute, diese Empfindlichkeit gegen Wind und Kälte habe ich von ihr geerbt. Einige Zeit ungeschützt dem kalten Wind ausgesetzt und das ganz Gesicht tut mir weh. Die Großtante wurde als einzige unserer Familie 1945 nicht ausgesiedelt, weil sie als Eisenbahnerwitwe vom Staat eine Rente bekam. Eisenbahner konnte nach 1918 (Gründung der Tschechei) nur werden, wer für die Tschechen optierte. Das hatte ihr Mann wohl getan. Sie starb in der Altenpflegeanstalt in Wiesengrund (Dobrzan) als wir schon längst in Bayern lebten.
Die Schmied heute, Aufnahme: Karl Marka
Swina – Dorfplatz mit Kapelle 1937- Václav Baxa et. Al. 2004
Kirche in Swina heute, Aufnahme: Karl Marka
Der zweite Sohn vom „alten Deitsch“ mit Namen Anton Gebert, das ist mein Großvater. Der wohnte also mit meiner Großmutter und den sechs Kindern in der „Schmiede“ mitten am Dorfplatz, nur durch eine Straße vom Dorfteich getrennt. Genau gegenüber stand der „Deitschnhof“ am runden Dorfplatz. Über den Dorfteich hinweg hatten sich also immer alle im Auge, die ganze Verwandtschaft.
Das mit der Schmiede muss erklärt werden. Großvater Anton war ja Zimmermann, nicht Schmied. Als die Schmiede abgebrannt war und der alte Schmied wegging, kaufte mein Großvater mit dem eingebrachten Heiratsgut meiner Großmutter die Brandstätte und baute sie zu Wohnhaus, Stall und Scheune um. Es gab nur eine große Wohnküche und eine noch etwas größere „gute Stube“, die auch als Schlafstube diente. Auch auf dem Boden darüber standen Betten, neben den Getreideschütten, dem Mehlkasten und – über den Stall hin gelagert, ein Teil des Winterheus. Für einen regelrechten Bauernhof war nicht genügend Platz. So wurde ein leer stehendes, strohgedecktes Häuschen mit Höfchen hinter der Dorfkapelle dazu gekauft. Um in dieses „Watzka“-Häusl, Watzka war der frühere Besitzer des Hauses, zu gelangen, musste man schräg über die Dorfstraße gehen. Dort lagerten Brennholz und Geräte, da waren der Schweinestall und das Holzhäuschen mit Herz in der Tür für die Familie, deren Mitglieder mit ihrem Bedürfnis quer über die Dorfstraße und an der Kapelle vorbeilaufen mussten.
Zumindest bei Tage. Für die Nacht stand ein zugedeckter Kübel im Vorhaus, denn die Nachtwanderungen wären, vor allem zur Winterszeit, gesundheitsgefährdend gewesen. Das halbe Dorf bekam also mit, wenn es einem der „Schmieds“ pressierte. Und er lief umso schneller, je dringender es war. Es lief ständig jemand; immerhin bewohnten die Schmiede acht Leute, mit mir neun. Der Name Schmied hielt sich zäh, obwohl wir alle Gebert hießen. Und so war mein Vater, der Älteste der Kinder, der Schmied-Franz und ich, seine Tochter, das Schmied-Marerl. Als Onkel und Tanten gab’s den Schmied-Beb, den Schmied-Ernst, die Schmied-Mare (meine Taufpatin), die Schmied-Anna und die Schmied-Emmi (nur sieben Jahre älter als ich).
In der Enge der Schmiede hatte die junge Gebert-Familie nicht Platz. Das Wohnhaus am Deitschnhof war größer. Wir bezogen eine Stube und eine Kammer im 1. Stock. Ich glaube, wir wohnten dort etwa drei Jahre. Ich nannte meinen Großonkel Deitschn-Vetter, das taten alle im Dorf und seine Frau war die Deitschn-Teta. Vier Söhne waren da. Der Jüngste hieß Wenzel und mit dem wuchs ich auf. Er war der Cousin meines Vaters, aber im selben Jahr 1924 geboren wie ich. Nur kam er schon im Januar und ich erst im Dezember zur Welt. So war er mir körperlich ein Jahr voraus. Ich war noch Kleinkind und habe fast gar keine Erinnerung an diese drei Jahre.