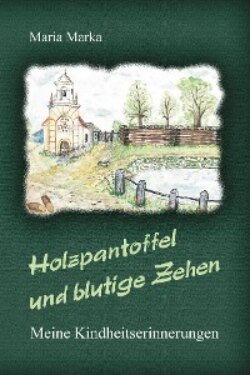Читать книгу Holzpantoffel und blutige Zehen - Maria Marka - Страница 18
Schuhe, Pantoffeln und Stricken
ОглавлениеMan sagt, die Landbevölkerung habe gesunde Füße, weil die Kinder immer barfuß liefen. Sicher liefen manche oft barfuß, aber keineswegs immer. Und ich schon gar nicht. Wenn ich es doch einmal versuchte – schon hatte ich abgestoßene, blutige Zehen. Und die taten sehr weh. Schuhe waren für jedes Kind schonungsbedürftige Seltenheiten, die man beim Kirchgang oder zu Stadtbesuchen anziehen durfte. Holzpantoffel dagegen gab es genug. In jeder Familie gab es jemanden, der sie herstellen konnte. Man war mit Holzpantoffeln auch gleich 5 cm größer, so dick waren die Sohlen. Und praktisch waren sie auch. Denn bei Regen waren die Wege im und rund ums Dorf, bis auf die vor der Schmiede vorbeiführende Gemeindestraße, grundlos aufgeweicht. Die dicken Sohlen hielten den Matsch fern. Man sparte sich beim Holzpantoffel tragen auch das lästige Auf- und Zubinden, wie es bei Schuhen nötig ist. Die Pantoffel wurden im Vorhaus von den Füßen gestreift, und jeder, groß oder klein, ging nur auf Socken, im Sommer barfuß, in die Stube. An Hausschuhe kann ich mich nicht erinnern; nur an wollene, selbst gestrickte Socken, denen eine leinene Sohle aufgenäht war, damit sie strapazierfähiger wurden. Socken stricken war die Hauptbeschäftigung in den abendlichen Mußestunden. Sobald ein weibliches Wesen mit Stricknadeln umgehen konnte, und das war sehr früh der Fall, spätestens jedoch mit vierzehn Jahren, wurde unentwegt gestrickt. Socken stricken war auch bei Petroleumlicht möglich. Zwei links, zwei rechts. Oder glatt im Fußling, das ging auch bei spärlicher Beleuchtung. Die Ferse oder gar Trachtenwadenstrümpfe mit Muster aus weißem Baumwollgarn mussten bei Tageslicht gefertigt werden, denn „Nähteln“ (Randmaschen) zählen, oder Maschen auf- und abnehmen war heikel. Das abendliche Zusammensitzen dauerte selten lange. Erstens war jeder müde vom Tag, zweitens war das Petroleum für die Lampe zu teuer und drittens musste man die Unterhaltung selber gestalten.
Radio oder gar Fernsehen waren völlig unbekannte Dinge. Das war in allen Häusern ähnlich. In unserer „Schmied“ kam noch dazu, dass Großvaters Bett in der „Stuben“ stand und nicht in der Schlafstube, wo alle anderen schliefen. Großvater brauchte es warm wegen seines Rheumas und außerdem wollte er seine Ruhe haben. Wenn er am Abend aus dem Stall kam, war er schon gewaschen. Im Stall stand sommers wie winters ein Schaff (niederer Holztrog) mit Wasser. Im Stall war es auch im Winter warm; hier mussten sich alle die Füße waschen vor dem Abendessen. Wasser musste vom Dorfbrunnen geholt werden für Mensch und Tier. Der mit einer Holzrampe von 1 m Höhe im Geviert umgebene und mit einem Holzdach versehene Brunnen befand sich an der niedrigsten Stelle des Dorfes, etwa 200 m von der Schmiede entfernt. Dahinter stand noch das Raschta-Häusel und dann breiteten sich schon die Futterwiesen der „Peint“ (eingeteilte Wiesenfläche) aus, die sich weit in die Senke hinunterzogen bis hin zum Wald. Der Brunnen war tief und uns Kindern wurde ein gehöriger Respekt davor eingebläut. Hinüberbeugen und Hineinfallen wäre sicher nicht so ausgegangen wie bei Goldmarie und Pechmarie. Ein Eimer wurde an einem Seil zum Wasserspiegel hinuntergelassen und mit den Händen wieder hochgezogen. Wasser holen ging fast immer der Großvater. Er legte sich eine geschwungene Stange auf die Schultern. Links und rechts hing je ein Eimer. Die gefüllten Eimer mussten leicht bergan zur Schmiede getragen werden, am Watzka-Häusl und an der Kapelle vorbei. Trinkwasser für drei Kühe und eine wechselnde Zahl von Menschen. Waschwasser für Mensch, Geschirr, Wäsche, Fußböden. Wenn das nicht Knochenarbeit war! Einige Höfe hatten beim Haus einen Brunnen; weil aber Mist und „Häusl“ nebenan waren, wurde das Trinkwasser auch von den Brunnenbesitzern aus dem Dorfbrunnen geholt. Denn das war rein, klar, kühl und geschmacklos.
Im Vorhaus der Schmied stand in der kühlsten Ecke ein großes Wasserfass aus Holz mit einem Deckel darauf. Das weiß ich noch gut, denn ich war als Kind sehr durstig und schöpfte oft mit einem „Tipfl“ daraus. Wenn ich mir einmal etwas Besonderes gönnen wollte, schüttete ich ein paar Tropfen Essig ins Wasser, tat ein klein wenig Salz und einen Zuckerwürfel dazu. Das war meine Limonade. Ich machte mir diese Köstlichkeit nicht oft und meist nur im Geheimen, denn von allen Seiten wurde mir gesagt, Essig und Salz sei für Kinder sehr ungesund und der Zucker zu teuer. Ich ließ mir als Kind schon was einreden! Ein „Soda-Wasser“ bekam ich nur an Peter und Paul, das war das Dorffest. Sodawasser vom Wirtshaus war ohnedies nur ein mit Kohlensäure versetztes, rot oder grün gefärbtes und etwas gesüßtes Brunnenwasser. So etwas würde heutzutage kein Mensch mehr trinken.