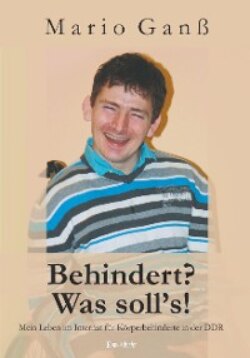Читать книгу Behindert? - Was soll’s! - Mario Ganß - Страница 11
Urlaub auf dem Campingplatz
ОглавлениеIn den Ferien unternahmen meine Eltern und Großeltern mit mir und meinem Bruder stets recht viel.
Schon als Knirps von einem Jahr fuhren meine Eltern mit mir jedes Jahr zum Zelten nach Lehnin. Diese Tradition wurde nun auch in der Ferienzeit beibehalten. Die ersten Jahre kamen meine Großeltern immer noch mit.
Lehnin ist ein kleines Örtchen im Land Brandenburg, direkt an der A2 gelegen. Bekannt ist dieses vielleicht durch sein Kloster.
Natürlich kann ich mich nicht an die allerersten Jahre erinnern. Erst etwa ab da, wo Andreas geboren und dann im Sommer mit zum Zelten genommen wurde.
Jedes Jahr spielte sich etwa drei Wochen vor unserem Urlaub das gleiche Szenario ab. Auf der großen Wiese im Garten meiner Großeltern wurden die Zelte an einem sonnigen Tag aufgebaut. So konnte man sehen, ob alle Teile vom Gestänge und alle Heringe vorhanden waren. Natürlich war ich immer mit von der Partie. Ich krabbelte dann durch das grüne Gras und erkundete jeden Beutel, was da wohl drinnen sei. Manchmal nahm ich mir auch einen Hering und begann, damit Löcher in die Wiese zu bohren. Das bereitete mir ziemlich viel Spaß, wurde mir aber immer wieder bedauerlicherweise untersagt.
Das Raten begann jedes Mal aufs Neue, wohin welche Zeltstange nun hingehört. Mein Vater und Opa begannen dann auch mal die Stangen zu nummerieren. Doch irgendwie half dies nicht wirklich. Sie tüftelten trotzdem mehrere Stunden, bis die Zeltgerüste standen. Hinterher schien alles ganz einfach und logisch zu sein und sie waren frohen Mutes, der Aufbau der Zelte in Lehnin würde zügig voran gehen.
Unsere Familie fuhr mehrere Jahre immer für drei Wochen nach Lehnin, meistens im Juli oder August. Schon allein die Fahrt dorthin war beziehungsweise konnte sehr abenteuerlich werden.
Anfangs besaßen meine Eltern noch kein Auto, sondern nur ein Motorrad. Meine Großeltern fuhren mit ihrem Pkw namens »Trabant« vorne weg und nahmen unser Gepäck mit. Dann kamen wir: mein Vater, meine Mutti und ich. Ja, das ging, zu dritt auf einem Motorrad! Ich saß sozusagen im Sandwich gut geschützt in der Mitte. An manchen Kreuzungen standen damals noch Polizisten, die den Verkehr mit der Hand regelten. Als sie uns drei auf dem Motorrad sahen, schüttelten sie nur lächelnd den Kopf. Was mögen die nur gedacht haben?
Als Andreas dann mitfuhr, hatten wir auch einen Trabant Kombi. Einen, geschweige zwei Anhänger besaßen wir zunächst nicht. Das Gepäck wurde jedoch von Jahr zu Jahr mehr. Um alles auf einmal weg zu bekommen, klappten wir die Rückbänke der Autos um. So hatten wir bedeutend mehr Stauraum zur Verfügung. Nur war so für meinen Bruder und mich eigentlich kein Platz mehr im Auto. Was heutzutage höchst fahrlässig ist, schien damals problemlos möglich. Mein Bruder fuhr bei meiner Mutti und ich bei meiner Oma vorne mit; und zwar jeweils auf ihrem Schoß sitzend! Ans Anschnallen war in diesen Zeiten noch nicht zu denken, von Kindersitzen ganz zu schweigen.
Es schien schon etwas kurios, aber jedes Jahr konnten wir regelrecht darauf warten. Am Morgen, als wir von Zerbst losfuhren, begann es wie aus Gießkannen zu schütten. Bei so einem Wetter hätte man keinen Hund vor die Tür gejagt und erst recht wäre man nicht zum Zelten aufgebrochen. Doch die Erfahrung zeigte es: In Lehnin würde die Sonne scheinen! Und so war es auch tatsächlich! Fast jedes Jahr!
Obwohl Lehnin nur rund 80 Kilometer von Zerbst entfernt liegt und die Fahrt etwas mehr als eine Stunde dauerte, konnte unterwegs viel passieren. Pausen zum Austreten waren ja schon eingeplant. Da hatten wir »unsere« Stelle, an der routinemäßig gehalten wurde. Eine Panne am Auto erwies sich schon als problematischer.
Am ehesten verstopfte mal eine Zündkerze. Sie selbst zu wechseln, war beim Trabant in der Regel kein Problem. Nur lagen die Reservekerzen und das Werkzeug meistens beim Reserverad. Und das lag unter der Abdeckung im Kofferraum. Um dort ranzukommen, musste dann der halbe Kofferraum leer geräumt werden. Da kam Freude auf! Doch eine Panne am Auto kam Gott sei Dank bei Weitem nicht bei jeder Fahrt vor und wenn, dann ließ uns der bevorstehende Urlaub dies mit einem gewissen Humor nehmen.
In Lehnin angekommen, brauchten wir nicht lange nach einem geeigneten Zeltplatz zu suchen, denn jeder Camper hatte mit den Jahren schon »seinen« Platz.
Dann kam die Stunde der Wahrheit: der Aufbau der Zelte! Jetzt konnten mein Vater und Opa beweisen, ob sie sich beim Probeaufbau im Garten alles gemerkt hatten. Für mich hatte man extra ganz oben im Auto einen Klappstuhl bereitgelegt. Auf diesen setzte man mich und ich konnte dem Aufbau der Zelte frohgelaunt zusehen.
Anfangs schien es perfekt zu laufen. Doch mit jeder Stange, die man aus dem Sack zog, wurde die Unsicherheit größer, wohin diese nun gehöre. Es dauerte, wie schon gewohnt, mehrere Stunden, bis unsere Zelte einzugsfertig dastanden. Meine Mutti und Oma versorgten uns mit vorgeschmierten Schnitten und Getränken und hielten so die Stimmung hoch. Ein Renner war auch Omas selbstgebackener Streuselkuchen. Der schmeckte so lecker, dass sie davon gleich mehrere Bleche backte. Irgendwann standen schließlich die Zelte und konnten eingeräumt werden.
Die ersten Jahre hatten meine Eltern nur ein sehr kleines Zelt. Trotz der geringen Größe bot es uns Vieren Platz zum Schlafen. Vorn nebeneinander schliefen meine Eltern und mein Bruder auf Luftmatratzen. Im hinteren Teil war etwas Platz, der ursprünglich als Ablagefläche für Gepäck vorgesehen war. Hier stand quer zu den Matratzen meine kleine Liege.
Andreas besaß die Angewohnheit, nur mit einem Schnuller einzuschlafen. Fiel dieser nachts mal aus seinem Mund und er fand ihn nicht, fing er gleich an zu schreien. Dann mussten beim Schein einer Taschenlampe alle Luftmatratzen hochgenommen und nach dem Schnuller gesucht werden. Erst als Andreas erneut auf diesem herumkaute, war die Nachtruhe wieder hergestellt.
Gegenüber unserem Zelt stand das meiner Großeltern. Dieses war schon moderner und großräumiger. Es besaß eine separate Schlafkabine und bot auch Platz, um sich mal darin hinzusetzen. Zwischen beiden Zelten spannten wir eine Plane. Unter dieser wurde in der Regel gegessen und abends gemütlich beieinander gesessen.
Auf Strom und fließend Wasser mussten wir während unseres Urlaubes verzichten. Kerzen, Petroleum- und Taschenlampen spendeten uns abends Licht. Wasser holten wir in Eimern und Kanistern von einer zentralen Pumpe. Das war eine gewöhnliche Schwengelpumpe. Da war Muskelkraft gefragt.
Wir kochten auf Petroleumkochern. Es gehörte schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu, diese Dinger in Gang zu setzen. Auf diesen Kochern wurde nicht nur das Mittagessen gekocht. Wir brauchten auch viel warmes Wasser fürs Waschen und Abwaschen.
Als Toiletten dienten auf dem Platz mehrere sogenannte Plumpsklos. Am Tage störte es niemanden, diese zu benutzen, doch nachts vermied man es, dorthin zu gehen, denn es war stockfinstere Nacht. Lichtspendende Lampen wurden erst einige Jahre später aufgestellt. Da es für meine Eltern und Großeltern zu umständlich war, mich jedes Mal auf diese Toiletten zu bringen, benutzte ich ein Töpfchen.
Unser Zeltplatz lag in einem sehr waldreichen Gebiet mit vielen Seen. Der Kolpinsee war nur wenige Meter von uns entfernt und lud oft zum Baden ein.
Mein Opa galt als Frühaufsteher. Bei jedem Wetter ging er frühmorgens ins Wasser. Da hielt keiner von uns mit. Wir bevorzugten eher die doch wärmeren Nachmittagsstunden zum Baden.
Auch ich war eine Wasserratte. Wann immer es ging, wurde ich zum Baden mitgenommen. Der Strand war bestens zum Spielen und Moddern geeignet. Das sagt man in dieser Gegend zum Herumtollen im Schlamm. Wenn Andreas und ich vom Moddern so richtig dreckig waren, hieß es: »Ab ins Wasser«. Dann tobte mein Vater mit uns heftig rum. Wir hatten einen riesigen Spaß dabei. Er warf uns hoch in die Luft, sodass wir klatschend ins Wasser plumpsten. Mindestens eine Rolle vorwärts musste bei jedem Baden dabei sein. Mein Vater griff dann mit seiner einen Hand meine Arme, mit der anderen meine Beine. Anschließend drehte er mich um eine halbe Drehung kopfüber. Dann musste er schnell genug sein und meine Arme und Beine erneut packen, um mich wieder mit dem Kopf nach oben zu drehen. Manchmal griff er auch daneben. Wie viel Wasser ich bei diesen Manövern geschluckt habe, möchte ich gerne einmal wissen. Oft mussten wir eine Pause einlegen, damit ich wieder richtig durchatmen konnte. Doch es dauerte nicht lange und ich sagte: »Noch mal.«
Mit meinem großen Ungetüm von Rollstuhl, den ich immer noch besaß, konnte man mich auf den unebenen Waldwegen nicht schieben. Oft waren die Wege außerdem sehr versandet. Auch mit dem Sportwagen war es eine Plackerei. Aber wir wussten uns zu helfen. Meine Großeltern hatten noch von früher einen kleinen Handwagen. Wenn die Deichsel zum Ziehen abgeschraubt wurde, passte er sogar ins Auto. Dort nahm er auch nicht sonderlich viel Platz weg, denn auf der Sitzfläche und unter ihm konnten einige Sachen verstaut werden.
In diesen Handwagen wurde ich gesetzt und über die Waldwege gezogen. Oft hoppelte es ziemlich stark, wenn große Wurzeln die Wege überquerten. Doch dies störte mich wenig. Der Handwagen erwies sich deshalb als das am besten geeignete Fortbewegungsmittel für mich. Bei längeren Spaziergängen konnte ich sogar meinen noch kleinen Bruder auf den Schoß nehmen.
Die zahlreichen Seen rund um den Zeltplatz und in den sehr großen Wäldern, von denen Lehnin umgeben ist, luden nicht nur zum Baden ein, sondern bedeuteten auch für Angler ein kleines Paradies. Einige Seen entstanden durch den früheren Abbau von Torf. Durch die Naturbelassenheit hatten sie sehr klares und reines Wasser und wurden deshalb oft für die Aufzucht von Fischen genutzt.
Mein Vater und Opa waren begeisterte Angler. Ein Urlaub in Lehnin ohne Angeln war einfach kein richtiger Urlaub! Oft zogen sie schon in aller Frühe los mit der Begründung: »Früh’s beißen die Fische besser.« Aber auch Nachtangeln fand öfters mit derselben Begründung statt. Welche Zeit nun tatsächlich die beste war, fand ich nie heraus.
Andreas und ich wollten natürlich auch immer mal von Zeit zu Zeit mit zum Angeln. Doch ständig nur am Wasser zu sitzen und die Rute zu halten, wäre uns zu langweilig geworden. Aber ab und zu einen Fisch aus dem Wasser zu ziehen, das stellte schon ein tolles Erlebnis dar. Für diese Unternehmungen sahen wir oft die Nachmittage vor. Nach dem Mittagsschlaf. Dieser war auch im Urlaub – bis auf wenige Ausnahmen – unerlässlich.
Oft gingen mein Vater und Opa mit uns Kindern allein. Wenn die Angelstelle nicht allzu weit vom Zeltplatz entfernt lag, zogen wir zu Fuß (ich im Handwagen) los. Es gab aber auch Seen, zu denen wir mit dem Auto fuhren. Man sprach dann von den »besseren« Seen, in denen die Fische besonders gut beißen sollten. An einigen Nachmittagen kamen Mutti und Oma auch mit. Dies erlebten wir dann als einen richtigen schönen Familienausflug, denn wo Oma dabei war, gab es auch immer Kuchen.
Während die Angelei fertig gemacht wurde, setzte man mich schon auf einen Stuhl ans Wasser. Ich bekam dann meist eine »eigene« Angelrute und konnte es kaum erwarten, sie in den Händen zu halten, was sich aufgrund meiner unkontrollierten Bewegungen als gar nicht so einfach erwies. Bei meinen manchmal stattfindenden Bewegungsausbrüchen hätte es ein Fisch schon vorher mit der Angst zu tun bekommen. Doch das Berühren der Angel mit meinen Händen gab mir das Gefühl, ein richtiger Angler zu sein.
Es waren oft noch nicht alle Angelutensilien beziehungsweise die Verpflegung ausgepackt, da saß Andreas schon auf dem nächstgelegenen Baum. Für ihn war das Klettern noch reizvoller, als ruhig vor dem Wasser zu sitzen. Auch er hatte ebenfalls seine Angel, die meistens provisorisch für ihn hergerichtet wurde, jedoch seinen Ansprüchen genügte. An einem längeren Stock befestigte man ein Stück Angelsehne mit einem Haken. Dieser wurde mit einem Stückchen Grießklump bestückt. Das erfüllte vollkommen die Zwecke für Andreas. Kaum hatte er die Rute ausgeworfen, lockten schon wieder die Bäume. Was sich an seiner Angel tat, interessierte ihn herzlich wenig. Kurioserweise biss bei ihm immer der erste Fisch. Flugs riefen wir alle: »Andreas, bei dir beißt einer.« Schnell kam er daraufhin angerannt und zog seine Angel mit einem zappelnden Fisch aus dem Wasser. Mein Vater oder Opa half ihm, den Fisch vom Haken zu befreien. Oft war dieser zu klein, um ihn mitzunehmen und so wurde er wieder ins Wasser entlassen. Schnell bestückte man die Rute neu, Andreas warf sie aus und schwups war er aufs Neue verschwunden.
Ich hielt es dagegen schon länger am Wasser aus. Zur einfachen Handhabung gab man mir in der Regel eine Stipprute, also eine Angel ohne Rolle. Das untere Ende klemmten wir so in die Seitenlehne des Stuhles, sodass ich sie kaum noch selbst zu halten brauchte. Da diese meist länger war, musste ich trotzdem vorsichtig sein, dass die Spitze vorn nicht ins Wasser tauchte. Dies wäre für einen Fangerfolg nicht so günstig gewesen. Mein Vater saß oft neben mir. Manchmal schien die Zeit gar nicht zu vergehen, denn es wollte kein Fisch beißen. Doch wir hatten auch mal Glück. Ein Fisch nach dem anderen zappelte an unseren Ruten. Da ich die Angel nicht allein heraus bekam, half mir mein Vater. Doch im gleichen Augenblick hing bei ihm ebenfalls einer dran. Es gab Momente, da kam mein Vater mit dem Einholen der Ruten gar nicht hinterher. So füllte sich der Setzkescher schnell. Das war für mich natürlich ein Heidenspaß. Sogar Andreas lockte die Neugier dann mal wieder ans Wasser.
An einem Nachmittag fuhr mein Vater mit mir mal allein ans Waldidyll. Die drei nebeneinander liegenden Seen befanden sich nahe der Autobahn. An diesem Tag hatten wir richtiges Anglerglück.
Mein Vater angelte mit seiner richtigen Wurfrute und ich mit seiner neuen Stippe. Diese war an die fünf Meter lang. Oft titschte sie mir vorn ins Wasser. Ich hatte Mühe, sie einigermaßen ruhig zu halten. Auf einmal sagte mein Vater: »Pass’ auf, da geht einer dran.« Er übernahm ganz vorsichtig meine Angel. Plötzlich tauchte die Pose unter Wasser. Mein Vater zog ruckartig an. Die Rute bog sich wie ein Flitzebogen. Wir konnten schon erahnen, was da am Haken hing. Mit einer Hand hielt mein Vater, vor Anstrengung zitternd, die Angel, mit der anderen griff er nach dem Fangkescher, der etwas entfernt im Gras lag. Er bekam ihn gerade so zu greifen. Ich konnte ja nichts machen, außer zusehen wie mein Vater sich abmühte. Dann endlich hob er unseren Fang aus dem Wasser, ein kapitaler Karpfen von etwa fünf Kilo.
Dieser Nachmittag muss ein außergewöhnlich guter gewesen sein, denn das Spielchen wiederholte sich noch zweimal kurz hintereinander.
An manchen Tagen kam es vor, dass mein Vater und Opa unterwegs waren, um Besorgungen zu machen. Ein Propangaskocher löste in den nächsten Jahren den Petroleumkocher ab. Mit Propangas ließ es sich viel bequemer kochen. Auch konnten wir nun bei Bedarf eine kleine Propangasheizung betreiben. Die Flasche für dieses Gas musste ab und an mal nachgefüllt werden. Da nicht jede Füllstation immer offen hatte, mussten mein Vater und Opa oft weit fahren, um Gas zu bekommen. Aber auch andere Einkäufe waren von Zeit zu Zeit nötig, denn auf dem Zeltplatz gab es nur einen kleinen Kiosk.
In dieser Zeit spielten Andreas und ich im Wald, gleich neben unseren Zelten. Doch wenn es uns zu langweilig wurde, kam es uns in den Kopf, gerade jetzt angeln gehen zu wollen. Meine Mutti und Oma kannten sich jedoch mit der Angelei nicht so aus und wollten die von meinem Vater und Opa nicht durcheinander bringen. Außerdem war meine Mutti oft mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die schmutzige Wäsche häufte sich öfters. Eigentlich viel öfters als es ihr lieb war. Dadurch dass ich meistens auf dem Waldboden kroch, waren meine Hosen schnell dreckig. Doch das war das wenigste. Ich hatte ein Manko, welches meine Mutti fast zur Verzweiflung brachte. Immer wenn ich lachte – und das war sehr oft der Fall -, gingen ständig bei mir ein paar Tropfen in die Hose. Auf der Leine hingen so täglich Hosen und Unterhosen von mir.
Um unserer Quengelei entgegenzuwirken und die Nerven meiner Mutti zu schonen, ließ sich Oma mal wieder etwas einfallen: Schnell merkte sie, dass wir eigentlich nur am Wasser moddern wollten und dass das Angeln lediglich ein Vorwand dafür war. Sie suchte einen langen Stock, knipperte daran einen längeren Bindfaden und an dessen Ende befestigte sie einen Kienapfel. Fertig war unsere Angel! So zog sie mit uns los. Mit der einen Hand meinen Handwagen ziehend, in der anderen trug sie unsere Angel. Nebenher stiefelte Andreas.
Meistens ging meine Oma mit uns an die hintere Badestelle des Kolpinsees. Wir mussten über den ganzen Zeltplatz und ein ganzes Stückchen noch am Ufer entlanggehen, bevor wir diese Badestelle erreichten. Der Weg dorthin war nicht gerade eben und für Oma eine ganz schöne Plackerei. An diesem Strand badeten immer nur sehr wenige, sodass uns bei unserer »Angelei« wenn überhaupt nur sehr wenige zusehen konnten. Neben diesem befand sich ein kleines Staubecken, eigentlich mehr ein Überlauf, in das das Wasser des Kolpinsees abfließen konnte. Zu diesem Stau führten wenige Stufen hinunter. Dies war genau das Richtige für Omas Vorhaben!
Schnell zog sie mir die Schuhe, Strümpfe und die Hose aus. Es war ja warm genug dafür. Dann setzte sie mich auf die zweite Stufe des Staus. Die dritte war schon mit Wasser bedeckt, sodass meine Füße im nassen Element standen. Auf die oberste setzte sich meine Oma selbst. So hatte sie mich voll im Griff, denn zwischen ihren Knien fand ich sicheren Halt. Nun gab sie mir die improvisierte Angel mit dem Kienapfel in die Hand.
Das »Angeln« mit dieser Rute machte mindestens genauso großen Spaß wie mit einer richtigen. Diese brauchte ich nicht stillzuhalten, sondern konnte sie nach Herzenslust mit der Spitze ins Wasser plumpsen lassen, sodass es nach allen Seiten nur so spritzte.
Auf dem Boden des kleinen Staubeckens wuchsen allerlei Pflanzen. An diese kam ich mit der Spitze meiner Angel leicht heran. So zog ich ein Stückchen nach dem anderen von diesen Pflanzen heraus. Da sie länglich aussahen, meinte ich dann immer: »Guck’ mal, ich habe einen Aal gefangen.« Meine Oma freute sich so mit mir, befreite meine Angel von dem Grünzeug und der Spaß ging von vorne los.
Andreas vergnügte sich währenddessen allein am Wasser. Oft fand er selbst einen Stock, mit welchem er mir beim »Aale« Fangen Konkurrenz machte. Oder er watete gleich so durch das flache Gewässer und holte das Grünzeug mit der Hand heraus. Aber die rundum stehenden Bäume verlockten ihn auch immer wieder zum Klettern. So hatte meine Oma ihre liebe Not, auf uns beide gleichzeitig aufzupassen.
In den folgenden Jahren fuhren meine Eltern, Andreas und ich allein nach Lehnin. Meine Großeltern gönnten sich noch einige Male für jeweils drei Wochen Urlaub an der Ostsee.
Mittlerweile besaßen auch wir ein schönes, großes neues Zelt. Es bot für uns Vier eine abgetrennte Schlafkabine und außerdem genügend Platz, um uns bei miesem Wetter drinnen aufhalten zu können. Der Luxus nahm von Jahr zu Jahr zu. Damit ich im Zelt auf dem Erdboden spielen konnte, wurde das Zelt mit einem großen Teppich ausgelegt. Nun hatten wir auch richtige, aus Stangen zusammengebaute Schränke, in denen wir unsere Sachen übersichtlich aufbewahrten.
Um diesen Luxus länger als die sonst gewohnten drei Wochen zu genießen, entschlossen sich meine Eltern zum Dauercamping. Dies bedeutete, dass das Zelt im Mai aufgebaut und erst im September wieder abgebaut wurde. So fuhren sie fast jedes Wochenende nach Lehnin. Ich kam natürlich in den Ferien mit. In den Sommerferien war dann ein großer Urlaub für etwa drei Wochen angesagt. Mit jeder Fahrt zum Zeltplatz wurden immer noch weitere Utensilien mitgenommen. Wir mussten sogar mit der Zeit ein weiteres kleineres Zelt aufstellen, in dem wir die ganzen Kartons, Zeltsäcke, Koffer und Ähnliches aufbewahrten.
Schon allein für mich nahm man zwei Wagen mit. Einmal den Handwagen, der sich im Wald immer aufs Neue bewährte. In der Zwischenzeit hatte ich auch einen anderen Rollstuhl bekommen. Dieser war viel handlicher als der erste. Auch bei ihm waren die großen Räder vorn und die kleineren zum Lenken hinten. Die Sitzfläche, die Fußstütze sowie die Rückenlehne waren zwar starr, konnten aber schnell einzeln herausgenommen werden. Dann ließ sich der Rest problemlos zusammenklappen und passte so ins Auto.
Sogar auf einen Kühlschrank mussten wir beim Camping nicht verzichten, obwohl es keinen Strom gab. Neben unserem Zelt hoben wir ein tiefes Loch aus. Die dort reingelegten Lebensmittel blieben so kühl. Auch bei höheren Temperaturen. Um eine bessere Übersichtlichkeit und vor allem Sauberkeit zu erreichen, kamen wir auf die Idee, eine Milchkanne, wie sie auf den Weiden zum Melken der Kühe Verwendung fand, einzugraben. Diese Kanne besaß noch einen idealen Deckel, sodass kaum Schmutz hineinfiel. Der perfekte Kühlschrank fürs Campen!
Die Autos der an Lehnin vorbeiführende Autobahn konnte man – wenn der Wind aus der entsprechenden Richtung wehte – auf dem Zeltplatz hören. In der Woche störte dies kaum, da nur verhältnismäßig wenige Fahrzeuge und dazu mit einer geringen Geschwindigkeit (im Gegensatz zu heute) diese benutzten. Doch am Wochenende, vor allem am Sonntagabend artete das Befahren der Autobahn im ohrenbetäubenden Lärm aus. Warum nur? In unserem dreiwöchigen Urlaub erkundeten wir dieses Phänomen:
Die nahe gelegene A2 konnten wir bequem zu Fuß erreichen. Es war außerdem gleich eine schöne Gelegenheit, einen gemeinsamen Sonntagsspaziergang zu unternehmen. Meine Eltern zogen mich wie gewohnt mit dem Handwagen. Einige Stellen waren zwar sehr sandig, aber zu zweit schafften sie es.
Je näher wir der Autobahn kamen, umso intensiver wurde das Brummen der Autos. Durch einige Baumlücken sahen wir dann schon die Autos vorbeihuschen. Und das waren viele, sehr viele! Auf der, über die Autobahn führende, kleinen Brücke blieben wir stehen. Als wir das »Schauspiel« zum ersten Mal sahen, das da unter uns ablief, trauten wir unseren Augen kaum. Wir glaubten uns in einer anderen Welt. Westauto an Westauto, und das in allen erdenklichen Farben! Die Fahrzeuge, die da unter uns lang fuhren, kannten wir nur sehr flüchtig. Alles schöne Autos, die wir so auf unseren Straßen nie sahen.
Diese Autos flogen nur so an uns vorbei. Doch nicht lange. Mit der Zeit hatten wir unsere Erfahrung und sagten: »Die stehen gleich.« Es dauerte dann auch nicht lange, bis die Autos bedeutend langsamer fuhren und sogar zum Stillstand kamen. Wow! Ein Stau auf der Autobahn. So etwas kannten wir nur aus dem Fernsehen, aus dem Westfernsehen. Aber nun hatten wir die Gelegenheit, dies einmal live mitzuerleben.
Diesen Stau konnten wir uns jedoch schnell erklären. Kurz hinter der Brücke befand sich die Abfahrt nach Westberlin. Und alle, die am Wochenende nach Westdeutschland fuhren, kamen am Sonntag wieder zurück.
Nur schwer konnten wir uns von dem Anblick der uns selten zu Gesicht zu bekommenden Autos trennen. Aber da wir ja mehrere Wochen Urlaub hatten, kam der nächste »Autobahntag« bald wieder und so gingen wir langsam zu unserem Zelt. Wenn die Zeit es noch zuließ, versuchten wir auf dem Rückweg beiläufig für unser Abendbrot zu sorgen.
Der Wald rund um die Autobahn muss ideale Wachstumsbedingungen für Pilze geboten haben. Sie übersäten in manchen Jahren regelrecht den Boden. Überwiegend wuchsen hier Maronen. Richtig suchen brauchte man sie nur selten. In den meisten Fällen musste man sie einfach nur abschneiden.
An einigen Wochenenden kamen uns meine Großeltern besuchen. Auch sie wollten für sich Pilze sammeln. Dann zogen wir alle gemeinsam los, zu den Wäldern an der Autobahn. Oft fuhr mein Vater oder Opa mit dem Auto hinterher. Dies erwies sich dann auch als sehr hilfreich, denn anders hätten wir die Massen an Pilzen gar nicht weg bekommen. Es war manchmal wie verhext. Der ganze Kiefernwald stand voller Maronen. Man hätte sie zuweilen mit der Sense abmähen und ernten können. So machte Pilze sammeln richtig Spaß, denn wir schleppten (oder fuhren) sie eimer- und körbeweise nach Hause.
Natürlich konnte ich nicht direkt beim Pilze suchen mitmachen. Mich in dem Handwagen quer durch das dichte Unterholz zu ziehen, ging nun beim besten Willen nicht. Wenn ich einen Pilz vom Wegesrand aus sah, machte ich ganz aufgeregt meine Eltern darauf aufmerksam, so als hätte ich ihn zuerst entdeckt. Doch viel mehr konnte ich ihnen nicht helfen. Aber immer nur dazustehen und zuzugucken, das wurde mir sehr schnell zu langweilig. Meinen Bruder interessierten die Pilze sowieso nicht und er turnte schon längst im Wald herum. Das reizte mich natürlich ebenfalls. Wenn der Waldboden nicht zu nass war, setzten mich meine Eltern auf die Erde und so konnte ich mit Andreas den Wald erkunden. Das konnte richtig spannend sein.
Das Gebiet um Lehnin war damals Truppenübungsplatz der NVA. Nicht unbedingt während der Hauptsaison der Zeltler hielten die Soldaten ihre Manöver in unserer unmittelbaren Nähe ab, doch in der Ferne hörte man schon manchmal Donnerschläge von Panzern, die ihre Übungen absolvierten. Auch konnte es einmal im Jahr vorkommen, dass diese zum vom Zeltplatz nicht weit entfernten Schampsee fuhren. Dieser See war eigentlich ein reiner Anglersee. Doch an den zwei langen Seiten dieses Gewässers befand sich jeweils eine Panzereinfahrt. Hier übten die Soldaten mit den Panzern durch das Wasser zu fahren. So ein Manöver einmal hautnah mitzuerleben, war schon etwas Spannendes.
Auch fand man in sämtlichen Waldstücken rund um Lehnin Spuren der Streitkräfte. So auch beim Spielen. Wenn ich auf den Böden der Wälder herumkroch, während meine Eltern Pilze suchten, fand ich die eine oder andere Hülse einer Patrone. Das war immer ziemlich aufregend. Unsere Eltern waren selbstverständlicher Weise nicht gerade begeistert, wenn wir mit diesem Zeug rumspielten. Oft taten wir es heimlich, wenn Mutti und Vati sich auf die Pilze konzentrierten. Es waren stets wirklich nur leere Patronenhülsen, die wir fanden, dennoch zogen uns die Dinger magisch an.
Robbten wir an manchen Tagen etwas tiefer in den Wald hinein, entdeckten Andreas und ich auch mal riesige Vertiefungen im Erdboden, wo ganze Panzer hineinpassten, die zur Tarnung dienten. In diesen gewaltigen Löchern zu spielen, war einfach traumhaft. Wenn wir Glück hatten, fanden wir so ein Panzertarnloch, in dem seitlich noch eine kleine Aushöhlung war, in der man sich zusätzlich verstecken konnte. Oft machten wir uns dann einen Jux. Hatten wir wieder einmal so ein perfektes Versteck gefunden und wir hörten unsere Eltern nach uns rufen, verhielten wir uns mucksmäuschenstill. So hatten sie ihre liebe Mühe, uns zu finden. Doch ist es von mir ein Manko, dass ich in solchen Situationen nicht lange still sein kann. Über kurz oder lang fange ich an zu lachen. So war es schon damals. Und deshalb fanden uns unsere Eltern auch immer ziemlich schnell.
Vom Wetter wurden wir beim Zelten in Lehnin sehr verwöhnt und die Erfahrung zeigte uns, dass mit relativer Regelmäßigkeit die letzte Woche im Juli sowie die ersten beiden Wochen des August die Sonne am verlässlichsten schien. Klar gab es in diesen Tagen auch mal Ausnahmen und der Himmel trübte sich ein. Regenschauer mussten wir ebenfalls hin und wieder in Kauf nehmen. Wenn es nachts auf das Zelt regnete, empfand ich das irgendwie als sehr beruhigend. Ein Gewitter mit aufziehendem Wind stellte sich als ein besonderes Abenteuer dar. Kam dann aber noch Sturm dazu, sah die Sache für uns schon anders aus.
In solchen Situationen stand mein Vater nachts auf und machte regelrechte Kontrollgänge um unser Zelt. Zum einen wachte er darüber, dass das Wasser in den kleinen Gräben, die um das Zelt gezogen waren, nicht über und so in das Zelt lief. Desweiteren ging sein besorgter Blick immer erneut nach oben zu den Baumwipfeln. Dort lauerte für uns die größte Gefahr, herunterfallende Äste. Wären diese heruntergefallen und ungünstig auf das Zelt aufgekommen, hätten sie mühelos das Überzelt, das eigentliche Zelt und erst recht die Schlafkabine durchschlagen können. Zum Glück hielten die großen Kiefern jedem Sturm stand.
Der Sommer 1978 muss ein total verkorkster gewesen sein: nass und kalt. Die kühleren Tage nutzten wir, um Ausflüge mit dem Auto in die nähere Umgebung zu unternehmen. Brandenburg, Potsdam oder auch Berlin boten sich dafür recht gut an. Auch einige Tage, an dem wir nur im Zelt spielen konnten, nahmen wir in Kauf. Doch an einem Tag mussten wir kapitulieren.
Es fing schon am Vorabend an zu regnen und auch nachts hörte es nicht auf. Im Gegenteil. Der Regen verstärkte sich immer weiter. Auch die Tage zuvor waren sehr regnerisch. Als wir am Morgen aufstanden, merkten wir, dass wir unter diesen Umständen unsere Sachen überhaupt nicht mehr trocken bekamen. Auch das Bettzeug war schon klamm. Die kleine Propangasheizung spendete uns zwar ein wenig Wärme, doch zum Trocknen der Sachen war sie nicht geeignet. Wir sahen ein, dass es in diesem Moment keinen Sinn hatte, länger im Zelt zu verharren. Kurzerhand entschlossen wir uns, nach dem Frühstück nach Zerbst zu fahren, um unsere Sachen zu trocknen und frische zu holen.
Mein Vater fuhr unseren Trabant so nah wie möglich an das Zelt, um mich halbwegs trocken zum Auto zu tragen. Mit dem Rollstuhl oder dem Handwagen wären wir den schon aufgeweichten Weg bis zum Parkplatz überhaupt nicht lang gekommen.
Der Zeltplatz lag etwa drei Kilometer vom Ort Lehnin entfernt. Zu ihm führte ein teils festgefahrener, teils sandiger Waldweg. Der Sand ließ das Wasser noch einigermaßen gut versickern, sodass wir ohne größere Probleme die befestigten Straßen ab Lehnin erreichten.
Es goss immer noch wie aus Kübeln. Die Scheibenwischer schafften es kaum, die Scheiben vom Wasser zu befreien. Nur im gemäßigten Tempo kamen wir voran.
Auf einmal blubberte unser Trabi. Da uns das Geräusch bekannt vorkam, beunruhigte uns dies wenig. Mein Vater stieg aus, um nachzusehen was defekt war. Aus Solidarität hielt meine Mutti ihm den Schirm. Zielstrebig wechselte mein Vater die Zündkerze. So ein Blubbern war ein sicheres Zeichen, dass mit diesen etwas nicht stimmte und sie meist verstopft waren. Bei den vielen Fahrten, die mein Vater absolvierte, war das Wechseln der Kerzen für ihn zur Routine geworden. Zumal der Trabant nur zwei davon besaß und diese gut zugänglich waren.
Mit neuer Zündkerze fuhren wir einige Kilometer weiter. Doch nach kurzer Zeit das gleiche Spielchen. Diesmal wechselte mein Vater die andere Kerze. Nun konnte nichts mehr schief gehen. Leider erwies sich dies als Irrtum. Unser Trabi blubberte und spuckte weiter. Wir sagten: »Warum lässt der uns ausgerechnet bei so einem Mistwetter im Stich?« Uns wurde es auch immer kühler, denn die Heizung in so einem Trabant funktioniert nur richtig, wenn er einigermaßen schnell fährt.
Mein Vater unternahm einen letzten Versuch, die Kerzen zu trocknen. Aber unser Trabi dankte es ihm nur mit weiteren Aussetzern der Zündung. Wir waren machtlos und auf fremde Hilfe angewiesen. Aber wo sollte zu damaliger Zeit so schnell Hilfe herkommen? Schon allein das Wort »Handy« war uns bei Weitem kein Begriff, zumal es zu dieser Zeit noch überhaupt gar keine gab.
Daher beschlossen wir, so lange zu fahren, wie es irgendwie ging und zu versuchen, die nächste Werkstatt zu erreichen. Diese war in Belzig. Gemächlich tuckerten wir dahin. Unser »Vorhaben« gelang uns. Wir kamen in der Werkstatt an.
Unbürokratisch konnte uns hier weitergeholfen werden. Während meine Eltern und mein Bruder das Auto verlassen mussten, durfte ich drin sitzen bleiben. Obwohl ich nicht viel von der Reparatur sehen konnte, empfand ich es als spannend, hautnah dabei zu sein. Interessierte ich mich doch sehr für Technik.
Die Zündkerzen waren in Ordnung, doch ein anderes Teil der Zündanlage muss verölt gewesen sein. Nach einer halben Stunde schnurrte unser Trabi wieder wie neu und wir konnten damit zufrieden nach Zerbst fahren.
Es goss immer noch ununterbrochen. In Zerbst angekommen, heizten wir zunächst den Ofen an, um uns erst einmal aufzuwärmen. Gleichzeitig trockneten wir so unsere klammen mitgebrachten Sachen.
Ein Mittagessen war schnell gekocht. Einen Vorrat an Lebensmitteln hatten wir immer im Haus. Während des Essens lief der Fernseher: die Tagesschau. Nach Langem waren das die neusten Informationen in Wort und Bild.
Nachdem alle Sachen getrocknet waren und meine Mutti noch neue herausgesucht hatte, machten wir uns erneut auf den Weg nach Lehnin. Der Wetterbericht versprach eine Besserung. Außerdem wollten wir unter diesen Bedingungen unser Zelt nicht länger als nötig unbeaufsichtigt lassen.
Die Fahrt zurück verlief problemlos. Unser Trabi schnurrte wie eine Eins. So erreichten wir zügig das Ortsende von Lehnin. Bis dahin erlebten wir eine ganz gewöhnliche Autofahrt, eben nur bei Regen. Doch was dann folgte, glich wieder einmal einem nicht alltäglichen Abenteuer.
In der langen Zeit, in der es schon regnete, das waren bald 24 Stunden, waren die Waldwege, die zum Zeltplatz führten, so gut wie überflutet. Auch der beste Sandweg ist einmal mit Wasser voll gesogen. Wir konnten nur erahnen, wo in etwa der befahrbare Weg entlangführte. Mein Vater ahnte diesen Umstand schon im Vorfeld und packte sich seine Gummistiefel vorsorglich und griffbereit ins Auto. Wie Recht er damit hatte! Jetzt zog er sie an.
Da der Weg nicht eben war, bildeten sich unterschiedlich große und tiefe Pfützen, die schon eher kleinen Seen glichen. Zwischen diesen lugte immer mal ein winziger Erdhügel heraus. Diese dienten uns sozusagen als Rettungsinseln. Immer wenn wir so eine Insel erreicht hatten, stieg mein Vater aus und schritt mit seinen Stiefeln die nächste Pfütze ab. Er prüfte wo das Wasser in dieser Senke am niedrigsten stand und wo wir am günstigsten durchfahren konnten. Denn Wasser im Vergaser des Autos hätte zum unweigerlichen Ende dieser wahrhaftigen Spritztour geführt. Mein Vater erkundete so jede Pfütze zentimetergenau und fand immer wieder einen Weg, um hindurch fahren zu können. Manche Stellen erwiesen sich dennoch als eine ziemliche Zitterpartie, denn ganz allzeit sicher war sich mein Vater nicht, ob wir durch dieses oder jenes Loch kommen würden. Da half nur ordentlich Gas zu geben und es zu versuchen. Der Motor heulte dann öfters ganz gehörig auf und einige Male fing er auch an zu Stottern. Dann war doch etwas Wasser in den Vergaser gelangt. Wenn wir in so einem Minisee stehen geblieben wären, wäre dies der Gau des Tages schlechthin gewesen! Wir hatten keinen Rollstuhl, ja noch nicht einmal eine Sitzgelegenheit für mich mit. Meine Eltern und mein Bruder hätten aussteigen und zu Fuß gehen können. Doch ich? Ich war außerdem schon zu groß, als dass mich mein Vater drei Kilometer auf seinen Schultern hätte tragen können. Aber glücklicherweise ließ uns unser Trabi an diesem Tag nicht noch einmal im Stich. Mit Bravour meisterte er jedes noch so tiefe Hindernis und brachte uns treu zu unserem Zelt.
Dort angekommen ließ der Regen schon ein wenig nach. So hatten wir eine wohlverdiente Chance, unsere Sachen trocken ins Zelt zu tragen. Die Stunden unsere Abwesenheit überstand es ohne Schäden. Kein Ast war heruntergekommen und Wasser floss auch nicht hinein.
Nach dem Abendessen legten wir uns recht bald schlafen. Ein wirklich aufregender Tag ging zu Ende. Nur noch ganz leise tröpfelte es auf die Zeltplane, genau die richtige Geräuschkulisse, um einzuschlafen. In der Nacht hörte es dann endlich ganz auf zu regnen und am nächsten Morgen konnten wir die recht kühle, aber saubere Waldluft genießen.