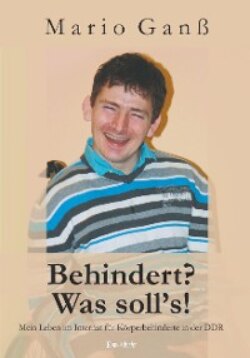Читать книгу Behindert? - Was soll’s! - Mario Ganß - Страница 8
Oehrenfeld
ОглавлениеAm 3. September 1973, ein Montag, war es so weit. Ein neuer Lebensabschnitt sollte für mich, aber auch für meine Eltern beginnen. Dieser Tag muss so prägend für mich gewesen sein, dass ich mich bis heute nahezu an jede Kleinigkeit erinnere.
Da noch immer niemand genau wusste, wo Oehrenfeld genau liegt, wurden meine Mutti und ich in aller Frühe von einem Krankentransport abgeholt. Diese Fahrt war eine unvergessliche Tortur für mich, denn ich musste nahezu während der ganzen Strecke hinten auf der schmalen Pritsche liegen. Zudem roch es sehr stark nach Desinfektionsmittel. Meine Mutti saß die ganze Zeit neben mir. Wegen der Milchverglasung konnte auch sie kaum nach draußen schauen. Bei Halberstadt nahm sie mich auf den Arm, damit ich eine bessere Sicht auf die nun zum Vorschein kommenden Berge hatte. Es zeigten sich schon erste Anzeichen der einsetzenden Laubfärbung. Frau Dr. Reichelt, die Ärztin, die mich vor wenigen Wochen noch nicht einmal einschulen wollte, fuhr mit. Sie saß vorn. Als sie sah, dass meine Mutti mich hochnahm, sagte sie streng: »Aber gleich wieder hinlegen.«
Es war eine Irrfahrt ohne Gleichen. Wenn man nicht richtig sieht bzw. hört, wohin man hinfährt und was da vorne gesprochen wird, ist das doppelt so aufregend. Ja, ich freute mich zu diesem Zeitpunkt immer noch auf das Internat, denn ich ahnte noch nicht, was da auf mich zukommen sollte.
Nach und nach nahm die Zahl der Bäume merkwürdigerweise stark zu. Der Weg wurde unebener und steiniger. Der Fahrer meinte: »Hier können wir nicht richtig sein«, und schon standen wir mit unserem Krankenwagen mitten in einem dunklen Wald. Dies war mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Es dauerte auch nicht lange und ein Soldat mit einem Gewehr kam uns entgegen. Wir mussten irgendwie bis hinter Ilsenburg gefahren sein. Hier begann das Sperrgebiet der damaligen Grenze. Der Wachposten wirkte jedoch recht nett. Er musste den Weg nach Oehrenfeld gekannt haben. Sicherlich waren wir nicht die Ersten, die sich hier verirrt hatten.
Nach etwa einer weiteren Viertelstunde fanden wir Oehrenfeld und das Internat. Ich dachte: »Nun ist es so weit, jetzt kommst du in dieses Internat.« Aus dem Krankenwagen konnte ich nicht wirklich viel erkennen. Ich sah nur einige gelblich gestrichene Baracken und eine Villa, die in Fachwerkbauweise errichtet war. Umgrenzt wurde das Ganze von einem braun-grauen Zaun.
Frau Dr. Reichelt stieg aus und ging zielstrebig in die Villa. In dieser muss sie wohl Leute angetroffen haben, die ihr Auskunft gaben. Als sie zurückkam, winkte sie. Wir sollten weiterfahren. Es gab ein zweites Haus, nicht weit vom ersten entfernt, welches wir auch nach kurzer Zeit fanden.
Es handelte sich um eine weitere schöne, alte Villa. Zu dieser führte ein steiniger Schotterweg, welcher sich kurz vor dem Haus gabelte. Direkt davor stand ein riesiger Ahornbaum.
Der Krankenwagen hielt und wir stiegen aus. Meine Mutti trug mich etwa fünf Stufen hoch und hinein in einen Flachbau, der links die Villa erweiterte. Wir schienen den Eingang für Besucher erwischt zu haben. Erst später stellten wir fest, dass es noch einen ebenerdigen Eingang für die Kinder und die Rollstühle gab, der sich an der rechten Seite der Villa befand. Dies war jedoch für uns in diesem Moment nur nebensächlich.
Zunächst betraten wir einen länglichen Flur, der durch eine Fensterfront recht hell wirkte und nach frisch gestrichenem Holz roch. Niemand war zu sehen. Wir gingen den Flur entlang und kamen in die an den Flachbau angrenzende Villa. Es muss so eine Art Vorraum gewesen sein. Dieser erschien sehr dunkel, da er fast zentral im Haus lag und in ihn kaum Licht fiel. Ein Geruch von alten Mauern und Holz von den Treppen verbreitete sich. Hier trafen wir eine Frau, die zum Personal gehören musste. Sie sprach uns an und führte uns gleich in einen großen Raum, der sehr riesig erschien. In dessen Mitte stand ein deckenstützender Pfeiler. Dieser war im Gegensatz zum Flur regelrecht lichtdurchflutet. Wir standen im Gruppenraum der Vorschule.
Dort saßen, für mich ungewöhnlich, viele Kinder an einem großen langen Tisch sowie auf dem Fußboden. Sie spielten. Zwei Frauen, die Erzieherinnen Fräulein Fischer und Fräulein Kleinert, unterhielten sich gerade an einem weiteren Tisch. Beide waren noch recht jung. Sie konnten noch nicht lange in diesem Beruf tätig gewesen sein. Fräulein Fischer trug lange schwarze Haare und wirkte lang gewachsen und zierlich. Fräulein Kleinert hingegen hatte kurze, helle Haare und erschien etwas kleiner und pummeliger.
Als sie meine Mutti mit mir auf dem Arm sahen, standen sie sofort auf und nahmen uns freundlich in Empfang. Meine Mutti war froh, mich endlich einmal absetzen zu können, denn ich wurde ihr auf dem Arm doch mit der Zeit ziemlich schwer. Ich sollte mich nun zu den anderen Kindern an den Tisch setzen. Auf einen Stuhl! »Aber hier sind ja gar keine seitlich stehenden Stühle, so wie bei Oma!«, dachte ich. Ich bekam Angst! Diese spürte Fräulein Kleinert anscheinend und sagte einfühlsam zu meiner Mutti: »Dann setzen wir ihn hier mit auf die Matte.« Dort konnte ich wie gewohnt sitzen und war erst einmal zufrieden. Neben mir saß ein Junge, Ingo. Ich empfand ihn als einen Riesen. Er war bestimmt einen ganzen Kopf größer als ich.
Meine Mutti nahm an dem Tisch der beiden jungen Erzieherinnen Platz. Sie sprachen sicherlich über einige organisatorische Dinge. Dies interessierte mich wenig. Zunächst! Ich spielte mit Ingo. Er hatte einen schönen großen Bagger, der mich mehr interessierte. Obwohl Ingo so riesig war, freundete ich mich mit ihm gleich an.
Auf einmal schaute ich zu Mutti. Doch an dem Tisch saß sie nicht mehr! Aufgeregt und völlig aufgelöst sah ich mich im Raum um. Mutti war weg! Einfach nicht mehr da! Und richtig. Auf Anraten von Fräulein Fischer und Fräulein Kleinert schlich sich meine Mutti in einem Augenblick, in dem ich abgelenkt spielte, aus dem Raum.
Noch nie zuvor gesehene, dicke Tränen schossen mir ins Gesicht. Ich fing nicht an leise zu weinen, sondern brüllte aus voller Kehle drauf los. Nun wusste ich, was es hieß, in einem Internat zu sein. Getrennt von den Lieben zu Hause und von der gewohnten Umgebung. Ich schrie fast das ganze Haus zusammen. Irgendwie schafften es die beiden Erzieherinnen mich zu beruhigen. Fräulein Kleinert nahm mich mit Bedacht auf ihren Arm, setzte mich an den großen Tisch und blieb neben mir sitzen. So milderte sie meine Angst, vom Stuhl zu fallen. Es gab Mittagessen, Grießbrei mit Kirschen. Liebevoll fütterte sie mich.
Nun war ich in Oehrenfeld, einer Schule für körperbehinderte Kinder und Jugendliche, der ein Internat angehörte. Eigentlich stimmt dieser Sachverhalt nicht ganz. Es verhielt sich tatsächlich andersrum. Die »Heilstätte für konservative Orthopädie«, so die damalige korrekte Bezeichnung, war eine Einrichtung des Gesundheitswesens – also ein Internat mit angeschlossener zehnklassiger Oberschule, die den Jugendlichen einen allgemein anerkannten Schulabschluss ermöglichte. Zwar gab es einen schulischen Direktor, Herrn Rudi Mertens, doch der Arzt, Herr Medizinalrat Dr. Werner Friedrich war Leiter dieser Einrichtung.
Die Einrichtung in Oehrenfeld existierte schon seit 1924. Sie diente zunächst hilfsbedürftigen Kindern als Erholungsstätte. Der Arzt Dr. Helmut Eckhardt (Name nicht geändert) gründete hieraus 1955 diese Heilstätte des Gesundheitswesens mit besagter Schule.
Die gesamte Einrichtung unterteilte sich in zwei Komplexe, einen größeren, genannt »Heim I« und einen kleineren, dem »Heim II«. Beide lagen etwa 500 Meter auseinander.
Im größeren Komplex waren die Kinder und Jugendlichen der Klassen 3 bis 10 untergebracht. Diesen Komplex sollte ich erst einige Jahre später kennen lernen.
Das »Heim II« bestand aus der schon erwähnten alten Villa und dahinter einem schönen großen Garten mit einem Spielplatz.
Etwa zehn Meter rechts seitlich und parallel zur Villa stand ein ziemlich großer Backsteinbau mit einem hohen Schornstein. Die beiden Gebäude schlossen so den Hof ein. Neben zahlreichen Kammern zum Aufbewahren von Gartengeräten und -möbeln befand sich in diesem Steinbau auch der Heizungskeller. Von hier aus wurde die gesamte Villa geheizt. Quer über den Hof ging in gewisser Höhe ein dickes, eingepacktes Rohr, wahrscheinlich der Vorlauf für die Heizung. Direkt darunter auf dem Boden sah man einen abgedeckten Schacht. In ihm verlief entsprechend das Rohr für den Rücklauf der Heizung.
Den Backsteinbau und die Villa verbanden im hinteren Drittel des Hofes ein Schleppdach und eine auf der Rückseite der zwei Gebäude verbindende Bretterwand. Durch diese Wand führte eine kleine Tür in den Garten. Den größten Teil des so überdachten Hofes nahm das Lager für die benötigte Kohle in Anspruch.
Ach ja, an dem sogenannten Heizhaus befand sich noch ein winziger Seitenanbau, der dem Personal Platz für ihre Toilette bot. Es muss im Winter auf diesem Örtchen bestimmt lausig kalt gewesen sein, wenn jemand dort hinüber ging.
Das gesamte Grundstück umgab ein dunkelbraun gestrichener Zaun. Auf der Länge zwischen den beiden Gebäuden war er höher und die Bretter so eng, dass man kaum hindurch sehen konnte. Hinter dem niedrigen Zaun sah man schön angelegte Blumenrabatten.
Die Villa hatte ein Erdgeschoss, eine obere Etage sowie einen ausgebauten Dachboden. Das Erdgeschoss war seitlich noch um den schon erwähnten Flachbau erweitert worden. Auf der gesamten unteren Ebene fand man den Raum für die Vorschule, welcher auch der größte war. Außerdem befanden sich hier einige Schlafräume, der Waschraum, ein bis zwei Klassenzimmer sowie der Gymnastikraum. In einer kleinen Küche bereitete man die Mahlzeiten zu. Das Mittagessen wurde jedoch jeden Tag aus der großen Küche gebracht, die sich im »Heim I« befand.
Die obere Etage des »Heims II« beherbergte zwei weitere Klassenräume, einen kleinen Aufenthaltsraum für das Personal sowie weitere Schlafräume. Zu diesen Räumlichkeiten führten zwei Treppen. Einige Kinder, die unten ihren Klassenraum hatten, schliefen teilweise hier oben. Diejenigen, die nicht allein die Treppen hinauf kamen, wurden hoch getragen. Einen Fahrstuhl gab es nicht.
Im Dachgeschoss richtete man einige Zimmer für das Personal her, welches von weiter entfernt kam und nicht jeden Tag zur Arbeit fahren konnte. Hier oben hatten ebenfalls die Lehrer ihr Zimmer. Desweiteren existierten auf dem Boden noch kleine Kammern, die zur Aufbewahrung von Dingen jeglicher Art dienten.
Im Innenbereich des Heims II sah man kaum Rollstühle, das war den Kindern aber egal, da sie sich auch ohne gut fortbewegen konnten. Wir bewegten uns so vorwärts, wie wir es von zu Hause her gewohnt waren, meistens krabbelnd. Sollten die Hände nach dem Waschen einmal sauber bleiben, dann wurden wir von den Erziehern oder Pflegern an den Tisch gesetzt oder ins Bett getragen.
Für unser körperliches Wohlbefinden kümmerte sich das pflegerische Personal. Es sorgte unter anderem für hygienische und medizinische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Medikamentengabe. Neben den Lehrern waren auch Erzieher tätig, die uns hauptsächlich am Nachmittag betreuten und mit uns beispielsweise Hausaufgaben machten. Aber die Erzieher brachten uns abends auch ins Bett und unsere Pflegekräfte schauten uns bei den Hausaufgaben schon mal über die Schulter. Es war ein harmonisches Zusammenspiel der Mitarbeiter, ein Hand in Hand aller Angestellten. Durch diese enge Zusammenarbeit entstand eine Atmosphäre, die einer Großfamilie glich. Egal ob Lehrer, Erzieher oder Pfleger, der eine war einfach für den anderen da, wenn auch vornehmlich für seinen zuständigen Bereich. Niemand hielt sich für etwas Besseres! Jeder der Beschäftigten brachte uns Kindern seine ganz eigene Fürsorge, ja teilweise Liebe entgegen. Wir fühlten uns geborgen! Und gerade dieses persönliche Engagement der Mitarbeiter machte unter anderem das Einmalige dieser Einrichtung aus.
Schnell lebte ich mich in Oehrenfeld ein. Das Leben und das Spielen in der Vorschule mit den anderen Kindern machten mir richtig viel Spaß. Ich lachte viel und gern.
Seitdem ich in Oehrenfeld war, hatte ich ein Problem. Ich konnte immer noch nicht ohne Unterstützung allein auf einem Stuhl sitzen. Eines Tages kam Fräulein Kleinert auf die Idee, einmal auf dem Dachboden zu sehen, ob sich dort nicht noch eine alte Sitzgelegenheit auftreiben ließ. Und tatsächlich wurde sie fündig. Es war ein ganz kleines niedriges Stühlchen aus Holz. Schnell befreite sie es vom Schmutz. Zu meiner Freude hatte der Stuhl sogar seitliche Lehnen. Der schien gerade auf mich gewartet zu haben! Als der Stuhl sauber war, wurde ich gleich hineingesetzt. Jeder war gespannt, wie ich mit ihm zurechtkam.
Ein erster Erfolg zeigte sich dann gleich. Ich schrie schon mal nicht mehr. Doch noch immer muss ich Angst gehabt haben. Ich machte mich so steif, dass ich die Beine hochnahm und so nach vorne vom Stuhl rutschte. Es half nur noch eine Methode. Man holte eine Binde und wickelte sie um mich und die Rückenlehne des Stuhles. So konnte ich wenigstens halbwegs – »gefesselt« – allein auf einem Stuhl sitzen. Eine Lösung auf Dauer war dies natürlich nicht. Da half nur eins: Physiotherapie!
Um unsere körperlichen Fähigkeiten zu testen und zu fördern, hatten wir von Anfang an Physiotherapie. (Dies wurde bei uns früher als »Heilgymnastik« bezeichnet. Später sagte man aber »Physiotherapie«, da das Wort »Heil…« nicht mehr genannt werden sollte, weil es an vergangene Zeiten erinnerte.)
Fast alle Kinder gingen überhaupt nicht gern dorthin. Dies hatte einen triftigen Grund: die Physiotherapeutin Frau Ziegenbarth, eine schon ältere Frau. Sie erschien in kräftiger und hochgewachsener Gestalt mit grau meliertem Pagenschnitt. Die Frau trat sehr resolut auf. Schon allein dies flößte uns gehörigen Respekt ein. Sie hatte außerdem Methoden, einem etwas beizubringen, die aus damaliger Sicht haarsträubend, ja fast unmenschlich waren. Diese sollte jeder von uns mehr oder weniger stark zu spüren bekommen.
Wie schon erwähnt, konnte ich kaum auf einem normalen Stuhl sitzen, geschweige dann auf einer Turnbank. Doch dies sollte ich nun erlernen:
Frau Ziegenbarth setzte mich auf eine solche Bank. Ich machte mich sofort steif und rutschte gleich wieder hinunter. Unsere Therapeutin setzte mich ein weiteres Mal auf diese Bank und schwups lag ich erneut unten. Das Spielchen ging ewig. Frau Ziegenbarth schien unendliche Ausdauer zu haben, ich aber auch! Letztendlich schmiss ich mich schon aus Gnatz auf den Boden. Ich schrie, kratzte und biss sogar. Sie packte mich immer wieder an den Sachen und stauchte mich regelrecht auf die Bank. Ich weinte bitterlich und rief nach meinen Eltern. Doch die waren ja nun einmal nicht da. Ich dachte: »Das scheint die auszunutzen.«
Mit der Zeit merkte ich langsam, dass ich mit Gnatz und einem Böckchen bei Frau Ziegenbarth nicht durchkam. Dies schien ihr Herz nicht zu erweichen. Ich zeigte einen guten Willen. Und siehe da, sie wurde auf einmal ganz zugänglich. Nun übte sie mit mir ganz ruhig und verständnisvoll das Sitzen auf der Turnbank. Bald konnte ich es. Von da an klappte auch das Sitzen auf meinem Stühlchen alleine und ohne fesselnde Binde.
Frau Ziegenbarth hatte allgemein sehr eigene Methoden, uns Kindern etwas beizubringen. So zum Beispiel bei denjenigen, die durch eine Halbseitenlähmung ihren einen Arm beziehungsweise ihre Hand nicht richtig bewegen konnten. Sobald sie merkte, dass dieses Kind keinen Willen zeigte, seinen »kranken« Arm zu benutzen, band sie den »gesunden« auf den Rücken. So wurde das Kind kurzerhand gezwungen, seine gelähmte Hand beziehungsweise seinen Arm zu benutzen.
Viele Eltern beschwerten sich bei Herrn Mertens und Herrn Friedrich über die Behandlungsmethoden von Frau Ziegenbarth. Erfolg hatten sie kaum. So gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Eltern nahmen ihre Kinder aus der Physiotherapie oder sie duldeten die ungewöhnlichen Lernmethoden. Meine entschieden sich für Letzteres, wofür ich ihnen heute sehr dankbar bin!
Einsicht kommt meistens spät. So verhält es sich auch bei mir. Aber wie soll man als kleines Kind wissen, dass es so eine Frau im Grunde nur gut mit einem meint? Man denkt in diesem Augenblick nur: »Die Frau tut mir weh. Die ist böse.« Was Frau Ziegenbarth mit ihren durchaus umstrittenen Methoden bezwecken wollte, das begreift man erst hinterher.