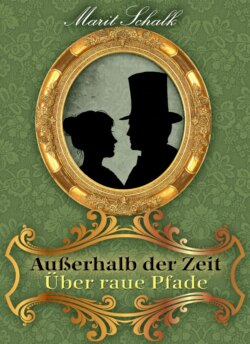Читать книгу Außerhalb der Zeit - Marit Schalk - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 9
ОглавлениеFreitag, 20. August 1841
Es wird spät an diesem Abend. Was nicht weiter verwunderlich ist, haben die Sievekings und ich doch mehr als genug Gesprächsstoff.
Nachdem Eduard mir angeboten hat, weiterhin im Haus wohnen zu bleiben, machen wir uns zunächst zu dritt Gedanken darüber, wie man den übrigen Zeitgenossen mein plötzliches Auftauchen möglichst glaubhaft erklären könnte.
„Ich habe von Ida bereits gehört, dass ich eine Schiffbrüchige bin, die vor wilden Piraten gerettet werden musste“, berichte ich den Herren. Dabei lege ich bewusst eine übertriebene Dramatik in die Stimme, um deutlich zu machen, dass ich die Geschichte für zu dick aufgetragen halte und werfe einen spöttischen Blick auf Henry Sieveking, der sich diese schräge Story ja wohl ausgedacht hat.
Er zieht es jedoch vor, meine Provokation zu ignorieren und gibt vor mit dem Paffen seiner Pfeife vollauf beschäftigt zu sein.
„Aber die Idee ist ja vortrefflich!“, ruft sein Bruder begeistert aus. „Ein solcher Überfall würde erklären, warum Sie offensichtlich überhaupt kein richtiges Gepäck und keine Kleider besitzen. Dafür erweist sich zudem der Umstand, dass Henry just gestern aus Afrika zurückgekehrt ist als äußerst segensreich.“
„Das würde aber bedeuten, dass ich vorgeben muss, ebenfalls aus Afrika zu kommen. Haben Sie auch schon einen Vorschlag, was ich dort gemacht habe?“, erkundige ich mich gespannt.
„Leider noch nicht. Vielleicht können wir gemeinsam etwas Glaubhaftes erfinden?“, schlägt er vor.
Das ist ja nett. Ich darf also mal etwas mitentscheiden. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen! Zum Glück bin ich in Geografie etwas besser bewandert, als in Geschichte. Diesen Umstand habe ich auch Caro zu verdanken, die jeden Cent, den sie im Buchladen verdient in Fernreisen investiert, zu denen sie sich am eigenen Arbeitsplatz inspirieren lässt. Dementsprechend hat sie als Couch-Surferin schon viele exotische Orte und Städte bereist und mir von dort die eine oder andere Postkarte geschickt – zumindest bis vor ein paar Jahren noch, als das noch nicht als altmodisch galt. Dank Caro weiß ich daher, ohne im Internet recherchieren zu müssen, dass Sansibar eine Insel im Indischen Ozean ist, direkt vor der Küste Afrikas und dass die Insel zu Tansania gehört – zu meiner Zeit jedenfalls.
Eduard Sieveking ergänzt, dass die Insel im Jahr 1841 unabhängig ist und von einem Sultan regiert wird.
Auf Grundlage dieser Basisinformationen, lasse ich dann meiner Fantasie hemmungslos freien Lauf.
Leider finden meine Ideen zunächst nicht den begeisterten Zuspruch, den ich erwartet hätte. Meine Vorschläge, als Missionarin auf dem Festland tätig gewesen zu sein oder als wohltätige Schwester in den Armenvierteln von Daressalam, werden beide als vollkommen unglaubwürdig abgeschmettert. „Wie wäre es, wenn ich eine dem Harem entflohene Ehefrau des Sultans von Sansibar bin?“, schlage ich als nächstes vor, woraufhin ich von den beiden Brüdern um ein Haar ausgebuht werde. Ich vermute, einzig die Tatsache, dass die Sievekings zu wohlerzogen dazu sind, hindert sie daran.
„Dies ist nicht nur unglaubwürdig, sondern auch extrem abträglich für die guten geschäftlichen Beziehungen unserer Firma ins Sultanat, sollte dem Sultan diese Geschichte jemals zu Ohren kommen“, so lautet das einhellige vernichtende Urteil der Herren.
Nach einigem Hin und Her einigen wir uns schließlich auf Folgendes: Ich bin Magdalena Jensen, die unverheiratete Tochter des Abenteurers und Forschers Adam Jensen, der auf Sansibar bedauerlicherweise dem Malariafieber erlegen ist. Da ich weder auf Sansibar noch sonstwo auf der Welt weitere Verwandte habe (was ja wohl derzeit leider mehr als wahr sein dürfte), habe ich ein Schiff in die norddeutsche Heimat bestiegen, das bedauerlicherweise kurz darauf von Piraten überfallen wurde. Glücklicherweise kam Henry Sieveking gerade im richtigen Augenblick des Weges, um mich aus dem Indischen Ozean zu fischen (diese Stelle empfinde ich persönlich als den größten Schwachpunkt in unserem Konstrukt) und nach Hamburg zurück zu bringen, wo ich so lange zu bleiben gedenke, bis ich mir über meine weitere Zukunft im Klaren bin (wie wahr, wie wahr).
Mal abgesehen vom Malariatod meines armen Vaters (der im Übrigen Günther heißt, aber, um Eduard Sieveking zu zitieren: „Kein Mensch heißt heutzutage Günther!“) und der Tatsache, dass es mir etwas unglaubwürdig vorkommt, Henry Sieveking würde zur Rettung von wem auch immer in den Ozean springen, gefällt mir diese Geschichte sehr gut.
Weniger Gefallen finde ich an der Idee, dass ich als Frau im 19. Jahrhundert ohne Vater oder Ehemann eine Art Vormund brauche, der meine sämtlichen Angelegenheiten regelt, wie mich die Herren Sieveking netterweise aufklären. Es ist bezeichnenderweise einer der ersten Punkte, über den sie sich Gedanken machen, nachdem wir uns meine hübsche kleine Biografie ausgedacht haben.
„Wo gibt es denn sowas?!“, brause ich auf. „Ich bin schon seit einigen Jahren volljährig, habe einen Job und verdiene mein eigenes Geld – das Letzte, was ich brauche, ist ein Vormund!“
„Aber als Frauenzimmer bedürfen Sie doch sowohl der geschäftlichen Vertretung, als auch des Schutzes“, entgegnet Eduard Sieveking, sichtlich verwundert darüber, dass mich dieses in seinen Augen wohl offensichtliche Naturgesetz derart auf die Palme bringt. „Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich dies in Ihrem Jahrtausend geändert haben sollte?“
„Es hat sich geändert! Das können Sie mir glauben!“, versichere ich ihm mit Nachdruck.
Aus seinem Blick spricht nun aufrichtige Sorge. Die Vorstellung, dass Frauen ein von Männern unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen könnten, übersteigt sichtlich seinen Horizont. Erstaunlich eigentlich. Bisher machte er auf mich einen ganz intelligenten Eindruck.
„Und wer, wenn ich fragen darf, verteidigt dann Ihre Ehre und wacht über Ihren guten Ruf?“, gibt er nicht auf.
„Nun, bisher offenbar sie selbst – mit eher bescheidenem Erfolg, wie wir alle heute unschwer feststellen konnten“, lässt sein Bruder verlauten und lächelt herablassend.
Ob dieser selbstgerechte Idiot wohl auch mal etwas Sinnvolles zum Gespräch beitragen kann? Verärgert setze ich dazu an, ihn und sein vorlautes Mundwerk in die Schranken zu weisen, bremse mich aber im letzten Augenblick. Zum einen scheint es mir wenig ratsam sich mit den einzigen Menschen anzulegen, die ich derzeit hier in Hamburg kenne und die noch dazu bereit sind, mir in meiner prekären Lage zu helfen. Zum anderen führt mir unsere kleine Meinungsverschiedenheit deutlich vor Augen, wie wenig Ahnung ich eigentlich von den Sitten und Moralvorstellungen dieser Zeit habe, in die ich da hineingestolpert bin. Was ich jetzt bräuchte, wäre so eine Art Reiseführer für Zeitreisende. Aber ich fürchte, den gibt es noch nicht einmal bei „Dr. Krothe“ zu kaufen.
„Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mich bei sich aufnehmen und mir helfen wollen nach Hause… also in meine Zeit… zurückzukehren“, wechsle ich das Thema. „Ich bin mir bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Schließlich bin ich für Sie eine vollkommen fremde Person.“
Eduard Sieveking winkt ab, als sei es nicht der Rede wert, aber ich fahre unbeirrt fort: „Gerne würde ich mich für Ihre Freundlichkeit erkenntlich zeigen und mich an den zweifellos entstehenden Unkosten beteiligen, soweit es mir möglich ist. Nach der Erfahrung heute auf dem Marktplatz, muss ich allerdings wohl davon ausgehen, dass auch Sie kein Interesse an meinen Euros haben?“
Die Sievekings wechseln einen kurzen Blick. Dann antwortet der jüngere Bruder stellvertretend für beide: „Bedaure. Nein.“
„Nicht einmal, wenn Sie es als Zukunftsinvestition verbuchen?“, gebe ich nicht so schnell auf.
„Vergessen Sie’s“ winkt der grimmige Henry ab.
„Na gut. Kann ich mich denn dann sonst irgendwie hier nützlich machen? Vielleicht indem ich Ihnen im Kontor zur Hand gehe?“, erkundige ich mich.
Eduard Sieveking lächelt wohlwollend, aber sichtlich amüsiert. „Sie wollen arbeiten?“, fragt er ungläubig nach. „Im Kontor?“
„Schon klar. Frauen arbeiten in dieser Zeit nicht in einem Kontor, stimmt’s?“, nehme ich seine Absage vorweg, und kann meine Enttäuschung darüber nicht ganz verbergen.
„Stimmt“, nickt der grimmige Henry.
Ich meine einen leichten Hauch von Häme in seiner Stimme wahrzunehmen. Es ist allerdings auch möglich, dass ich mich irre. „Nicht einmal, um ihren Gastgebern einen Teil der Unkosten für ihre Beherbergung zurückzuzahlen?“, wage ich einen letzten Versuch.
„Nicht einmal dann. Bedaure“, wiederholt der nettere der beiden entschuldigend und meint tröstend: „Betrachten Sie sich einfach als unser Gast, und machen Sie sich über die Unkosten keine Gedanken. Schließlich wird uns nicht alle Tage die Ehre zuteil, eine Zeitreisende zu beherbergen.“
„Oh, ich wüsste da schon eine Möglichkeit, wie Sie zu Ihrem Unterhalt beitragen könnten“, lässt sich da sein Bruder vernehmen.
Eduard Sieveking hebt ebenso überrascht die Augenbrauen wie ich.
Sein älterer Bruder lässt sich bewusst Zeit, bevor er weiterspricht. Er zieht noch einmal genüsslich an seiner Pfeife und bläst einen vanilleduftigen Rauchkringel in die Luft, bevor er sich an mich wendet: „Es scheint Ihnen wichtig zu sein zu arbeiten und einen Beruf zu haben, nicht wahr?“
Ich nicke knapp.
„Also gut. Dann werde ich Sie einstellen“, eröffnet er mir.
„Als was denn bloß?“, erkundigt sich sein Bruder ratlos.
„Als Gouvernante“, verkündet er, als liege die Antwort doch auf der Hand.
Ich schlucke hart, denn dieser Vorschlag behagt mir spontan erst einmal überhaupt nicht, habe ich von Kindererziehung doch nicht den leisesten Schimmer. Einzig die Erkenntnis, dass dies die einzige berufliche Tätigkeit ist, die die Sievekings mir wohl zugestehen werden, lässt mich ein zustimmendes, wenn auch eher zögerliches „Okay“ aussprechen.
Im Folgenden besprechen wir dann zunächst noch weitere Details meines Aufenthaltes. Da sämtliche Sieveking-Kinder sich derzeit noch im Sommerhaus an der Elbe aufhalten, wo sie von einem Kindermädchen und einem Studienrat betreut werden, beschließen wir, dass ich in den nächsten Tagen noch von meinen Aufgaben freigestellt bleibe, um mich ein wenig einleben zu können und ein wenig Zeit zu gewinnen, damit man mir angemessene eigene Kleidung besorgen kann. Danach schwenkt das Gespräch auf andere Themen um.
Die beiden Brüder beginnen damit, mir neugierige Fragen über das Leben in der Zukunft zu stellen. Sehr verständlich. Wer täte das nicht, wenn ihm ein Zeitreisender gegenübersäße?
Also berichte ich über Kutschen ohne Pferde und über Flugmaschinen, welche die Menschen binnen weniger Stunden bis in den letzten Winkel der Erde bringen. Wenn es sein muss, sogar bis zur vorletzten verzeichneten Jurte in der hinteren Mongolei, um Caro zu zitieren.
Meine Gastgeber hören mir staunend zu. Selbst der grimmige Henry legt etwas von seiner Reserviertheit ab und stellt interessierte Fragen. Ganz besonders beschäftigt ihn, ob die Dampfschifffahrt wohl den aktuellen Großseglern jemals den Rang ablaufen wird.
Ich berichte daraufhin von riesigen Dampfern, die im vorigen Jahrhundert Passagiere über den Atlantik brachten und von den gigantischen Containerschiffen, die schließlich zu meiner Zeit die Weltmeere und den Hamburger Hafen prägen.
Die Vorstellung, dass man schier unendliche Mengen an Waren in metallene Kisten packt und dann unter optimaler Ausnutzung der Schiffsladefläche in alle Welt transportieren kann, sorgt bei den beiden Reedern und Kaufleuten natürlich für leuchtende Augen.
Es geht schon auf Mitternacht an, als wir unsere kleine Runde auflösen und uns in unsere Schlafräume zurückziehen.
Nun liege ich wieder in dem weichen Bett, in dem ich heute Morgen erwacht bin. Obwohl ich von den Ereignissen des Tages eigentlich fix und fertig bin, fühle ich mich noch viel zu aufgekratzt, um zu schlafen. Stattdessen liege ich mit weit geöffneten Augen da und beobachte die Schatten, die das Licht der brennenden Kerze auf dem Nachttisch in den Winkeln des Zimmers erzeugt und versuche der Flut der Bilder Herr zu werden, die innerlich in schneller Abfolge auf mich einstürmen: das kreischende Marktweib, die grinsenden Gassenjungen, der Unfall mit dem Sargtransport und der messerbewehrte Busengrabscher…
Dazwischen aber auch der majestätische Anblick der Segelschiffe unten im Hafen, das Gesicht Eduard Sievekings, wie er mir wohlwollend zunickt und mir das Gefühl gibt in dieser fremden Umwelt nicht vollkommen ohne Freund dazustehen. Und schließlich Henry Sieveking. Seine aufrechte Gestalt, die mich mit gezückter Waffe vor dem Widerling rettet. Der lebhafte Ausdruck auf seinem Gesicht, als er mich über die Zukunft der Schifffahrt befragt. Die Entschlossenheit, mit der er mich aus dem Labyrinth des Gängeviertels geführt hat. Die Intensität seiner blauen Augen, die ich wahrgenommen zu haben glaube, Bruchteile von Sekunden bevor ich vor Hitze und Erschöpfung zusammenbrach.
Aber auch die herablassende Miene, mit der er mich die meiste Zeit über mustert und der ablehnende, fast schon feindselige Ausdruck auf seinem Gesicht, als er mich in dem blassgrünen Kleid zum Essen kommen sah.
Ich werde Ida morgen fragen, ob sie wohl noch ein anderes Kleid auftreiben kann, das mir passt. Mit dem, das sie mir da heute gegeben hat, scheint ja offensichtlich irgendetwas nicht zu stimmen. Wahrscheinlich hat es mal der Königin von Saba gehört, oder der Kaiserin von China – mindestens.
Nachdem ich die Kerze gelöscht habe, gelten meine letzten Gedanken Gregor und Alex. Ob die beiden gesehen haben, was mit mir passiert ist? Wie ich durch die Spiegelscheibe gekracht bin, quasi als Gefolge der kitschigen Schäferin? Bestimmt machen die beiden sich Sorgen. Besonders Gregor dreht bestimmt fast durch. So würde es mir jedenfalls gehen, wenn mein Zwilling in einen Spiegel fällt und dann…
Ja, was eigentlich? Was genau ist wohl mit mir passiert? Habe ich mich vor den Augen der beiden in Luft aufgelöst? Oder ist mein Körper noch in 2016, und ich liege eigentlich im Koma und bilde mir das alles hier nur ein?! Ich kneife mich fest in den Arm. Es tut weh. Würde es wehtun, wenn ich im Koma läge? Ich glaube nicht. Sonst würde man in meinem Jahrhundert Schwerverletzte doch nicht ins künstliche Koma legen, um ihnen Schmerzen zu ersparen? Das würde doch dann gar keinen Sinn machen. Oder? … Über diesen Gedanken schlafe ich endlich ein.
Sonntag, 21. August 2016
„Heute Nachmittag fahre ich ins Pflegeheim“, verkündet Alex, während er seinen Kaffeebecher leert, „vielleicht kann Opa mir noch etwas über den Spiegel erzählen, das ich nicht weiß.“ Er sitzt mit Gregor im Laden, nachdem sie eine weitere Nacht dort auf dem Fußboden verbracht haben. Immer noch in der Hoffnung, Lena möge plötzlich wieder vor ihnen auftauchen und ihnen vielleicht sogar eine schlüssige Erklärung liefern, was mit ihr passiert ist.
Aber leider ist gar nichts passiert. Lena ist und bleibt verschwunden. Und der zerbrochene Spiegel steht einfach nur da und weigert sich, ihnen sein Geheimnis zu enthüllen.
Gregor ist inzwischen vollkommen fertig. Obwohl er zwischendurch einmal nach Hause gefahren ist, um zu duschen und sich frische Sachen zu holen, während Alex im Laden aufpasste, sieht er völlig zerzaust aus. Seine Augen sind dunkel umrandet und in seinem Gesicht zeichnen sich feine Linien ab, hervorgerufen durch die Müdigkeit.
Alex ist sich bewusst, dass er keinen Deut frischer aussieht. Auch an ihm sind die schier endlose Warterei und die Sorge um Lena nicht spurlos vorübergegangen. Umso mehr drängt es ihn, etwas gegen die Ungewissheit zu unternehmen und aktiv zu werden. Seine Telefonate gestern waren ein erster Schritt, auch wenn sie zunächst in eine Sackgasse geführt zu haben scheinen. Die nächste Maßnahme, von der er sich etwas erhofft, ist ein Anruf beim Stadtarchiv von Lohr. Aber heute, am Sonntag, kommt er dort nicht weiter.
„Wie sieht’s aus? Magst du mitkommen?“, fragt er Gregor.
Gregor sieht freudig überrascht von seiner Kaffeetasse auf, in der er bisher trübsinnig herumgerührt hat. „Du willst mich mit zu deinem Opa nehmen?“ Er zögert, bevor er weiterspricht: „Weiß dein Opa denn, wer ich bin? Also, dass wir zusammen sind, meine ich? Und überhaupt, weiß er, dass du …“
„Dass ich schwul bin, weiß Opa schon lange“, unterbricht Alex ihn, „und er hat kein Problem damit. Mein Opa ist zwar alt, aber nicht von gestern – im Gegensatz zu meinen Eltern. Aber das ist eine andere Geschichte.“ Ein Schatten huscht über sein Gesicht, der aber schnell wieder verschwindet, als er weiterspricht: „Ich denke, Opa würde sich freuen, dich kennen zu lernen.“
Gregor setzt zu einem Einwand an, aber Alex, der bereits ahnt, was sein Freund sagen will, nimmt ihm den Wind aus den Segeln: „Und dir würde es guttun, wenn du hier mal rauskommst! Sonst bastelst du doch wieder stundenlang an dieser Spiegelscheibe und drehst mir irgendwann noch durch!“
„Aber was ist, wenn Lena genau in dieser Zeit zurückkommt?“, wagt Gregor nun doch einzuwenden.
„Lena kann lesen! Für den Fall, dass sie ausgerechnet während unserer Abwesenheit wieder auftaucht, legen wir ihr einen Zettel vor den Spiegel mit der Bitte sich sofort bei dir auf dem Handy zu melden“, schlägt Alex vor. „Okay?“
„Okay“, nickt Gregor. „Wahrscheinlich hast du recht. Es macht mich nur fertig, wenn ich die ganze Zeit wie ein Wachhund vor diesem Spiegel sitze. Und außerdem“, er lächelt Alex an, „freue ich mich, dass du mich deinem Opa vorstellst.“
Samstag, 21. August 1841
Ich bin jetzt eine Gouvernante. Dies ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, als ich am nächsten Morgen aufwache.
Eine Gouvernante zu sein stelle ich mir grauenhaft vor, und ich fürchte auch, für den Job nicht allzu gut qualifiziert zu sein. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die mir letzten Endes übrig geblieben ist, um mir meinen Lebensunterhalt hier zu verdienen und meinen Gastgebern nicht mehr als nötig auf der Tasche zu liegen: Zum einen wollten die Sievekings die Euroscheine aus meinem Portemonnaie partout nicht haben. Zum anderen sieht die Gesellschaft, in der ich da gelandet bin, es schlichtweg nicht vor, dass Frauen irgendeinen Beruf ausüben. Das einzige, was für eine Frau „von Stand“ gerade noch so durchgeht, ist eben eine Stelle als Gouvernante.
Gouvernante! Allein das Wort klingt schon furchtbar streng und steif. Unwillkürlich steht mir das Bild von Fräulein Rottenmeier aus „Heidi“ vor Augen und lässt mich schaudern. Muss ich ab jetzt auch immer herumzetern und „Erbarmung!“ schreien, wenn die Kinder nicht machen, was ich von ihnen erwarte? Hoffentlich nicht. Überhaupt: die Kinder! Von einer Gouvernante wird erwartet, dass sie Kinder erzieht. Ich habe nicht die geringste Ahnung von Kindern. Von den Erziehungszielen im 19. Jahrhundert gar nicht erst zu reden! Und was werden das wohl für Kinder sein, die einen mürrischen, stocksteifen Henry Sieveking zum Vater haben? Zum Glück sind sie nicht mehr ganz so klein, sodass man wahrscheinlich schon mit ihnen reden kann. Die Tochter Sophie ist schon vierzehn, der Junge Carl zehn Jahre alt. Die beiden hatten bisher keine eigene Erzieherin. Stattdessen sind sie vom Kindermädchen mitbetreut worden, das Eduard Sieveking und seine Frau für ihre eigenen drei Kinder eingestellt haben. Deren Nachwuchs ist jedoch jünger als der des grimmigen Henry, weshalb ich das Kindermädchen ab der kommenden Woche entlasten soll. So jedenfalls lautet der Plan.
Seufzend stehe ich aus dem Bett auf. Bis ich zum Sommerhaus der Familie umziehe und die Sieveking-Kinder kennen lerne, bleiben mir zum Glück noch ein paar Tage Schonfrist.
Bald darauf betritt Ida das Zimmer und bringt mir warmes Wasser zum Waschen.
Da mir in dem hellgrünen Kleid gestern so unwohl war, bitte ich sie, mir ein anderes zu bringen.
Kurze Zeit später erscheint sie mit einem schlichteren Kleid aus braunem Stoff mit beigefarbenen Streifen, das mir glücklicherweise genauso gut passt wie das von gestern. – Und das nicht ganz so ausgebeulte Ärmel hat, wie ich erleichtert feststellen kann. Was für ein Segen! Für das gestrige Abendessen musste ich nämlich in diesen Hammelkeulenärmeln mein ganzes motorisches Geschick aufbieten, damit ich nicht versehentlich etwas umstoße oder mit dem teuren Stoff in der Suppe hänge.
Als ich nach dem Anziehen das Speisezimmer betrete, finde ich es leer vor. Der riesige Tisch ist nur für eine Person gedeckt. Für mich.
Ida informiert mich, dass die beiden Herren schon seit Stunden auf den Beinen sind und sich um ihre Geschäfte kümmern.
Während ich mir ein Brötchen mit Butter und Marmelade schmiere, überlege ich, womit ich mich wohl den ganzen Tag werde beschäftigen können. Der Sinn nach einem Stadtbummel ist mir seit gestern fürs erste vergangen. Was macht also eine Frau in diesem Jahrhundert, wenn sie nichts zu tun hat?
Wie sich schnell herausstellt, habe ich mir diese Gedanken ganz umsonst gemacht, denn schon bald nach dem Frühstück kündigt Ida mir den Besuch von Schneidermeister Gercke an, der beauftragt wurde, mir eine neue Grundausstattung an Kleidern anzufertigen.
Der Vormittag vergeht also damit, dass Meister Gercke meine Maße nimmt und mir anhand einer Auswahl an Stoffen erläutert, welche Arten von Kleidern er mir jeweils daraus zu nähen gedenkt: Vier Alltagskleider, davon eins noch für den jetzigen Spätsommer mit kurzen Ballonärmeln und drei langärmlige sowie ein Sonntagskleid. Dazu noch entsprechend farblich passende Schals und eine wärmende Pelerine für den nahenden Herbst. So hat es der grimmige Henry bestellt. Woraus ich den Schluss ziehe, dass er nicht damit rechnet, mich binnen weniger Tage bereits wieder in Richtung Zukunft loszuwerden, sondern davon ausgeht mich für länger ertragen zu müssen.
Zwar will ich nicht hoffen, dass er mit seiner Einschätzung recht behält, trotzdem bin ich dankbar für seine Voraussicht. Wenn ich Pech habe und es eine Weile dauert bis ich einen Weg finde, um nach Hause zurückzukehren, habe ich wenigstens genügend anzuziehen, um hier in der Stadt nicht weiter dumm aufzufallen.
Ich nicke alles ab, was Schneider Gercke mir vorschlägt und versuche mir meine Unwissenheit in Modefragen möglichst wenig anmerken zu lassen. Stattdessen setze ich eine Kennermiene auf und streiche mit den Fingern prüfend über die Stoffe. Sie sind einfacher und grober als der, den ich gestern Abend getragen habe, aber von guter Qualität. Ich stelle fest, dass sie mir alle sehr gut gefallen. Die vorwiegend karierten und gestreiften Muster entsprechen wohl der derzeitigen Mode, und die Farben, die der Meister mir vorschlägt, passen allesamt gut zu meinem Typ.
Als wir um die Mittagszeit endlich fertig sind, sind wir beide sehr zufrieden. Der Schneider ebenso wie ich. Er verspricht, morgen bereits wieder zu kommen und mir das Sonntagskleid zu bringen. Eine Ankündigung, die ich insgeheim mit einiger Skepsis zur Kenntnis nehme, da ich mir nicht vorstellten kann, wie der Meister das schaffen will. Aber wenn er meint, das sei machbar, dann soll es mir recht sein.
Am Nachmittag nimmt sich Eduard Sieveking ein wenig Zeit, um mich im Haus und in der Firma herumzuführen. Er zeigt mir als erstes die gut bestückte Bibliothek und danach das Musikzimmer, in dem zu meiner Freude neben Flöten und einem Geigenkoffer auch ein gut gestimmtes Tasteninstrument steht, von dem ich später lernen werde, dass es sich um ein Pianoforte handelt. Zwar spiele ich nicht übermäßig gut, habe es früher aber durchaus schon einmal gerne getan. Ich nehme Sievekings Angebot das Zimmer zu nutzen, also gerne an. Anschließend zeigt er mir noch die Firma. Von den Kontorräumen aus, die ich ja schon kenne, werden sowohl das Handelshaus Sieveking, als auch die Reederei verwaltet, die beide eng miteinander verflochten sind.
Auf meine Nachfrage hin, klärt er mich darüber auf, wie das Familien- und Geschäftsleben bei Sievekings genau organisiert ist: Seit dem Tod ihres Vaters vor elf Jahren, teilen sich Henry und Eduard gemeinsam die Geschäftsleitung ihrer Reederei und Handelsgesellschaft. Sie besitzen mehrere Großsegler, mit denen sie sowohl eigene, als auch die Waren anderer Händler zwischen Afrika und Hamburg hin und her transportieren. Ich erfahre, dass es sich dabei hauptsächlich um Gewürze – insbesondere Nelken, aber auch Zimt, Pfeffer und Vanille - Palmkerne, Tierhäute und Kautschuk handelt. Außerdem handeln sie seit Neuestem mit Kaurimuscheln.
Herr Sieveking deutet mein verdutztes Gesicht richtig und erklärt mir, dass es sich dabei um schneckenförmig geformte Muscheln handelt, die auf den Seychellen häufig vorkommen und in weiten Teilen Afrikas als Zahlungsmittel gelten. Die Sievekings beladen ihre Schiffe mit diesen Muscheln und verkaufen sie dann über ihre eigene, von Henry Sieveking erst vor drei Jahren neu eingerichtete Faktorei im nigerianischen Lagos nach West- und Zentralafrika weiter. Devisenhandel auf altmodisch sozusagen, denke ich.
Die Hauptniederlassung ihrer Firma befindet sich allerdings nicht in Lagos, sondern auf der Insel Sansibar, wo Henry Sieveking die letzten fünf Jahre verbracht hat und von wo er gestern erst nach Hamburg zurückgekehrt ist.
Fünf Jahre war er weg? Das ist verdammt lange, schießt es mir durch den Kopf. Normalerweise verbringt wohl jeder der Brüder jeweils nur ein Jahr auf Sansibar, während der andere die Geschäfte in Hamburg leitet. Warum der grimmige Henry diesmal so lange weg war, wird bei unserem Gespräch aber leider nicht ganz klar, und ich traue mich auch nicht so recht danach zu fragen.
Nachdem Herr Sieveking wieder an seine Arbeit zurückgekehrt ist, schaue ich mich ein wenig in der Bibliothek um. Der Bestand an Unterhaltungsliteratur ist für meine Begriffe reichlich begrenzt, umfasst aber das gesamte Who-is-Who der deutschen Dichter und Denker: Fontane, Goethe, Kleist und Schiller stehen zur Auswahl und bringen mich bereits bei der Nennung ihrer Namen zum Gähnen, erinnern sich mich doch an endlos lange Stunden im Deutschunterricht. Ein Blick ins Impressum verrät mir jedoch, dass die in feines Leder gebundenen Bände alle erst in den vergangenen Jahren erschienen sind. Somit habe ich es hier also durchaus mit den obersten Plätzen der aktuellen Bestsellerlisten zu tun.
Wie sich die Zeiten und Geschmäcker doch ändern, denke ich und suche mir am Ende tapfer ein Buch von E.T.A. Hoffmann aus. Da das Buch jedoch nicht nur in der derzeit üblichen gestelzten Sprache verfasst, sondern zudem auch noch in altmodischer Druckschrift gesetzt ist, die zu lesen ich als extrem anstrengend empfinde, verliere ich bald die Lust am Lesen und gehe ins Musikzimmer hinüber.
Auch hier gibt es eine große Auswahl an Noten. Ich lese Namen, die mir aus meinem Klavierunterricht bekannt sind. Schubert, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms…Vermutlich stehen diese für meinen Begriff „klassischen“ Komponisten derzeit alle in den aktuellen deutschen Charts und sind gerade ebenso frisch wie die Bücher in der Bibliothek. Der Gedanke lässt mich doch ein wenig schmunzeln.
Am Ende finde ich etwas von Mendelssohn und beginne zu spielen. Für meinen Geschmack gelingt es mir erstaunlich gut, obwohl ich schon ewig kein Klavier mehr angefasst habe. Ermutigt von meinem ersten Erfolg, spiele ich dann noch einige weitere Stücke, deren Noten hier im Raum herumliegen. Dazwischen klimpere ich die Refrains des einen oder anderen Hits aus 2016, was mir sehr viel Spaß macht. Mir war gar nicht bewusst, dass ich das Musizieren vermisst habe.
Während ich an diesem Pianoforte sitze, kommt mir in den Sinn, dass ich eigentlich nicht mehr gespielt habe, seitdem ich mit Johannes zusammen bin. Das liegt daran, dass ich vor Johannes nicht spielen mag, weil er mich ständig unterbricht und verbessert. Na ja, er ist eben ein Profi und arbeitet tagtäglich mit Top-Musikern zusammen. Vor so jemandem kann mein Geklimper nicht bestehen - und er kann es leider auch nicht lassen, mich auf sämtliche Fehler hinzuweisen, die mir unterlaufen. Das nervt, und deswegen habe ich das Klavierspiel an den Nagel gehängt. Aber hier, sage ich mir, kann Johannes mich ja nicht hören und bei jedem falschen Tönchen gequält das Gesicht verziehen. Hier kann ich frei von der Leber weg alles runterspielen, was mir in den Sinn kommt. Und von dieser Gelegenheit mache ich dementsprechend ausgiebig Gebrauch, bis es zu meinem Erstaunen bereits Zeit ist für das Abendessen. Wer hätte gedacht, dass man einen Tag mit vermeintlichem Nichtstun so gut herumbringen kann?
Sonntag, 21. August 2016
Sie betreten den Flur des modernen Alten- und Pflegeheims, in dem Alex‘ Opa seit seinem Schlaganfall lebt.
„Guten Tag, Herr Wahle! Ihr Opa ist auf seinem Zimmer“, begrüßt sie eine der Pflegerinnen. Die junge Frau strahlt Alex an und errötet sogar ein bisschen, als er freundlich zurückgrüßt und sich bei ihr für den Hinweis bedankt.
„Die steht auf dich“, flüstert Gregor grinsend, als sie außer Hörweite sind.
„Wundert dich das etwa?“, grinst Alex zurück und fügt mit gespieltem Ernst hinzu: „Du bist schließlich nicht der einzige Mensch mit gutem Geschmack!“
Gregor knufft ihn zur Antwort in die Seite.
Dann sind sie auch schon vor der Tür zum Zimmer von Alex‘ Opa angekommen.
„Hermann Sieveking?“, liest Gregor das Namensschild, das neben der Tür angebracht ist.
Alex nickt. „Er ist mein Opa mütterlicherseits“, erklärt er, bevor er anklopft.
Als sie eintreten, schallt ihnen die Stimme von Freddy Quinn entgegen, der aus den Lautsprechern eines tragbaren CD-Radios „La Paloma“ singt.
Alex‘ Opa sitzt im Rollstuhl vor dem bodentiefen Fenster und beobachtet die Spatzen, die sich draußen in einem der Kastanienbäume tummeln, die vor dem Heim gepflanzt sind. Als sich die Tür öffnet, wendet er jedoch neugierig den Kopf und lächelt erfreut, als er seinen Enkel erkennt. „Alex! Das ist ja schön, dass du kommst“, übertönt seine erstaunlich kräftige Stimme die von Freddy Quinn. „Aber warum so früh? Sonst kommst du immer erst am späten Nachmittag?“
„Hallo Opa!“, lächelt Alex und umarmt den alten Mann. Dann stellt er ihm Gregor vor, der ihm zur Begrüßung die Hand schüttelt.
Gregor fühlt, wie die tiefdunkelblauen Augen des alten Mannes ihn aufmerksam mustern. Buschige Augenbrauen, ein mächtiger Schnurrbart und hellgraues, borstiges Haar prägen seinen Kopf. In seinen Augen blitzt es schelmisch, was dem Mann, trotz seines Alters etwas Jungenhaftes verleiht.
‚Ein echter Charakterkopf‘, denkt Gregor und bedauert, dass er jetzt seine Kamera nicht dabeihat.
Die Augen des Alten huschen hellwach zwischen Gregor und Alex hin und her. „Ihr zwei seht aber ganz schön fertig aus, wenn ich das mal sagen darf! Kann es sein, dass ihr es in den letzten Nächten ein bisschen zu bunt getrieben habt?“, erkundigt er sich vielsagend und setzt noch eins drauf: „Ihr denkt aber hoffentlich auch immer an die Kondome, ja?“
„Opa!“, ruft Alex, sichtlich peinlich berührt über die Direktheit des alten Mannes, während Gregor unwillkürlich losprustet. „Keine Sorge, Herr Sieveking. Bei uns hat alles seine Ordnung“, versichert er Alex‘ Opa. Der alte Mann gefällt ihm. Er mag zwar alt sein, aber er ist nicht von gestern; das hat Alex wirklich treffend beschrieben.
„Mal abgesehen davon, dass du das gar nicht so genau wissen musst“, schaltet Alex sich ein, „haben wir beiden im Moment auch eigentlich ganz andere Sorgen.“
„Ihr habt ein Problem, Junge?“ In Herr Sievekings Augen blitzt es und er setzt sich in seinem Rollstuhl unwillkürlich auf. „Schieß los! Worum geht’s?“
‚Umständliches Drumherumgerede scheint nicht seine Sache zu sein‘, denkt Gregor amüsiert, während Alex zu sprechen beginnt.
Ohne ihm irgendetwas zu verheimlichen, erzählt er seinem Opa von Lenas Besuch im Laden und wie sie dann über die Teppichkante stolperte und in den Sprechenden Spiegel fiel. „Seitdem ist sie verschwunden“, beendet Alex seinen Bericht. „Einfach weg!“
„Wir haben die Vermutung, dass ihr Verschwinden irgendetwas mit dem Sprechenden Spiegel zu tun hat“, ergänzt Gregor, „und haben nun gehofft, dass Sie uns vielleicht mehr darüber sagen können.“
Eine ganze Weile lang bleibt es still. Nur Freddy Quinn singt unverdrossen vor sich hin. Inzwischen gibt er „Junge, komm bald wieder“ zum Besten.
‚Wie passend‘, denkt Gregor.
„Die Sprechenden Spiegel aus Lohr“, meint der Alte schließlich nachdenklich, „sollte an den Legenden, die man sich darüber erzählt, denn am Ende doch etwas Wahres dran sein? Als junger Mann habe ich es tatsächlich noch für möglich gehalten. Man sagte diesen Spiegeln nach, „immer die Wahrheit zu sagen“, was die meisten Leute als Anspielung darauf deuten, dass die Spiegel so sorgfältig und kunstvoll gefertigt waren. Im Märchen von Schneewittchen hat man diese Idee dann aufgegriffen und wörtlich genommen: Der Spiegel der bösen Stiefmutter spricht dort tatsächlich. Ich fand diesen Gedanken immer faszinierend. Deshalb habe ich mich in den späten Fünfzigern, als ich das Antiquitätengeschäft eröffnet habe, darum bemüht so einen Spiegel zu bekommen. Was auch geklappt hat.“
„Du hattest schon einmal so einen Spiegel?“, hakt Alex nach.
Herr Sieveking nickt. „Nicht denselben, wie er jetzt im Laden steht“, stellt er klar, „einen anderen. Aber auch ein schönes Stück. Auf ihm stand geschrieben „Elle brille à la lumière“.
„Sie glänzt im Licht“, übersetzt Alex.
„Das soll wohl so viel heißen, wie „Sie ist so schön“?“, vermutet Gregor.
Alex und sein Opa nicken.
„Jahrelang hat der Spiegel im Laden gestanden. Viele Kunden interessierten sich dafür, aber keiner wollte einen angemessenen Preis dafür bezahlen.“ Herr Sieveking hebt gleichgültig die Achseln, wobei Gregor auffällt, dass sich nur die eine Seite anhebt. Die linke scheint infolge des Schlaganfalls offenbar gelähmt zu sein.
„Und?“, fragt er den alten Mann mit halbem Ernst. „Hatten Sie den Eindruck, dass die Frauen, die vor dem Spiegel standen, davor wirklich schöner wirkten? Denn wenn ja, dann wäre dies ja ein Hinweis darauf gewesen, dass die Legenden stimmen könnten.“
„Nun ja. In der Tat sind mir die Frauen damals besonders schön vorgekommen. Aber das könnte auch daran gelegen haben, dass ich damals, mit Mitte zwanzig voll im Saft stand und nahezu alles schön fand, was einen Rock anhatte“, kichert Herr Sieveking, was ihm ein erneutes entsetztes Augenrollen seines Enkels einträgt.
„Am Ende hast du den Spiegel aber dann wohl doch noch verkaufen können. Weißt du noch an wen?“, erkundigt sich Alex dann.
„Irgend so ein Scheich aus den Emiraten. Wenn du es genau wissen willst, musst du im Archiv nachsehen.“
„Du meinst die große Kiste im Keller, in der du wahllos alles durcheinander aufbewahrt hast?“, meint Alex.
„Genau die“, nickt Herr Sieveking und kichert erneut.
„Na super!“, stöhnt Alex. „Darin möchte ich nur im äußersten Notfall nach etwas suchen müssen!“
„Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird“, beruhigt Gregor ihn. „Wenn ich das richtig verstanden habe, dann besitzt jeder dieser Spiegel seine eigene spezifische Besonderheit, die aber nichts mit der Funktion der anderen Spiegel zu tun hat.“
„Du meinst, der Spiegel von Schneewittchens Stiefmutter konnte sprechen, der von Opa machte schön und der, den ich im Moment im Laden habe, lässt einen durch die Zeit reisen. Aber das alles machen sie völlig unabhängig voneinander?“, fasst Alex zusammen.
Gregor nickt. „Es würde uns deshalb nicht weiterhelfen, wenn wir dem Spiegel hinterherforschen, der in die Emirate gegangen ist. Wir müssen uns auf den konzentrieren, der jetzt bei dir im Geschäft steht.“
„Über den weiß ich leider nichts, was ihr nicht auch schon wüsstet. Tut mir echt leid, Jungs“, bedauert Herr Sieveking. Dann grinst er schelmisch: „Aber wenn ihr herausfindet wie er funktioniert, dann gebt mir Bescheid. Vielleicht springe ich dann auch noch durch die Scheibe und komme am Ende als junger Mann wieder raus!“
„Gott bewahre! Nach dem, was du da vorhin angedeutet hast, müssten wir ja alles, was Röcke trägt dann erst mal vor dir warnen“, lautet Alex‘ trockener Kommentar.
„Kein Problem“, lacht Gregor, „das machen wir ratzfatz via Facebook.“
Sie bleiben noch etwa eine halbe Stunde bis sie sich verabschieden – und passenderweise auch die CD von Freddy Quinn zu Ende ist, sodass sie sie auf Wunsch von Alex‘ Opa noch gegen eine von Hans Albers austauschen können.
„Ist ein netter Junge, dein Gregor. Den solltest du dir warmhalten“, rät Herr Sieveking seinem Enkel zum Abschied, was diesen erneut in große Verlegenheit stürzt.
Gregor zieht ihn lachend aus dem Zimmer und legt beschwichtigend seinen Arm um die Schultern seines Freundes. „Ich finde deinen Opa echt klasse!“, meint er tröstend.
„Er dich offenbar auch“, grinst Alex erleichtert.
Als sie in das Antiquitätengeschäft zurückkehren, ist dort alles unverändert. Der Zettel, den sie geschrieben haben für den Fall, dass Lena während ihrer Abwesenheit auftaucht, liegt unberührt vor dem Spiegel auf dem Fußboden.
Enttäuscht hebt Gregor ihn auf. Obwohl er natürlich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit äußerst gering war, dass Lena ausgerechnet dann wiederkommt, wenn er mit Alex den Laden verlässt, hat ein kleiner Teil von ihm insgeheim doch auf ein Wunder gehofft. Allerdings verschwendet er nicht viel Zeit darauf Trübsal zu blasen, dafür ist er zu gut gelaunt. Der Besuch beim alten Herrn Sieveking hat ihm viel Spaß gemacht. Auch wenn er, was den Spiegel angeht, kein durchschlagender Erfolg war, so war ihr Besuch auf keinen Fall umsonst.
Alex hatte recht. Es war gut, dass er mal vor die Tür und ein wenig auf andere Gedanken gekommen ist.