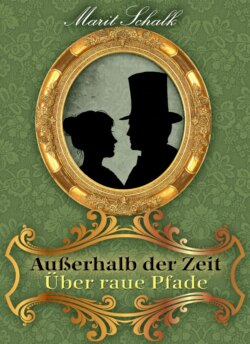Читать книгу Außerhalb der Zeit - Marit Schalk - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеFreitag, 19. August 2016
„Ich schreibe Johannes eine Nachricht. Darin behaupte ich, wir hätten uns alle drei den Magen verdorben, weshalb wir nicht zu seinem Auftritt kommen können“, überlegt Gregor laut und zieht sein Handy aus der Hosentasche.
Inzwischen sind fast zwei Stunden vergangen, seitdem Lena durch den Sprechenden Spiegel gefallen ist, und noch immer gibt es von ihr nicht den Hauch einer Spur. Obwohl Alex und Gregor mehrmals immer wieder zum Spiegel zurückgegangen und dessen Umgebung abgesucht haben, bleibt sie unauffindbar. Sie beide und Gregor insbesondere, haben eine Achterbahn der Gefühle hinter sich: Unverständnis, Angst, Wut, Resignation, dazwischen immer wieder Hoffnung und danach Enttäuschung, wenn eine weitere Idee, was mit Lena sein könnte, sich wieder als falsch herausgestellt hat.
Alex hat die Zeit genutzt, um seinem Freund zu erklären, dass Lenas Verschwinden nicht das erste unerklärliche Ereignis ist, das sich in diesem Hause abgespielt hat, sondern dass es im letzten Monat bereits das Auftauchen des rätselhaften Fremden gab, für das sich keinerlei logische Erklärung finden ließ. Er hat Gregor auch erläutert, wie er aufgrund dessen auf die Idee kam, der Spiegel könne bei Lenas Verschwinden eine Rolle spielen – auch wenn in seinem Badezimmer oben im vierten Stock kein antiker Spiegel an der Wand hängt, sondern bloß ein verglaster Hängeschrank. Die Erinnerung an den Titel seines Bücherfundes in dem alten ersteigerten Koffer, war dann lediglich noch das letzte Tüpfelchen auf dem i, um ihn an eine Zeitmaschine denken zu lassen.
Obwohl Gregor sichtlich mit sich gerungen hat, solche fantastischen Erklärungen nicht als Hirngespinste abzutun, hat er sich Alex zuliebe auf den Gedanken eingelassen und ihn als möglich in Betracht gezogen. Ein Umstand, der zum großen Teil auch darauf zurückzuführen ist, dass er ja schließlich mit eigenen Augen gesehen hat, wie Lena vollkommen spurlos durch den Spiegel verschwunden ist. Trotzdem fällt es ihm noch immer schwer, ein solch magisches Denken zu akzeptieren. Immer wieder läuft er zum Spiegel hin, um ihn zu untersuchen. Er zermartert sich das Hirn nach einer anderen, physikalisch erklärbaren und für ihn logisch klingenden Lösung, aber er findet keine.
„Ich kann es hin und herdrehen wie ich will, am Ende komme ich doch immer wieder zu dem Ergebnis, dass du vielleicht recht haben könntest, so irre die Vorstellung auch sein mag!“, ruft er schließlich aus und sieht Alex dabei kopfschüttelnd an, so als könne er es noch immer selbst nicht fassen, zu diesem Schluss gekommen zu sein. „Das Einzige, das aber in jedem Fall feststeht“, fügt er stirnrunzelnd hinzu, „ist die Tatsache, dass Lena wohl so schnell heute nicht wiederkommen wird und wir Johannes eine glaubhafte Begründung liefern müssen, warum wir drei nicht in Altona aufkreuzen.“
„Schreib ihm doch, dass Lena sich so schlapp fühlt wegen ihres verkorksten Magens, dass sie heute bei uns übernachtet“, ergänzt Alex, keuchend vor Anstrengung. Er steht an der winzigen Spüle und müht sich damit ab, die völlig verkrustete Auflaufform wieder sauber zu bekommen.
„Gute Idee. Auf diese Weise gewinnen wir erst mal etwas Zeit, bevor Johannes anfängt, Fragen zu stellen“, nickt Gregor und tippt. Er lehnt in der Tür zum Büro, von wo aus er sowohl mit Alex zusammen sein, als auch gleichzeitig den Antiquitätenladen überblicken kann.
„Wir bleiben auf jeden Fall heute Nacht hier, für den Fall, dass Lena genauso plötzlich wieder auftaucht, wie sie verschwunden ist“, schlägt Alex vor.
Gregor nickt und schickt die Nachricht ab. Dann stößt er einen hilflosen Seufzer aus und nimmt Alex die Spülbürste aus der Hand: „Lass mich mal weiterschrubben. Ich muss jetzt irgendetwas zu tun haben, sonst drehe ich durch.“
Samstag, 20. August 2016
Es ist weit nach Mitternacht. Schon lange haben sie das Licht gelöscht, aber Gregor und Alex können nicht schlafen. Viel zu sehr treiben sie die Fragen um, was wohl mit Lena geschehen sein mag, wo sie wohl ist, ob es ihr gut geht. Sie liegen nebeneinander auf dem Fußboden des Antiquitätengeschäfts, wo sie Bettzeug und einen Campingschlafsack zwischen den alten Möbeln unmittelbar vor dem zerschlagenen Sprechenden Spiegel ausgebreitet haben. Beinahe im Minutentakt wälzen sie sich von einer Seite auf die andere, in dem vergeblichen Versuch ein wenig Nachtruhe zu finden.
Der leere Spiegelrahmen scheint dabei höhnisch auf sie herabzublicken. Seine Umrisse malen sich trotz der nächtlichen Dunkelheit schwarz vor der Wand dahinter ab und kommen Alex dadurch seltsam bedrohlich vor, wie ein riesiges, finsteres Maul, das seine Opfer zu verschlingen droht. Mit Haut und Haar zu verspeisen, so wie die junge Frau, die ihm heute offensichtlich zum Opfer gefallen ist.
Ausgerechnet Lena, ausgerechnet Gregors Schwester! Bei dem Gedanken, dass sie dabei vielleicht ums Leben gekommen sein könnte, macht Alex unwillkürlich eine abwehrende Handbewegung und ein unwilliger Laut entfährt ihm. Auf keinen Fall will er an das Schlimmste denken. Diesen Gedanken wird er sich einfach nicht gestatten.
„Was ist?“, lässt sich da Gregors Stimme in der Dunkelheit vernehmen. Natürlich ist auch er hellwach, und natürlich hat er Alex‘ Bewegung und den Laut, den er von sich gegeben hat mitbekommen.
„Ach nichts“, schwindelt er schnell, will er den ohnehin aufgewühlten Freund doch auf keinen Fall noch mehr beunruhigen. „Ich habe mir nur gerade selbst noch einmal versichert, dass es Lena ganz bestimmt gut geht, egal was auch immer mit ihr geschehen sein mag.“
„Was macht dich da so sicher?“, erkundigt sich Gregor, und dem nervösen Klang seiner Stimme kann Alex anhören, dass er darüber keineswegs so optimistisch denkt.
‚Gar nichts‘, beantwortet Alex seine Frage ehrlich im Stillen. Laut aber meint er in einem Ton, von dem er hofft, dass er beruhigend klingt: „Weil sich der Spruch auf dem Spiegelrahmen wie eine Einladung anhört, nicht wie eine Drohung oder Warnung.“
Gregor gibt eine Art zustimmendes Brummen von sich, das aber in ihrer beider Ohren recht kläglich und wenig überzeugt nachhallt.
„Bestimmt taucht Lena bald wieder auf und ist putzmunter, du wirst schon sehen“, setzt Alex eifrig nach. „Sie wird wissen, was passiert ist und uns bestimmt eine ganz simple, vollkommen logische Erklärung liefern, auf die wir zwei bloß einfach nicht gekommen sind. Bestimmt werden wir uns an den Kopf packen, weil die Lösung vor unserer Nase lag!“
„Ja, sicher“, stimmt Gregor zu, ganz offensichtlich nicht im Mindesten seiner Meinung, aber zu kraftlos vor Verzweiflung, um argumentativ dagegen zu halten.
Alex presst frustriert die Lippen zusammen, fällt es ihm doch von Stunde zu Stunde schwerer, dem Freund gegenüber den Zuversichtlichen zu mimen. Auch er wird zunehmend verzagter, je weiter die Nacht voranschreitet, ohne dass irgendetwas geschieht, das auf Lenas Verbleib hindeuten würde. „Mal angenommen, man könnte tatsächlich mit dem Spiegel durch die Zeit reisen“, versucht er nun eine neue Taktik. „Welche Epoche würdest du dir aussuchen?“ Seine Frage stellt den kläglichen Versuch dar, nicht nur Gregor, sondern ebenso sehr sich selbst von den zunehmend apokalyptischer werdenden Vorstellungen darüber abzulenken, was Lena wohl alles passiert sein könnte.
Zu seiner Erleichterung geht Gregor auf den Ablenkungsversuch ein. „Ich weiß nicht“, beginnt er zögernd. „In die Zukunft vielleicht? Um zu sehen, was kommen wird?“
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wissen möchte“, meint Alex. „Überleg mal: du könntest auf diese Weise etwas Schlimmes über dein zukünftiges Schicksal oder das eines guten Freundes erfahren. Danach müsstest du mit diesem Wissen leben und würdest immer darauf warten, dass es eintrifft. Das wäre doch schrecklich… Nein, ich denke, ich würde mir lieber die Vergangenheit anschauen.“
„Wahrscheinlich hast du recht“, stimmt Gregor zu. „Dann vielleicht lieber die Ritterzeit? Oder das alte Rom?“
„Nach Versailles an den Hof Ludwig XIV“, schlägt Alex vor. „Oder zu den alten Ägyptern. Stell dir vor: man könnte endlich das Rätsel lösen, wie sie die Pyramiden gebaut haben. Das wäre doch eine Sensation. Du könntest deine Kamera mitnehmen und Fotos davon machen.“
„Hmm“, brummt Gregor zustimmend. „Aber was ist, wenn man sich nicht aussuchen kann, in welche Zeit man reist? Dann könnte es einem passieren, dass man auf einem Schlachtfeld landet, mitten im übelsten Kampfgetümmel. Oder als Hexe auf einem mittelalterlichen Scheiterhaufen. Vielleicht auch an Bord der Titanic. Oder in einem Foltergefängnis der Gestapo…“
Gregors Stimmung ist offensichtlich alles andere als zuversichtlich. Alex wertet seinen Ablenkungsversuch als kolossal gescheitert. Zumal ihm bei Gregors Aufzählung noch selbst allerhand denkbare Szenarien einfallen. Nur mit Mühe gelingt es ihm, die Bilder zu verdrängen, die Lena auf der Flucht vor einem Mammut zeigen und in der Gewalt eines lüsternen Neandertalers. Ein solches Schicksal würde er seinem ärgsten Feind nicht gönnen und Gregors Schwester schon mal gar nicht. Alex tastet seufzend nach der Taschenlampe und schaltet sie an.
„Was hast du vor?“, blinzelt Gregor ihn an.
„Ich hole mein Notebook aus dem Büro. Da wir ohnehin keinen Schlaf finden, können wir die Zeit auch mit ein wenig Internetrecherche verbringen“, erklärt er und schält sich aus dem Schlafsack.
„Und was willst du recherchieren? Eine Hitliste der grausamsten Tode in der Geschichte?“, erkundigt sich Gregor und sieht dabei derart finster drein, dass Alex wider Willen lachen muss.
„Nein, keine Angst. Ich dachte eher, wir könnten etwas mehr über diesen Spiegel herausfinden. Schließlich scheint der doch bei Lenas Verschwinden irgendeine Rolle zu spielen. Die Frage ist nur, welche genau?“
*
Das Bett ist wunderbar weich. Ich liege in fluffigen Federkissen wie auf einer Wolke und rekapituliere den Traum, den ich heute Nacht hatte: Darin geleitete mich ein freundlicher Mann durch ein stockfinsteres Haus. Lediglich ein Leuchter mit mehreren Kerzen wies uns dabei den Weg.
Zunächst ging es einmal quer durch einen hallenartigen Raum, der so hoch war, dass er keine Decke zu haben schien. Dann erreichten wir eine Treppe, welche uns auf eine Galerie führte, die rund um die Eingangshalle lief. Mehrere Türen gingen von der Galerie ab, die wir aber alle hinter uns ließen. Stattdessen gelangten wir durch eine Art Vorraum zu einer weiteren Treppe, die ins nächste Stockwerk führte. Auch hier befanden sich wieder mehrere Türen.
Vor einer davon blieb der nette Mann stehen, öffnete sie, reichte mir freundlich eine der Kerzen von seinem Leuchter und wünschte mir eine gesegnete Nachtruhe.
Mit der Kerze in der Hand bin ich dann vor Müdigkeit wankend in das Zimmer getreten, das hauptsächlich von eben diesem Wolkenbett eingenommen wurde, in dem ich mich gerade befinde. Nur mit Mühe, ist es mir dann noch gelungen die Kerze in einen kleinen Halter auf dem Nachttisch zu befestigen und meine Sneakers auszuziehen, bevor ich mich in die Wattekissen habe fallen lassen und anschließend in einen derart tiefen Schlaf fiel, als hätte ich eine strapaziöse Reise hinter mir.
Plötzlich poltert es irgendwo über mir, ein kurzer Ruf erschallt und dann ertönt ein dumpfes Rumpeln, das das Bett ebenso wie die Fensterscheiben zum Vibrieren bringt. Es hört sich an, als ob eine U-Bahn direkt durch die Eingeweide des Hauses fahren würde.
Schlagartig bin ich hellwach. Was, um Himmels Willen, ist das? Ich setze mich auf und begreife, dass der vermeintliche Traum gar kein Traum war. Dass der nächtliche Weg im Kerzenschein durch das riesige Haus tatsächlich stattgefunden hat und dass der freundliche junge Mann dabei Eduard Sieveking war. Es ist also nicht vorbei. Ich bin noch immer in dem Haus, in dem ich gestern Abend Herrn Sieveking und seinen Bruder kennengelernt habe. Einem Haus ohne Strom, ohne W-LAN, ohne Handynetz. Und die Leute, die sich als seine Eigentümer betrachten sind zwei Typen in steifen Klamotten und mit noch steiferem Benehmen, sowie einer seltsam altertümlichen Ausdrucksweise.
Vorsichtig betaste ich meinen Hinterkopf, an dem nach wie vor eine dicke Beule pocht. Die Beule, die ich mir zugezogen habe, nachdem ich in Alex‘ antiken Spiegel gefallen und dann mit dem Hinterkopf gegen die Wandvertäfelung geprallt bin. Ein weiterer Beweis also, dass alles, was ich geträumt zu haben glaube, tatsächlich geschehen ist.
Das Zittern und Rumpeln endet genauso plötzlich wie es begonnen hat. Wieder ertönt ein kurzer Ruf. Diesmal von unten. Dann bleibt es einen Moment lang still.
Ich blicke mich im Zimmer um, dessen Fenster hinter schweren, dunkelgrünen Vorhängen verborgen sind. Durch einen Spalt dringt jedoch genügend Tageslicht ein, dass ich die Einrichtung betrachten kann. Vor dem Fenster stehen ein Stuhl und ein Sekretär. An der Wand gegenüber dem Bett befinden sich ein schmaler doppeltüriger Kleiderschrank und eine Kommode mit Waschgeschirr und einem Spiegel dahinter. Alle Möbel haben geschwungene Beine, wodurch sie zwar altmodisch wirken, aber auch eine gewisse Eleganz ausstrahlen. Bestimmt würden sie sich gut in Alex‘ Laden machen.
Ich steige aus dem Bett und gehe zum Fenster. Dabei bemerke ich ein wenig beschämt, dass ich mich tatsächlich vollständig bekleidet ins Bett gelegt habe. Noch immer trage ich meine Jeans und dazu mein weißes Top, das natürlich vollkommen zerknittert ist. Was für ein Segen, dass ich gestern das schwarze Reservetop in meine Handtasche gepackt habe!
Als ich die Vorhänge zur Seite schiebe und das doppelte Sprossenfenster öffne, dringt fernes Vogelgezwitscher in den Raum. Der Geruch von verbranntem Holz und muffigem Brackwasser liegt in der Luft. Eine Gruppe Tauben fliegt über die Dächer der gegenüberliegenden Häuser hinweg, aus deren Schornsteinen Rauch aufsteigt, obwohl die sommerliche Morgenluft einen warmen Tag verspricht.
Zu meiner Erleichterung erkenne ich die Giebel der Häuser wieder. Sie säumen das Nikolaifleet, das sich zwei Etagen unter mir befindet und in dem derzeit lediglich einige hölzerne Boote verlassen im seichten Schlick liegen. Das Fleet führt gerade nur ganz wenig Wasser, da es, so wie auch noch einige andere Fleete in Hafennähe, der Tide unterliegt und bei Niedrigwasser der Elbe leerläuft. Was mich allerdings etwas verwundert ist, dass ich anstelle des erwarteten Hochwasserwehrs zu meiner Rechten eine Brücke entdecke, über die in diesem Augenblick eine Kutsche rumpelt.
Hmmm. Ich wende mich vom Fenster ab und bemerke erst jetzt, dass aus dem Krug des Waschgeschirrs Wasserdampf aufsteigt, der einen Teil des Spiegels an der Wand beschlagen lässt. Außerdem entdecke ich ein sauberes weißes Leinentuch und ein neues Stück Seife auf der Kommode. Offensichtlich ist vor kurzem jemand hier gewesen und hat die Sachen dort abgestellt, während ich noch schlief. Und noch offensichtlicher erwartet diese Person, dass ich die bereitgestellten Utensilien benutze - was nur den einen Schluss zulässt, dass es in diesem Haus wohl auch kein Badezimmer gibt?
Die ganze Geschichte wird immer verrückter. Wenn ich nicht wüsste, dass es so etwas nicht gibt, würde ich glauben, man habe mich in der Zeit zurückversetzt. Aber Zeitreisen gibt es nur im Kino. Wohin bin ich also hier geraten? In ein groß angelegtes soziologisches Experiment?
Wenn dem so ist, muss ich dringend den Versuchsleiter sprechen, denn ich habe zu keinem Zeitpunkt eine Einverständniserklärung zur Teilnahme an irgendeiner Studie unterschrieben, da bin ich mir ganz sicher. Von meinem Psychologiestudium weiß ich aber noch, dass man die Probanden niemals ohne ein vorheriges Aufklärungsgespräch in einen Versuchsaufbau schicken darf. In meinem Fall scheint da etwas gründlich schief gelaufen zu sein.
Ein Blick in den zur Hälfte beschlagenen Spiegel belehrt mich jedoch, dass es zunächst erst einmal dringender ist, mein Äußeres wieder in Schuss zu bringen: Zu meiner grenzenlosen Erleichterung, habe ich zwar keinen einzigen Kratzer im Gesicht davongetragen – was höchst erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass ich gestern Abend durch eine Spiegelscheibe gefallen bin – aber abgesehen davon, bin ich doch reichlich lädiert: Mein Make-up ist zerlaufen und meine Haare stehen wild in alle Richtungen ab. Ich sehe aus wie die Hauptdarstellerin in einem Zombie-Film.
Wie gut, dass ich in meiner Handtasche immer alles dabeihabe. Unverzüglich mache ich mich daran, mein Erscheinungsbild mit Hilfe des Waschgeschirrs und dem Inhalt meiner Tasche wieder in Ordnung zu bringen. Die ganze Prozedur ist zwar etwas umständlich und gewöhnungsbedürftig, erfüllt am Ende aber seinen Zweck: ich fühle mich wieder frisch und vorzeigbar. Zum Schluss streife ich das frische schwarze Top über und bändige meine Haare zu einem Pferdeschwanz, der jetzt knapp unterhalb der Beule sitzt.
Noch während ich dabei bin, meine Habseligkeiten wieder in der Handtasche zu verstauen und meine Sneakers anzuziehen, geht das Gerumpel wieder los, das mich vorhin aufgeweckt hat. Erneut zittert das ganze Haus, als würde es von einem Erdbeben erschüttert.
Entschlossen der Sache diesmal auf den Grund zu gehen, öffne ich die Tür einen Spalt breit und spähe hinaus in den Flur, der zu meiner Erleichterung leer ist. Ich verlasse das Zimmer, folge dem Gang bis zur Treppe, die ich gestern Abend im Kerzenschein hinaufgestiegen bin, und gehe sie nun hinunter. Als ich unten angekommen bin und auf die Galerie trete, wird mir schlagartig einiges klar:
Die Halle, die ich gestern mit Eduard Sieveking im Dunkeln durchquert habe, ist zwei Stockwerke hoch. Darüber spannt sich eine grau getünchte Holzdecke, die mit Pflanzenornamenten bemalt ist, welche mir auf Anhieb noch von meinem gestrigen Besuch bei Alex vertraut sind. Es handelt sich ganz offensichtlich um dieselbe Holzdecke und dieselbe Eingangshalle wie in Alex‘ Haus. An der Stelle allerdings, in der sich meines Wissens nach gestern noch der Messingleuchter befunden hat, der die Treppe und die umlaufende Galerie beleuchtete, klafft nun ein etwa drei mal drei Meter großes, quadratisches Loch in der Decke, aus dem zwei dicke Seile herabhängen.
Ich hocke mich hinter die Brüstung der Galerie und versuche von dort aus zu erspähen, wohin die beiden Seile wohl führen. Soweit ich erkennen kann, erstrecken sich über dem zweiten Stock, in dem ich mich befinde, noch drei weitere Etagen bis hinauf unter das Dach.
Dort oben befinden sich offensichtlich Speicher und Lagerräume, denn an einer Luke zwei Stockwerke über mir steht gerade ein Mann und wuchtet einen prall gefüllten Jutesack in die Öffnung. Er befestigt den Sack an einem Haken, der an einem der dicken Seile hängt, schickt einen kurzen Ruf nach unten und lässt den Sack los, der daraufhin unter ohrenbetäubendem Gerumpel an mir vorbei in die Tiefe bis zum Grund der Diele gleitet, wo er von einem anderen Arbeiter in Empfang genommen wird. Dabei übertragen sich die Bewegungen des Flaschenzuges auf das Gebälk des Hauses und bringen das gesamte Gebäude zum Zittern und Beben. Das also war die vermeintliche U-Bahn – ein Lastenaufzug, der an der höchsten Stelle des Gebäudes im Dachfirst verankert ist und wahrscheinlich von sämtlichen Speicherräumen aus bedient werden kann.
Ich recke ein wenig den Hals, um über die Brüstung der Galerie spähen zu können. Dort unten stapeln sich weitere Säcke, hölzerne Kisten und Fässer unterschiedlicher Größe. Von hier oben sieht es wie ein heilloses Durcheinander aus.
Die Männer, die dort unten arbeiten, scheinen jedoch zu wissen, was sie zu tun haben. Mit sicheren Bewegungen greifen sie sich nach und nach die unterschiedlichen Behältnisse, die von oben durch das quadratische Loch hinabgelassen werden und schaffen sie durch die große Tür nach draußen. Dazwischen laufen andere Männer mit Lieferpapieren umher, die Behältnisse abzählen, auf Listen abhaken und zwischendurch geschäftig hinter der Tür verschwinden von der ich weiß, dass sich dahinter die Kontorräume befinden, wo ich gestern Abend die Sieveking-Brüder getroffen habe – beziehungsweise Alex‘ Laden, je nachdem, in welcher Realität ich mich derzeit gerade befinde.
Just in diesem Moment öffnet sich die Kontorstür und der grimmige Henry tritt in Begleitung eines anderen Mannes in die Diele. Obwohl er mich unmöglich hier oben entdecken kann, weiche ich unwillkürlich ein Stück zurück und ducke mich tiefer in den Schatten des Geländers, das mir zum Glück genügend Deckung gibt, da es aus einer Aneinanderreihung von grau gestrichenen, geschwungenen Holzelementen besteht, von denen jedes etwa eine Hand breit ist. Aus einem Grund, den ich mir selber nicht erklären kann, wäre es mir unangenehm, wenn ausgerechnet er mich dabei ertappen würde, wie ich auf der Galerie hocke und ihn durch die fingerbreiten Abstände zwischen den Holzelementen beobachte.
Obwohl meine Sicht jetzt etwas eingeschränkt ist, kann ich ihn und seinen Begleiter noch gut sehen. Wieder einmal bin ich verwundert darüber, wie festlich die Männer gekleidet sind. Um ihre Hälse haben sie jeweils ein Tuch geschlungen, dessen Enden in ihren kragenlosen Hemden verschwinden, und über dem Ganzen tragen sie frackartig geschnittene Gehröcke, die ihnen bis weit unter die Knie reichten Zur Krönung seines Outfits setzt Henry Sievekings Besucher jetzt auch noch einen Zylinderhut auf, nachdem er sich per Handschlag verabschiedet hat und das Haus verlässt. Ganz schön overdressed für meinen Geschmack. Aber offenbar kein allzu ungewöhnlicher Anblick.
Die Arbeiter jedenfalls haben dem Zylindermann keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Im Gegensatz zu diesem sehen sie recht normal aus. Sie tragen dunkle Stoffhosen über einfachen Hemden. Dazu haben sie ebenfalls meist ein Halstuch umgebunden und tragen Schiebermützen auf dem Kopf. Wären ihre Kleidungsstücke in den Farben etwas einheitlicher, dann könnten sie durchaus als Mitglieder eines Shanty-Chors durchgehen.
Henry Sieveking wendet sich an zwei der Arbeiter, die gerade von draußen hereinkommen und gibt ihnen Anweisungen in fließendem Plattdeutsch.
Erstaunt hebe ich die Brauen. Ich kenne kaum jemanden, der den alten Dialekt noch richtig gut beherrscht. Selbst Gregor und ich, die wir echte Hamburger sind, können Platt zwar noch verstehen, aber kaum irgendeinen zusammenhängenden Satz bilden.
Die Arbeiter hingegen antworten Sieveking in derselben Sprache, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt.
Ich lausche ihrem Gespräch über irgendwelche Fässer, die von A nach B geschafft werden müssen und gewinne den Eindruck, dass es Sieveking genießt, die Sprache zu benutzen. Seine Stimme klingt jedenfalls entspannter und weniger streng als gestern Abend, als wir Hochdeutsch miteinander sprachen. Obwohl – vielleicht war er da einfach deshalb unentspannt, weil er urplötzlich eine wildfremde Frau von seinem Fußboden aufheben und dann auch noch beherbergen musste. Wer weiß?
Inzwischen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich nicht ewig hier hocken und die Gastfreundschaft der Sieveking-Brüder in Anspruch nehmen kann. Wenn ich zudem herausfinden möchte, ob ich tatsächlich irrtümlich Teil eines großangelegten Experiments geworden bin, dann muss ich dieses Haus verlassen und schauen, ob ich irgendwo einen Verantwortlichen finde, um das Missverständnis aufzuklären. Kurz kommt mir die Idee, ob die Sievekings vielleicht mit zum Forschungsteam gehören und dort in leitender Funktion tätig sein könnten, verwerfe den Gedanken aber schnell wieder. Die beiden gehen viel zu sehr in ihren Rollen als Hamburger Kaufleute auf. Kein Wissenschaftler der Welt kann derart glaubwürdig schauspielern. Die beiden müssen echte Profis sein.
Also schultere ich meine Handtasche und schleiche in Richtung Treppe, wobei ich darauf achte, im Schatten der Galerie zu bleiben und möglichst niemandem aufzufallen. Auf keinen Fall möchte ich nochmals mit Henry Sieveking reden müssen. Würde der freundliche Eduard gerade unten in der Diele stehen, würde ich mich anständig bei ihm bedanken und mich verabschieden. Aber von den bohrenden Blicken des grimmigen Henry habe ich gestern Abend schon genug genossen.
Stück für Stück arbeite ich mich ins Erdgeschoss hinunter, ohne dass mich jemand sieht oder anspricht. Dabei kommt mir zugute, dass die Männer ohnehin viel zu beschäftigt mit ihrer Arbeit sind, um darauf zu achten, was auf der Galerie vor sich geht.
Herr Sieveking ist inzwischen wieder im Kontor verschwunden. Gut.
Im Erdgeschoss angekommen, verberge ich mich hinter ein paar aufgestapelten Säcken, denen äußerst intensiv, ja nahezu betäubend, der Weihnachtsgeruch entströmt, den ich gestern Abend schon hier im Haus wahrgenommen habe. Nelken, schießt es mir durch den Kopf. Es ist der Duft getrockneter Nelken. Ganz eindeutig. Fast bin ich versucht mir vor die Stirn zu schlagen, dass ich nicht gleich darauf gekommen bin. Oben auf den Säcken, hinter denen ich hocke, entdecke ich eine Jacke und eine Schiebermütze, die einer der Arbeiter dort abgelegt hat. Ohne lange darüber nachzudenken, schnappe ich mir ungesehen die beiden Kleidungsstücke.
Eng an die Säcke gepresst, schlüpfe ich in die Jacke aus braunem, grobem Leinen. Sie ist mir ein wenig zu eng und stinkt übel nach altem Schweiß. Unwillkürlich verziehe ich angewidert das Gesicht und denke innerlich aufseufzend, dass ich mir das frische Top getrost hätte sparen können. Auch die Mütze ist schon reichlich speckig, und wenn ich eine Laus oder ein Floh wäre, würde ich mich bestimmt darin wohl fühlen. Hastig schiebe ich den Gedanken beiseite und konzentriere mich darauf festzustellen, dass sie gut auf meinem Kopf sitzt und zudem sogar noch Platz bietet, um meinen Pferdeschwanz darunter zu verbergen. Also Augen zu und durch.
Bestimmt sehe ich jetzt schon fast wie einer der Arbeiter aus. Bloß meine Jeans und die blauen Sneakers sind noch nicht wirklich stilecht. Aber ein paar herrenlose Schuhe stehen hier leider nirgendwo in der Ecke herum. Das wäre ja auch zu schön gewesen.
Vorsichtig kauere ich mich hinter die Säcke und beobachte die Bewegungen der Arbeiter, um eine günstige Gelegenheit zu finden, wie ich ohne großes Aufsehen zu erregen, durch das große offene Eingangstor gelangen könnte. Etwa fünf Minuten lang hocke ich da und beginne mich langsam zu fragen, was ich machen soll, wenn die Arbeiter beginnen, den Stapel Säcke abzutragen, der mir als Deckung dient.
Zu allem Überfluss betritt Henry Sieveking auch noch wieder die Szenerie. Er trägt eine Liste in der Hand und beginnt im hinteren Teil der Diele ein plattdeutsches Palaver mit einem Mann, der sich die meiste Zeit über unten am Lastenaufzug aufhält und hin und wieder Bestellungen nach oben zu den Lagerräumen ruft. Ich vermute, er ist so eine Art Vorarbeiter. Zum Glück drehen sie mir den Rücken zu, als sie sich gemeinsam über die Liste beugen.
Dann plötzlich ist meine Chance gekommen. Beinahe hätte ich sie verpasst: Vier Arbeiter gleichzeitig sammeln sich um eine besonders große Kiste, die zudem auch noch überdurchschnittlich schwer zu sein scheint. Sie geraten jedenfalls ganz schön ins Keuchen, als sie das Gewicht auf ein Kommando hin gleichzeitig anheben und zur großen Tür tragen. Ein jeder von ihnen ist in diesem Moment viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und darauf bedacht, den Weg nach draußen so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, als dass sie noch groß auf ihre Umgebung achten würden.
Eilig springe ich auf, schnappe mir meine Handtasche und zur besseren Tarnung zusätzlich noch einen der Weihnachtsduftsäcke. Letzterer stellt sich als schwerer heraus, als ich erwartet hätte. Aber es gelingt mir ihn anzuheben und vor die Tür zu schleppen, wo zu meinem Erstaunen ein Pferdegespann steht, auf das die Arbeiter die schwere Kiste bugsieren.
Ich beeile mich, meinen Sack einfach neben einem der hinteren Kutschenräder stehen zu lassen und husche dann so schnell es geht davon. Dabei trete ich prompt mit dem linken Schuh in einen riesigen Haufen Pferdeäpfel. Leise fluchend versuche ich zunächst den frischen Dung von meinem Sneaker abzuschütteln, überlege es mir dann aber anders. Eine bessere Tarnung für meine auffällig weißen Schuhe wird sich wohl kaum finden lassen, oder? Also fasse ich mir ein Herz und versenke kurzerhand auch noch den rechten Fuß tief im Mist. In einer Duftwolke aus Männerschweiß und Pferdedung ziehe ich dann über die mit Kopfsteinen gepflasterte Straße los und denke missmutig, dass ich mir das Deodorieren heute Morgen ebenfalls hätte sparen können.