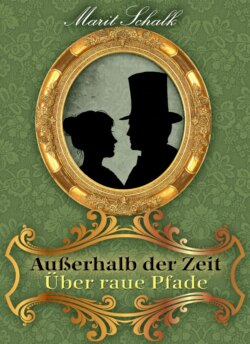Читать книгу Außerhalb der Zeit - Marit Schalk - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 7
ОглавлениеFernes Donnergrollen weckt mich aus meiner Ohnmacht. Es ist drückend schwül, wie so meist, kurz bevor sich ein Gewitter entlädt.
Zum Glück trage ich die Mütze und die stinkige Jacke nicht mehr. Irgendwer muss sie mir ausgezogen haben, ebenso wie meine Sneakers, denn ich spüre, dass ich barfuß bin. Nur noch mit Jeans und Top bekleidet, liege ich auf einer hölzernen Bank. Die Bank ist ziemlich hart, aber unter meinen Kopf hat man ein weiches Kissen gelegt.
Ohne die Augen öffnen zu müssen, weiß ich, wo ich bin, denn es duftet nach Nelken. Außerdem auch noch nach verbranntem Pfeifentabak, dem ein Hauch Vanille beigemischt ist. Genussvoll atme ich die angenehmen Düfte ein. Obwohl ich Nichtraucherin bin, mag ich diesen Vanilleduft. Er riecht überhaupt nicht unangenehm nach Qualm.
Vorsichtig öffne ich die Augen. Ich bin im Büro der Sievekings, dem hinteren der beiden Kontorräume. Ich liege auf der hölzernen Bank der kleinen Sitzgruppe mit den grün bezogenen Stühlen. Vor mir auf dem niedrigen Tisch mit den geschwungenen Beinen steht, nahezu auf Augenhöhe, ein großer Teller voller Sandwiches sowie ein Glas und ein tönerner Krug mit Wasser. Augenblicklich ist der beißende Hunger wieder da, und mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Mit einem Mal kann ich nur noch an Essen denken. Ich setze mich auf und nehme mir ein Brot, das mit Käse belegt ist. Gierig schlinge ich es hinunter und greife dabei schon nach der nächsten Schnitte, so als könne man mir die köstlichen Butterbrote jeden Augenblick wieder fortnehmen. Ich verputze die dritte Schnitte und noch eine vierte, bevor sich endlich ein erstes wohliges Sättigungsgefühl bemerkbar macht und ich mir ein Glas Wasser gönne, das erstaunlich kühl und erfrischend schmeckt. Erleichtert schließe ich die Augen, seufze einmal auf und esse dann die fünfte und letzte Scheibe Brot, diesmal langsamer und mit bewusstem Genuss.
Als ich den letzten Bissen hinunterschlucke, habe ich die Lider noch immer geschlossen und lausche dem Gewittergrollen, das inzwischen näher gekommen zu sein scheint. Erst nachdem der Donner verhallt ist, fällt mir ein weiteres Geräusch im Zimmer auf. Es handelt sich dabei um ein leises rhythmisches Kratzen, so als gleite eine zu grobe Füllerfeder über raues Papier.
Ich öffne die Augen und suche die Richtung des Geräuschs. Und entdecke Henry Sieveking, der hinter dem übervollen Schreibtisch sitzt und tatsächlich mit einer Feder schreibt, einer echten.
„Oh!“, rufe ich leise aus, als mir bewusst wird, dass er die ganze Zeit über dort gesessen und sehr wahrscheinlich genau jede kleinste Regung von mir mitbekommen hat. Vor allem, dass ich die Brote hinuntergeschlungen habe, als gäbe es kein Morgen mehr! Peinlich. Obwohl, tröste ich mich, war es nicht auch schon peinlich, dass er mich aus den Fängen eines nach Fusel stinkenden Lustmolchs retten musste? Und dass ich ihm anschließend im Hafen ohnmächtig in die Arme gesunken bin? Spätestens seit dieser Aktion bin ich bestimmt vollkommen bei ihm unten durch. Da werden ihn ein paar unfeine Tischmanieren wohl kaum noch überrascht haben.
Mein Ausruf lässt ihn innehalten und aufblicken. „Sie scheinen hungrig gewesen zu sein“, stellt er nüchtern fest. „Kein Wunder, da Sie sowohl das Frühstück, als auch den Lunch ausgelassen haben.“ Er scheint keine Antwort von mir zu erwarten, sondern steckt die Schreibfeder zurück ins Tintenfass, das ich gestern Abend noch für einen Dekoartikel gehalten habe. Dann greift er nach seiner Pfeife, die er während des Schreibens neben sich abgelegt hatte und lehnt sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. Augenblicklich verstärkt sich der Vanilleduft im Raum, als er an der Pfeife zieht und mich dabei mit seinen ungewöhnlich blauen Augen mustert.
„Ich, äh, möchte mich bei Ihnen bedanken“, besinne ich mich auf den letzten Rest meiner guten Manieren. „Dafür, dass Sie mir geholfen haben, in diesem düsteren Viertel.“
„In der Tat“, entgegnet er streng. „Eines der übelsten Quartiere der ganzen Stadt. Kein Ort für eine Frau! Brutstätte tödlicher Krankheiten und Unterschlupf der finstersten Gestalten, die unser ansonsten so schönes Hamburg zu bieten hat.“ Sein Ton ist mehr als vorwurfsvoll. „Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als sich ausgerechnet dort aufzuhalten! Können Sie mir vielleicht verraten, was Sie dort wollten?“
„Ich habe mich verlaufen. Bin irgendwie in diese Gassen hineingeraten und wusste nicht mehr hinauszufinden“, entschuldige ich mich. „Jedenfalls sind Sie genau im richtigen Moment aufgetaucht. Ich glaube, Sie haben mir das Leben gerettet.“
Ein Schauer überläuft mich, als ich bei diesen Worten an den grässlichen Mann mit dem Messer zurückdenke. Unwillkürlich fasse ich mir an meinen, dank Sievekings Einschreiten unversehrt gebliebenen Hals.
„Natürlich habe ich das“, entgegnet er kühl.
Die selbstverständliche Arroganz, mit der er dies sagt, bewirkt, dass sich mein aufrichtiges Gefühl der Dankbarkeit schlagartig verflüchtigt. Stattdessen fühle ich Ärger in mir aufsteigen über diesen selbstgerechten Snob. Ich versuche jedoch, ihm gegenüber einigermaßen höflich zu bleiben, denn schließlich stehe ich tief in seiner Schuld. Trotzdem kann ich mir ein paar Spitzen nicht verkneifen: „Ich muss gestehen, dass ich sehr verwundert war, als Sie dort auftauchten. Sehr erleichtert natürlich, aber auch sehr überrascht.“
Er mustert mich nur finster.
„Ich frage mich nämlich, was Sie an dieser ‚Brutstätte übelster Krankheiten und Unterschlupf finsterer Gestalten‘ gemacht haben. An einem Ort, der doch gewiss auch nichts für einen ehrlichen Kaufmann ist?“, fahre ich fort und bin innerlich sehr zufrieden mit mir. Was er kann, kann ich schließlich auch!
„Nun, ich war in Begleitung von Mathis dabei einen Dieb zu verfolgen“, erklärt er grimmig. „Oder besser gesagt: Eine Person, die Diebstahl begangen, die öffentliche Ordnung empfindlich gestört hat und auch vor der Beschädigung fremden Eigentums nicht zurückgeschreckt ist.“
„Ach so? Und Ihre Verfolgung hat Sie dann ausgerechnet dorthin geführt, wohin ich mich verlaufen habe? Das nenne ich ja mal einen irren Zufall!“, wundere ich mich und frage mich gleichzeitig, warum er denn nicht einfach die Polizei gerufen hat. Sollte meine Vermutung also wahr sein, und es gibt in dieser Zeit tatsächlich noch niemanden, der für Recht und Ordnung sorgt? Was für ein erschreckender Gedanke.
„Einen Zufall? Nein, das würde ich nicht sagen. Unser Zusammentreffen an diesem Ort ist vielmehr der Konsequenz zu verdanken, mit der wir Ihre Spur verfolgt haben. Was im Übrigen nicht sonderlich schwierig war.“ Er nimmt einen tiefen Zug aus seiner Pfeife, sodass der brennende Tabak darin rot aufglüht.
„Moment mal! Wollen Sie damit etwa andeuten, dass ich diese gesuchte Person sein könnte?“ Ich schnappe empört nach Luft. „Was bringt Sie denn dazu mich all dieser Sachen zu beschuldigen? Dafür gibt es überhaupt keinen Grund!“
„Nicht?“, fragt er mit hochgezogenen Brauen. „Nun, lassen Sie mich einmal kurz nachdenken und mögliche Gründe aufzählen. Als da wären zum Ersten: Eine Jacke und eine Mütze, welche in meinem Hause entwendet wurden und beide dem bei mir angestellten Hinnerk Petersen gehören. – Die einzige Jacke übrigens, die Hinnerk überhaupt besitzt, weshalb er verständlicherweise reichlich ungehalten über ihren Verlust war. Zum Zweiten: Ein Aufruhr auf dem Hopfenmarkt. Ausgelöst durch einen seltsamen jungen Mann in eigenartiger Kleidung, der versucht haben soll eine Marktfrau zu prellen, indem er ihr Münzen einer nicht existenten Währung unterschob…“
Ich setze an zu widersprechen, aber er lässt mich nicht zu Wort kommen und fährt ungerührt fort: „Zum Dritten: Ein Unfall an der Pulverturmbrücke. Hervorgerufen durch denselben vermeintlich jungen Mann, als er blindlings vor das Fuhrwerk des Bestatters Karl-Friedrich Pelzig lief. Die halbe Lieferung neu gefertigter Särge glitt bei Herrn Pelzigs Versuch, einen Aufprall zu verhindern, von der Ladefläche herunter, zerschellte teilweise auf der Straße oder rutschte gar in den Herrengraben. Der Schaden ist beträchtlich. – Na? Mir scheint, Sie sind ein wenig blass um die Nase geworden! Haben Sie vielleicht doch etwas zu alledem zu sagen?“
Ich schlucke hart. Dass ich eine derartige Spur der Verwüstung hinter mir hergezogen haben könnte, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich mir doch bloß die Stadt ansehen und mir etwas zu Essen besorgen.
Henry Sieveking wartet auf meine Antwort, wobei er mich mit Blicken zu durchbohren versucht.
Ich fasse mir ein Herz, hole einmal tief Luft und setze zu meiner Verteidigung an: „Sie wollen wissen, was ich dazu zu sagen habe? Also gut. Lassen Sie mich mit Punkt drei beginnen: Dazu kann ich nur sagen, dass Herr Pelzig eine Mitschuld an dem Unfall hat, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist. Er ist mit einem derartigen Affenzahn angekommen, dass es früher oder später zu einem Unfall kommen musste. Ich war bloß dummerweise zur falschen Zeit am falschen Ort. Und wenn Herrn Pelzigs Särge schon bei der geringsten Vollbremsung vom Wagen stürzen, dann sollte er sich mal darüber Gedanken machen, wie er in Zukunft seine Ladung besser absichert! Zu Punkt zwei: Ich habe der Marktfrau keineswegs eine Währung angedreht, die nicht existiert. Den Euro gibt es sehr wohl, da wo ich herkomme. Ich habe auch versucht, das der Dame zu erklären. Aber bedauerlicherweise war sie für vernünftige Argumente nicht empfänglich.“
Nun ist es an mir, ihn nicht zu Wort kommen zu lassen, als er die Pfeife aus dem Mund nimmt und zu einer Erwiderung ansetzt. Jetzt bin ich dran und hole zum letzten, entscheidenden Schlag aus: „Und was Ihren letzten Vorwurf angeht, bin ich der Meinung, dass Sie sich als Arbeitgeber etwas schämen sollten, wenn Sie Ihren Angestellten derart wenig Lohn zahlen, dass sich der arme Herr Petersen nicht mal eine zweite Jacke leisten kann!“ Zufrieden lehne ich mich zurück und genieße die Wirkung meiner Worte.
Diese saßen offensichtlich. Jedenfalls erlebe ich Henry Sieveking zum ersten Mal sprachlos. Sprachlos und zweifellos superstinkig, der Tiefe seiner Stirnfalte nach zu urteilen. Insbesondere mein indirekter Vorwurf, dass er seine Arbeiter ausbeutet, hat ihm vermutlich nicht geschmeckt.
Ein Donnerschlag draußen verleiht meiner Aussage noch zusätzlichen Nachdruck, so als hätte ich ihn eigens dafür bei der himmlischen Abteilung für Special Effects bestellt.
In diesem Moment klopft es an der Tür. Mathis, der Hausdiener, tritt ein und unterbricht unseren Disput. Er hat einen dicken Knüppel in der Hand, ähnlich dem der wilden Marktfrau am Hopfenmarkt – und meine Handtasche in der anderen! Zuerst glaube ich meinen Augen nicht zu trauen, aber sie ist es, eindeutig.
„Oh Mathis! Sie haben meine Tasche! Woher wussten Sie denn…? Und wie haben Sie es bloß geschafft, sie zurückzubekommen?“, sprudle ich dankbar hervor und gehe auf ihn zu. „Das ist aber nett von Ihnen! Vielen, vielen, herzlichen Dank!“ Ich kann mein Glück kaum fassen und strahle über das ganze Gesicht. Zuerst rettet Sieveking mich aus höchster Bedrängnis – das muss man dem aufgeblasenen Angeber ja nun mal lassen. Und dann bekomme ich jetzt, quasi als Sahnehäubchen, noch meine Tasche wieder! Es ist zwar nicht so, dass die Tasche oder ihr Inhalt in irgendeiner Weise wertvoll wäre, jedenfalls nicht finanziell. Aber für mich stellt sie meine letzte Verbindung nach zu Hause dar. Sie ist der sichtbare Beweis, dass ich aus einer anderen Welt komme. Einer, nach allem was ich bisher gesehen habe, eindeutig besseren Welt, in der es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, Arbeitnehmerrechte, eine Polizei, sichere, saubere Straßen und, und, und.
„Es war mir ein Vergnügen“, entgegnet Mathis nur und gibt mir die Tasche zurück. Sein Blick lässt erahnen, dass er den Jungs, die mich beraubt haben, wohl ganz schön eingeheizt hat. In diesem Moment sieht er gar nicht mehr so verschlafen aus, wie seine Schlupflider einen auf den ersten Blick glauben machen. „Außerdem bat Ida mich, Ihnen mitzuteilen, dass Sie Ihnen ein Bad gerichtet hat“, fügt Mathis hinzu.
„Ein Bad? Das hört sich gut an! Und ich dachte schon, in dieser Welt gäbe es überhaupt keine Errungenschaften der Zivilisation!“, rufe ich entzückt aus.
Mathis und Sieveking tauschen einen leicht indignierten Blick.
Dann nickt Sieveking mir zu und ätzt: „Ja, bitte nehmen Sie ein Bad! Sehen Sie zu, dass Sie den Gestank der Gosse endlich abwaschen, aus der wir Sie ziehen mussten!“ Seine Blicke scheinen mich durchbohren zu wollen, und einen Moment lang ist es mir so, als ob es nicht nur draußen vor dem Fenster gefährlich blitzt.
Samstag, 20. August 2016
Konzentriert lässt Gregor einen dreieckigen Splitter in eine Lücke zwischen zwei größeren Scherben gleiten. Die Pinzette, mit der er das Stückchen festhält, zittert ein wenig, und als er es einfügt, gerät es ihm ein bisschen schräg, sodass es für einen kurzen Moment so aussieht, als habe er das falsche Puzzleteil erwischt. Aber dann lässt es sich doch noch geraderücken und fügt sich fast nahtlos in die Bruchstelle ein. Gregor seufzt erleichtert. Wieder einmal ein kleiner Erfolg auf dem langen Weg zur Rekonstruktion der Spiegelscheibe. Auch wenn diese Arbeit wahrscheinlich vollkommen sinnlos ist und Lena höchstwahrscheinlich nicht zurückbringen wird, hat er festgestellt, dass die Konzentration auf das Scherbenpuzzle ihn wenigstens ein Stück weit beruhigt, sodass er wieder einigermaßen klar denken kann und nicht ständig versucht ist, aus Sorge um Lena wie ein Irrer im Kreis herumzulaufen und sich dabei die Haare zu raufen.
Alex sitzt in einem antiken Lehnstuhl, den er aus dem Laden hierher ins Büro geholt hat, und telefoniert. Gerade beendet er das Gespräch, indem er sich vielmals bedankt, bevor er auflegt.
„Und?“, fragt Gregor sofort.
„Also“, beginnt Alex. „Das da gerade war der Neffe einer alten Dame aus Bremen. Seine Tante ist vor fünfzehn Jahren verstorben, und er war Teil ihrer Erbengemeinschaft, die den Spiegel damals von einem Auktionshaus hat versteigern lassen. Bei dieser Versteigerung ging der Spiegel an Herrn Lübbenau, von dem wiederum mein Opa das gute Stück für den Laden erworben hat.“ Alex klopft mit seinem Kugelschreiber auf den Notizblock auf seinen Knien, wo er während seiner vorausgegangenen Telefonate alles mitgeschrieben hat, was ihm wichtig erschien. „Der Neffe der Bremer Dame sagt, er sei oft im Haus seiner Tante zu Gast gewesen, und der Spiegel habe seines Wissens nach über Jahrzehnte hinweg in deren Wohnzimmer gehangen“, fährt er fort. „Er sei wohl ursprünglich mal ein Geschenk zur Hochzeit seiner Großeltern gewesen. Deren Heirat wiederum hat um das Jahr 1940 stattgefunden.“
„Dann müssen wir also versuchen herauszufinden, wer dem jungen Paar damals diesen Spiegel geschenkt hat“, ergänzt Gregor.
„Tja“, meint Alex und kratzt sich am Kopf. „Genau das, fürchte ich, wird nicht so einfach werden. Die Hochzeit fand nämlich in Warschau statt.“
„Und? Dann müssen wir eben ehemalige Antiquitätenläden in Warschau finden“, meint Gregor.
„Du vergisst, dass Warschau um 1940 von den Nazis besetzt war und dass diese so ziemlich alles an sich gerafft haben, was irgendwie von Wert war. Beutekunst zum Beispiel“ erklärt Alex. „Oder eben auch Antiquitäten, insbesondere wenn sie vielleicht auch noch jüdische Besitzer hatten. Hier lautet das Stichwort Zwangsenteignung.“
„Oh Mist. Du meinst also, derjenige, der dem Hochzeitspaar den Spiegel geschenkt hat, könnte auf illegalem Wege daran gekommen sein? - Wenn das der Fall sein sollte, wird es wohl kaum irgendwo eine Liste geben, aus der hervorgeht, wem der Spiegel tatsächlich gehört hat?“ Gregor lässt enttäuscht die Schultern hängen.
„Und damit ist die Spur für uns unterbrochen, die der Spiegel im Lauf durch die Jahrhunderte hinterlassen hat“, ergänzt Alex und macht eine entschuldigende Geste. „Es war uns von Anfang an klar, dass es schwierig werden wird, die Besitzverhältnisse eines über zweihundertjährigen Spiegels nachzuvollziehen“, ruft er Gregor ins Gedächtnis. „Unsere Chancen wären nur gut gewesen, wenn er über all die Jahre hinweg im selben Schloss oder Museum gehangen hätte. Aber so etwas gibt es nur ganz selten.“
„Ja, ich weiß“, nickt Gregor und seufzt enttäuscht. „Trotzdem hatte ich gehofft, dass es in diesem Fall so sein könnte.“
„Wir haben es wenigstens versucht“, tröstet Alex. „Und am Montag werde ich mal bei der Stadtverwaltung von Lohr am Main anrufen. Die Spiegelmanufaktur existiert zwar schon lange nicht mehr. Aber vielleicht gibt es irgendwo ein Archiv, in dem noch die alten Bücher gelagert werden? Wenn wir Glück haben, hat irgendein pingeliger Buchhalter vor zweihundert Jahren aufgelistet, für wen dieser Spiegel ursprünglich einmal hergestellt worden ist. Das wäre dann der vielleicht einfachere und kürzere Weg, um etwas über sein Geheimnis herauszufinden.“
„Bis Montag sind es noch fast zwei Tage. Vielleicht geschieht ja bis dahin ein Wunder und Lena taucht von alleine wieder auf“, versucht Gregor es mit Optimismus, obwohl er eigentlich niemand ist, der an Wunder glaubt.
*
Genießerisch lasse ich mich ins warme Seifenwasser gleiten. So tief, wie es die schmale und viel zu kurze Zinkbadewanne zulässt. Der Nachteil meines Eintauchens ist, dass dadurch automatisch meine Knie wieder weiter aus dem Wasser herausragen und ich wie zusammengefaltet in der Wanne eher sitze, als liege. Aber was soll’s? Es ist warmes Wasser und es duftet nach Lavendel. Ich genieße das Gefühl, endlich wieder sauber zu sein und mit dem Dreck einen Teil der schrecklichen Erinnerungen an meine Erlebnisse vom Vormittag von mir abzuwaschen. Bei diesem Gedanken meine ich fast, noch immer den Gestank des Messermannes zu riechen, der mir auf der Haut klebt. Besonders da, wo seine Arme meinen Hals berührt haben.
Hastig wasche ich zum wiederholten Male meinen Hals und versuche die Erinnerung fortzuschieben. Ich will mich nicht weiter unnötig mit den Bildern quälen. Weder mit denen an den Messermann noch an die der verwahrlosten Jungs, die mich beraubt haben. Stattdessen mache ich es mir so gut es geht bequem, schließe die Augen und lausche den Geräuschen, die durch das halb geöffnete Fenster eindringen.
Draußen entlädt sich ein heftiges Gewitter, dessen Donnerschläge das Haus zum Teil ebenso erschüttern, wie es der Lastenaufzug heute Morgen tat. Regen rauscht in Strömen vom Himmel herab und vermischt sich prasselnd mit dem Wasser des Nikolaifleets, das inzwischen längst wieder geflutet ist.
Ich befinde mich in einem kleinen schmalen Raum im zweiten Stockwerk des Sieveking-Hauses, nur zwei Türen neben dem Zimmer, in dem ich die Nacht verbracht habe. Die Badestube besteht tatsächlich aus nicht mehr als einem gusseisernen Ofen, der jetzt in der Augusthitze natürlich nicht geheizt wird, einem Stuhl zum Ablegen der Kleider und eben jener Zinkwanne, in der ich bade.
Nachdem Mathis mich hierher geführt hat, habe ich Ida kennengelernt, eine dralle Sechzehnjährige, der ein Wust wilder schwarzer Locken unter dem weißen Häubchen hervorlugt. Ida hat das heiße Wasser mühsam mit Eimern aus der Küche, wo es auf dem Herd erhitzt worden ist, hier hinauf geschleppt. Das muss eine ziemliche Plackerei gewesen sein, weshalb ich mich auch niemals darüber beschweren würde, dass die Wanne so klein ist. Ida ist es auch, die nun das Zimmerchen wieder betritt, mir aus der Wanne hilft und mich in ein Handtuch aus Leinen wickelt.
„Ich habe Ihnen etwas zum Anziehen herausgelegt. Herr Sieveking meinte, ich solle Ihnen etwas von seiner Schwägerin geben“, erklärt Ida, während sie mich zurück in meinen Schlafraum führt. Dort liegt zu meinem Schrecken auf dem Bett ausgebreitet eines der schulterfreien Hammelkeulenkleider, über die ich mich am Vormittag noch amüsiert habe, noch dazu mit einem voluminösen Unterrock, der nicht nur wie eine Rosshaardecke aussieht, sondern bestimmt auch ähnlich schwer ist.
Jetzt muss ich mich also selber wohl oder übel in ein solches Monstrum hineinzwängen, da meine eigenen Sachen nicht nur zu auffällig, sondern vom heutigen Tag auch mehr als verdreckt sein dürften. Obwohl mir der Gedanke überhaupt nicht gefällt, in einem solch lächerlichen und noch dazu sperrigen Ding herumlaufen zu müssen, füge ich mich zähneknirschend. Die Alternative wäre schließlich wohl, nackt herumzulaufen. Also schlüpfe ich in die Seidenstrümpfe und lasse mir in den Rosshaarunterrock helfen, bevor Ida mich dann auch noch in ein Korsett schnürt und es derart festzieht, dass mir die Luft wegbleibt. Wie soll man denn darin atmen, geschweige denn sich bewegen, frage ich mich verzweifelt. Aber ich sage nichts und schlucke all meine Bedenken hinunter, da Ida diese wohl kaum verstehen würde. Zum Schluss reicht sie mir das Kleid aus grünem Stoff, der mit einem Blümchenmuster versehen ist.
Der Stoff und die Farbe sind hübsch, zweifellos. Aber schon bald müssen wir feststellen, dass mir das Kleid viel zu klein ist. In der Breite geht es, dank Idas enger Schnürung des Korsetts. Aber die Länge reicht vorne und hinten nicht. Das Kleid reicht mir gerade einmal bis knapp über die Knie und lässt ein gutes Stück des Rosshaarrocks unten hervorlugen.
„Oh weh! Das geht so nicht!“, stellt Ida fest und reißt entsetzt ihre braunen Kulleraugen auf.
„Nein, auf keinen Fall“, stimme ich ihr zu, obwohl ich in modischen Fragen dieser Zeit natürlich völlig unbewandert bin. Aber das, was ich hier an mir sehe, deckt sich nur wenig mit dem, was ich heute in der Stadt gesehen habe. Im Gegenteil, sehe ich eher aus wie eine Karikatur der derzeitigen Mode.
„Ich hatte es bereits befürchtet. Frau Sieveking ist wesentlich kleiner als Sie“, erklärt Ida und legt nachdenklich die Stirn in Falten. Dann hellt sich ihr Gesicht auf. „Warten Sie einen Moment, ich glaube, ich weiß etwas Besseres!“, bittet sie mich und huscht aus dem Zimmer.
Da ich mich in den zu engen und zu kurzen Klamotten ohnehin nicht bewegen mag, komme ich ihrer Aufforderung gerne nach. Während sie weg ist, schaue ich aus dem Fenster. Der Himmel über den Giebeln auf der anderen Seite des Fleets ist noch immer mit blaulila Wolken überzogen. Aber der Regen hat bereits aufgehört, und nur in der Ferne lässt sich noch gelegentlich ein Grollen vernehmen.
Zum Glück dauert es nicht allzu lange, bis Ida wiederkommt und ein einfarbiges, pastellgrünes Kleid bringt, das wie Seide glänzt. „Schauen Sie nur! Ist das nicht herrlich?“, erkundigt sie sich begeistert.
„Ja, das ist es wirklich“, kann ich nicht umhin ihr beizupflichten, denn der ultrafeine, glatte Stoff scheint das Licht in tausend Regenbogenfarben zu reflektieren, als sei das Kleid aus einem wundersamen Stoff gefertigt, den es nur im Märchen gibt. „Wo hast du das denn auf einmal hergezaubert?“, erkundige ich mich beeindruckt.
„In einem der unbenutzten Schlafzimmer weiß ich einen Schrank. Da habe ich’s her“, gibt Ida freimütig Auskunft.
Ich schlüpfe mit Hilfe des Mädchens hinein und stelle zu unser beider Freude fest, dass es passt! Die Länge ist genau richtig, und auch von der Breite her ist es so großzügig geschnitten, dass Ida mir sogar das Korsett lockern kann. Allein dafür liebe ich dieses Kleid. Einziger Nachteil ist, dass die Ballonärmel noch aufgeblasener sind, als bei dem Blümchenkleid von vorhin. Das sind wahrhaftig Hammelkeulen! Dagegen war alles andere, was ich bisher an Ärmeln gesehen habe, harmloser Schinken. Aber davon abgesehen ist das Kleid wunderschön. Andächtig streiche ich mit der Hand über den seidigen Stoff. Er fühlt sich wunderbar weich und auch ganz schön teuer an.
Derweil hat Ida auf der Kommode Bürsten, Kämme und allerlei Handwerkszeug ausgelegt. Sie platziert mich davor auf dem Stuhl des Sekretärs und beginnt mich zu bearbeiten, während wir ein wenig miteinander plaudern.
Ich erfahre, dass sie seit zwei Jahren bei den Sievekings arbeitet und sich die übrigen Familienmitglieder zur Zeit in ihrem Sommerhaus an der Elbe aufhalten. Zur Familie zählen neben Eduard Sievekings Frau Hetty und ihren gemeinsamen drei Kindern, auch noch eine unverheiratete Großtante sowie die beiden Kinder des älteren Herrn Sieveking. Damit meint sie wiederum offensichtlich den grimmigen Henry.
Überrascht schnappe ich nach Luft. Bisher ist es mir noch nicht in den Sinn gekommen, dass dieser stocksteife Erbsenzähler eine Frau und Kinder haben könnte.
Wobei mir auffällt, dass Ida auch keine Frau erwähnt hat. Möglichst gleichmütig, um nicht neugierig zu wirken, erkundige ich mich danach.
„Ich weiß nur, dass sie schon vor Jahren verstorben ist. Lange, bevor ich hier in Stellung gekommen bin“, erklärt Ida schulterzuckend. Dann erzählt sie weiter, dass die Familie erst im Laufe des Septembers wieder zurückkommen wird, wenn die Tage kühler werden. „Eigentlich arbeite ich ebenfalls im Sommerhaus. Aber Herr Sieveking hat mich herrufen lassen, als feststand, dass sein Bruder alsbald aus Afrika zurückkehren würde. - Damit für dessen Bequemlichkeit gesorgt wird. Wo er doch so lange fort war, da unten bei den Wilden“, plappert sie unbekümmert vor sich hin.
Bei ihren Worten zucke ich unwillkürlich innerlich zusammen. Von Political Correctness hat sie offenbar noch nie etwas gehört.
„Also ich könnte das ja nicht, jahrelang alleine unter den Negern leben. Wie haben Sie das denn bloß ausgehalten?“, setzt sie noch eins drauf.
„Wie jetzt? Ausgehalten?“, frage ich irritiert und vergesse darüber glatt, sie wegen ihrer diskriminierenden Ausdrucksweise zurechtzuweisen.
„Na auf Sansibar! Dorther hat Herr Sieveking Sie doch mitgebracht“, erinnert sie mich und fährt neugierig fort: „Ist es tatsächlich wahr, dass Ihr Schiff von Piraten überfallen und Sie dabei Ihres gesamten Gepäcks beraubt wurden?“
Ich bin einen Moment lang verwirrt, bis ich begreife, dass Ida eine Geschichte wiedergibt, die Herr Sieveking ihr wohl aufgetischt hat, um mein plötzliches Auftauchen zu erklären.
Bei näherer Betrachtung sicherlich nicht dumm. Und gar nicht mal so furchtbar weit hergeholt. Schließlich bin ich heute tatsächlich überfallen und bestohlen worden. Trotzdem hätte ich es nett gefunden, wenn Sieveking mich über diese Geschichte in Kenntnis gesetzt hätte. Schließlich ist es mein fiktives Leben, das er da mal soeben im Vorbeigehen erfindet. Dabei hätte ich gerne ein Wörtchen mitzureden!
Aber gut. Zunächst einmal gilt es mitzuspielen. Deshalb antworte ich: „Die Piraten? Ja, oh ja! Die waren schrecklich.“ Währenddessen zittert sogar meine Stimme ein bisschen, weil ich dabei an die abgerissene Jugendbande denke und wie sie mich umkreist hat, um an meine Tasche zu kommen.
„Und dann sind Sie auch noch über Bord gegangen!“, ruft Ida entsetzt. „Was für ein Glück, dass das Schiff von Herrn Sieveking gerade vorbeikam, um sie aus dieser höchsten Not zu retten! Er soll höchstpersönlich ins Meer gesprungen sein, um sie da herauszuholen!“
„Ja wirklich. Ein Riesenglück“, nicke ich und nehme mir vor, mir diesen Aufschneider bei nächster Gelegenheit ernsthaft vorzuknöpfen. Um Ida von dieser Superheldengeschichte abzulenken, in der ich offensichtlich die wenig rühmliche Rolle des hilflosen Opfers innehabe, erkundige ich mich nach Eduard Sieveking. „Ich habe ihn heute den ganzen Tag über noch nicht zu Gesicht bekommen“, wundere ich mich.
„Er ist heute ganz früh schon zur Börse gefahren“, informiert sie mich, „und anschließend hat er die Familie besucht, um sie über Ihre Ankunft zu unterrichten und darüber, dass Sie noch ein paar Tage der Erholung benötigen, bevor Sie ihnen vorgestellt werden können. Aber heute Abend wird er zum Essen zurückerwartet. So. Fertig.“ Ihre letzte Bemerkung bezieht sich auf meine Frisur.
Ich hebe den Kopf, um mich im Spiegel zu betrachten, dem ich während unseres Gesprächs keine große Aufmerksamkeit gewidmet habe. Nun jedoch entfährt mir ein überraschter Laut, als ich die vermeintlich fremde Frau sehe, die mir entgegenblickt: Mein rötliches Haar ist zu einem geranienförmigen Dutt am Hinterkopf aufgesteckt. Zum Glück so hoch, dass er knapp über meiner Beule sitzt und nicht auf diese drückt. An den Seiten hat Ida einzelne Strähnen aus dem Dutt gelöst und diese zu dicken Locken aufgedreht, die mein Gesicht nun einrahmen und ihm etwas ungewohnt Mädchenhaftes verleihen. Unterstrichen wird dieser Eindruck noch von einem kleinen, dezenten Blumenschmuck, den sie in den Ansatz des Dutts gesteckt hat. Die Blumen haben dieselbe Farbe wie meine Augen und bringen diese auffällig zum Leuchten. Ida hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich sehe aus wie eine der Bürgerinnen heute Vormittag in der Stadt. Noch dazu wie ein ganz besonders vornehmes und elegantes Exemplar!
„Schauen Sie nur, wie schön Sie geworden sind!“, ruft Ida begeistert aus, was ich zwar erstaunt, aber hocherfreut zur Kenntnis nehme.