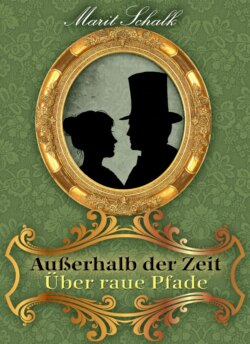Читать книгу Außerhalb der Zeit - Marit Schalk - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 6
ОглавлениеEine ganze Weile lang sitze ich dort auf dem Hafenpoller, die Handtasche zu meinen Füßen. – Die von nun an wohl meinen sämtlichen Besitz beherbergt, wie mir mit Schrecken bewusst wird. In welcher Zeit ich hier wohl bin? Ich habe keine Ahnung. Jetzt rächt es sich, dass ich mich nie sonderlich für Geschichte und die damit verbundenen Daten und Zahlen interessiert habe, sondern bloß immer nur für alte Möbel und antiken Plunder.
Ich beobachte das Treiben im Hafen und lausche dabei dem gewohnten Kreischen der Möwen. In den meterhohen Takelagen der Segler klettern vereinzelt Matrosen herum. An den obersten Spitzen der Masten flattern die Erkennungsfahnen der Reedereien im Wind.
Schauerleute sind unter lauten Rufen damit beschäftigt Schiffe zu beladen. Andere wiederum sind dabei, Ladung zu löschen und die Waren auf Schuten zu bringen, die dann, von Ewerführern mit routinierten Bewegungen gelenkt, in den Fleeten verschwinden, um dort die Lagerhäuser in der Stadt anzusteuern. Jedenfalls glaube ich zu wissen, dass es so ist, habe ich doch mal irgendwann eine Fernseh-Doku über den Hamburger Hafen gesehen, in der das erklärt wurde.
Zu meiner Linken sind Kaiarbeiter gerade dabei, mit Hilfe eines hölzernen Krans gewaltige Baumstämme auf ein Pferdefuhrwerk zu verladen. Die Pferde vor dem Fuhrwerk sind riesige Kaltblüter. Mit ihren mächtigen Hufen stampfen sie auf das Kopfsteinpflaster und schnauben vor Anstrengung, als der Wagen fertig beladen ist und die Tiere die schwere Last davon ziehen.
Zu meiner Rechten werden Säcke gestapelt, die Kaffeebohnen enthalten, wie der Aufdruck auf der Jute verrät.
Arbeiter mit einfachen hölzernen Schub- oder Handkarren transportieren kleinere Warenmengen von einem Ort zum anderen. Dazwischen entdecke ich Träger, die Lasten auf ihren Schultern schleppen, indem sie das Gewicht links und rechts an einem Holz befestigt haben. Sogar Wasserträger sind dabei, die auf diese Weise fast randvolle Eimer vorwärts balancieren, ohne etwas zu verschütten.
Weiter hinten im Hafen kann ich fasziniert beobachten, wie gigantische Eisblöcke aus dem Bauch eines Schiffes geschafft und eilig abtransportiert werden, um sie vor der sengenden Augustsonne so gut es geht zu schützen.
Inzwischen steht die Sonne bereits hoch am Himmel und es ist wieder warm geworden. Ich wage es jedoch nicht die Jacke auszuziehen, da ich dann mit Sicherheit noch mehr auffallen würde, als ohnehin schon. Ähnlich wie bei dem Mädchen vorhin in der Deichstraße, treffen mich auch hier hin und wieder irritierte Blicke, und ich werde einer stirnrunzelnden Musterung unterzogen. Ob die Leute merken, dass hier eine Frau in Männerkleidung sitzt? Oder ob ihnen meine Jeans und Sneakers seltsam vorkommen, obwohl ich sie so gut es ging getarnt habe?
Ich beschließe, meinen Beobachtungsposten aufzugeben, bevor jemand auf die Idee kommt mich anzusprechen und unangenehme Fragen zu stellen. Außerdem knurrt mein Magen vernehmlich, schließlich habe ich seit dem Käsebrot von gestern Abend nichts mehr gegessen, und davon abgesehen, treibt mich auch die Neugier weiter. Wenn ich schon in diesem alten Hamburg gelandet bin, dann sollte ich die Gelegenheit nutzen und mich ein wenig darin umsehen. So etwas passiert einem ja schließlich nicht alle Tage. Und wer weiß? Vielleicht habe ich auf diesem Stadtspaziergang unverschämtes Glück und es tut sich für mich eine Möglichkeit auf, wie ich wieder zurück in meine eigene Zeit gelangen kann? Eine gute Idee wenigstens, wenn schon kein Wunder?
Also schultere ich meine Tasche und ziehe los. Zunächst gehe ich noch ein Stück am Hafenbecken entlang, da mich der Anblick der Segelschiffe einfach nicht loslässt. Ich glaube, zu meiner Zeit gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr so viele Großsegler, wie sie hier in diesem einzigen Hafen ankern. Ein Hafen übrigens, der noch deutlich kleiner ist, als der, den ich kenne und in dem es dementsprechend voll und eng ist.
‚Der Senat sollte sich mal dringend Gedanken über eine Erweiterung machen‘, denke ich, als ich zu einer schmalen Brücke komme, die von meiner Orientierung her wohl zur Halbinsel Kehrwieder führt. Zu meinem Erstaunen gibt es dort aber noch keine Speicherstadt und erst recht keine Baustelle der Elbphilharmonie zu bestaunen. Die roten Backsteinhäuser, die Hamburg im letzten Jahr den Weltkulturerbe-Status eingebracht haben, existieren ganz offensichtlich noch nicht. Stattdessen ist das ganze gegenüberliegende Ufer dicht an dicht mit Kaufmannshäusern bebaut, ganz ähnlich wie die Deichstraße am Nikolaifleet, von wo ich hergekommen bin. Auch hier befinden sich Kontore und Geschäftsräume im Erdgeschoss. Darüber liegen zwei oder drei Etagen mit Wohnräumen, die deutlich an den seitlich gerafften Gardinen in den Fenstern erkennbar sind. Ganz oben in den Giebeln schließlich kann man die Luken der Lagerräume sehen. Auf dem Fleet zwischen mir und den Häusern liegen Schuten im Wasser vertäut, in denen die Schiffer herumhantieren und vermutlich auf Kundschaft warten.
Da ich unter den Geschäften auf der Insel keine Bäckerei oder einen Lebensmittelladen erkennen kann, wo ich mir etwas zu essen besorgen könnte, wende ich mich ab und lenke meine Schritte mehr ins Stadtzentrum. Dabei weisen mir die Spitzen der Kirchtürme den Weg und bieten mir eine grobe Orientierung, auch wenn die Turmhelme teilweise anders aussehen, als ich sie vor meinem inneren Auge habe.
Ich folge einer Straße in Richtung Zentrum, die von weiteren Bürger- und Kaufmannshäusern gesäumt wird, vor denen Frauen mit langen Schürzen und Hauben auf dem Kopf mit Einkaufskörben entlanggehen. Manche sind auch damit beschäftigt Treppenaufgänge zu fegen, andere putzen die Fenster oder schütteln Federbetten aus. Wenn diese Frauen nicht wären, könnte ich mir vorstellen im Lübeck der heutigen Zeit zu sein. Genauso sieht es dort noch immer aus. Als mir dann wieder einmal ein befrackter Herr mit Zylinder und Spazierstock über den Weg läuft, fühle ich mich wie in einen Film über die Buddenbrooks versetzt.
Nein, dies ist kein Film, verbessere ich mich zum wiederholten Male. Es gibt hier genauso wenig einen Regisseur wie einen Versuchsleiter für ein vermeintliches Experiment. Das alles hier ist real, auch wenn ich es noch immer nicht richtig fassen kann.
An der nächsten Straßenecke begegnet mir ein Paar, dessen männliche Hälfte ähnlich wie die Sieveking-Brüder gekleidet ist. Die Frau an seiner Seite ist für mich jedoch der Hingucker schlechthin: Die Dame trägt ein langes, roséfarbenes Kleid, das in der Taille eng geschnürt ist und in einen knöchellangen, bauschigen Rock übergeht, unter dem mindestens noch ein weiterer Unterrock zu stecken scheint, wenn nicht sogar zwei. Das Kleid ist schulterfrei, weshalb die Frau gegen eventuelle Zugluft ein leichtes Tuch um sich drapiert hat, ähnlich jenem, das mir die Sievekings gestern Abend ausgeliehen haben. Der absolute Blickfang aber – und wahrscheinlich vollkommen unpraktisch – sind die riesigen Puffärmel des Kleides, die nur die Oberarme bedecken und die Unterarme dadurch merkwürdig dünn wirken lassen. Es sieht aus, als hätte die Dame anstelle von Armen zwei riesige Hammelkeulen am Körper. Bemerkenswert ist außerdem ihr Hut, der mit einer rosa Schleife unter dem Kinn gebunden ist und aufgrund seiner Form das Gesicht der Frau nicht nur beschattet, sondern sie meiner Einschätzung nach wohl auch in der Sicht zur Seite hin einschränken muss. So ähnlich wie die Scheuklappen bei Pferden. Was die Haube vorne zu viel hat, hat sie hinten allerdings zu wenig. Da ist sie nämlich offen, so dass der Dutt, zu dem das Haar aufgesteckt ist, hinten herausragt. Fast könnte man meinen, die Dame habe ihren Hut falsch herum auf dem Kopf. Aber wenn dem so wäre, hätte ihr Begleiter sie doch wohl hoffentlich darauf aufmerksam gemacht?
Schmunzelnd gehe ich weiter. Einen solchen Aufzug hat die Welt ja wohl noch nicht gesehen!, denke ich, werde allerdings schon sehr bald eines Besseren belehrt, als mir bei meiner Erkundungstour noch weitere Frauen begegnen, die in ähnlicher Aufmachung herumlaufen. Was nur den einen Schluss zulässt: dass Hammelkeulen, Wespentaillen und Scheuklappenhüte hier derzeit modisch der letzte Schrei sind. Insgeheim beglückwünsche ich mich, dass ich so nicht herumlaufen muss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Modetrend jemals wieder eine Renaissance erleben wird.
Apropos Renaissance. Das ist doch die Bezeichnung für eine geschichtliche Epoche. Vielleicht sollte ich mal irgendeinen der Passanten anhalten und fragen, ob er oder sie meint, in der Renaissance zu leben?
Aber dann schüttle ich unwillig den Kopf über mich selbst. Ich sollte wirklich zusehen, dass ich endlich etwas Nahrhaftes in den Magen bekomme. Vor lauter Unterzuckerung komme ich schon auf völlig bescheuerte Ideen.
Ich gelange zu einer Brücke, überquere ein breites Fleet und erreiche endlich einen großen Marktplatz vor einer äußerst prächtigen Kirche, deren Aussehen mich an keines der Gotteshäuser erinnert, die ich aus meiner Zeit kenne. Auch das Glockenspiel, das in diesem Moment vom beachtlich hohen Turm ein frommes Lied zum Besten gibt, habe ich noch nie zuvor vernommen. Deshalb bin ich auf einmal unsicher, ob dies Sankt Nikolai ist – eine Kirche, die zu meiner Zeit nur noch als Ruine existiert, und als Mahnmal dient – und der Platz davor wohl der Hopfenmarkt ist, so wie ich es aufgrund meines erinnerten Stadtplans von 2016 erwartet habe. Aber schnell denke ich, dass es doch keine große Rolle spielt, welchen Namen dieser Ort trägt. Das Wichtigste ist, dass auf diesem Platz Händler Körbe und Kisten aufgebaut haben, aus denen heraus sie Lebensmittel verkaufen. Endlich habe ich etwas zu essen gefunden!
Mein Magen meldet sich erneut mit einem nachdrücklichen Knurren, so als wolle er auf Nummer sicher gehen, dass ich mich nun endlich um ihn kümmere. Als ob das nötig wäre. Ich fühle mich schließlich schon ganz schwach vor Hunger und fürchte bald umzufallen. Deshalb verschwende ich keine Zeit damit wählerisch zu sein und steuere die nächstbeste Händlerin an, die hinter mehreren aus Reisig geflochtenen Körben steht, aus denen sie Äpfel und Birnen verkauft.
Die Frau sieht schon recht alt aus. Ihr Gesicht ist runzlig und sie hat kaum noch Zähne im Mund. Sie trägt ein einfaches dunkles Kleid mit einer grauen Schürze darüber und auf dem Kopf einen dieser Scheuklappenhüte.
Da ich mir bewusst bin, dass um mich herum fast ausschließlich in Plattdeutsch verhandelt wird, kratze ich all meine Sprachbrocken zusammen und ordere drei Äpfel.
Sie sagt kein Wort und mustert mich einen Moment lang misstrauisch, so als habe sie mich nicht richtig verstanden. Zu meiner Erleichterung, greift sie dann aber doch in den entsprechenden Korb, sucht mit der Linken drei Äpfel heraus und streckt mir gleichzeitig ihre rechte offene Hand entgegen, um mich zum Bezahlen aufzufordern. Dabei murmelt sie etwas, aus dem ich glaube das plattdeutsche Wort „Twee“ für zwei herausgehört zu haben.
Also öffne ich brav meine Tasche, die ich vor mir abgestellt habe, hole daraus meinen Geldbeutel hervor und lege ihr ein Zwei-Euro-Stück auf die ausgestreckte Handfläche, während ich die Äpfel an mich nehme. Ich habe mich noch nicht gebückt, um meinen Kauf in die Tasche zu legen, als plötzlich ein Gezeter losgeht, als habe ich ihr gedroht sie umzubringen.
Auf einmal kann die Dame also doch reden. Und wie! Ein zorniger Wortschwall auf Plattdeutsch geht auf mich nieder, in einem Tempo und mit Begriffen, die mich dann doch überfordern. Allerdings ist mir klar, dass es wenig Schmeichelhaftes ist, was sie sagt. Zwischendurch verstehe ich dann immer mal wieder „Taler“, „Preußisch“ oder irgendetwas, das sich wie „Mark Courant“ anhört.
Ich begreife, dass sie die Euromünze nicht akzeptieren will und eine andere Währung haben möchte – die ich aber blöderweise natürlich nicht habe. Was mache ich denn jetzt? Ich muss diese Äpfel unbedingt haben, sonst falle ich hier gleich um vor Hunger!
Tapfer versuche ich gegen den empörten Wortschwall der Alten anzukommen. Ich rede freundlich auf sie ein und versichere ihr gefühlte einhundertmal, dass es sich bei der Münze, die ich ihr gegeben habe tatsächlich um echtes Geld handelt, für das sie sich einmal etwas wird kaufen können. Na ja, also in dreihundert Jahren ungefähr. Vielleicht auch erst in vierhundert? Ich weiß ja noch immer nicht, in welchem Jahrhundert ich hier eigentlich unterwegs bin. Deshalb werden meine Angaben an dieser Stelle zwangsläufig etwas unpräzise.
Aber das merkt die Frau ohnehin nicht. Sie ist dermaßen sauer, dass sie mir gar nicht richtig zuhört. Stattdessen wird ihr Geschrei noch eine Spur lauter, und plötzlich zieht sie unter ihren Röcken einen Knüppel hervor.
Panik erfasst mich. Offensichtlich ist die Dame im Begriff mir den Stock über den Schädel zu ziehen.
Und sie ist nicht die Einzige, die mir ans Leder will: Mehrere Umstehende haben unseren Disput verfolgt und machen nun Anstalten der vermeintlich betrogenen Händlerin beizustehen.
Ich überlege nicht mehr lange, raffe meine Tasche und gebe Fersengeld. Sekunden später schlängele ich mich durch das Gedränge der Marktbesucher, renne hakenschlagend zwischen den Verkaufsständen umher, springe über Körbe mit frischen Eiern und Kisten voller Kohlköpfe. Remple Menschen an und ernte weitere wüste Beschimpfungen. Endlich habe ich das Ende des Markts erreicht und schlage mich nach links in eine kleine Seitengasse, wo ich eine schmale Brücke überquere, die mich auf eine Straße führt, die wie eine Amsterdamer Gracht aussieht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, halte mich aber nicht unnötig mit dieser Frage auf, da ich mich noch immer nicht sicher fühle und nach wie vor glaube, hinter mir Schritte zu vernehmen. Also laufe ich weiter, überquere eine weitere Brücke, danach eine zweite, die zwischen zwei Gebäuden hindurchführt.
Just in diesem Moment biegt ein Fuhrwerk um die Ecke, gezogen von zwei prächtigen schwarzen Friesen, das sofort nach der Kurve wieder beschleunigt und sich mir daraufhin mit beachtlichem Tempo nähert.
Mir bleibt in der engen Durchfahrt keine Chance zu reagieren oder auszuweichen. Ich kann nichts mehr tun, als schockgefroren stehen zu bleiben.
Lautes Gebrüll. Erschrockenes Wiehern. Ein ohrenbetäubendes Krachen, gefolgt von mehreren dumpfen Aufschlägen. Dann schmutziges Kopfsteinpflaster. Meine Tasche, deren Inhalt sich teilweise darauf verteilt, darunter die kostbaren Äpfel, von denen einer mit einem Platsch im Fleet versinkt. Und mein Handy, das zwischen panisch aufstampfenden Pferdehufen von mir davonschlittert und unerreichbar unter dem Fuhrwerk verschwindet.
Ich denke nicht lange darüber nach, raffe hastig alles zusammen, was ich kriegen kann und stopfe es zurück in die Tasche, bevor ich weiterrenne, ohne nach links und rechts zu sehen. Nahezu blind vor Schrecken laufe ich weiter, überquere einen kleinen Platz und biege dann wahllos in irgendeine Straße ab. Von dort aus in eine andere Straße und noch um zwei weitere Ecken.
Schließlich, erst als ich ganz sicher bin, dass mich niemand mehr verfolgt, bleibe ich stehen. Keuchend lehne ich mich an eine Hauswand, halte mir meine stechenden Seiten und sehe Sterne hinter den Lidern, als ich für einen Moment die Augen schließe.
Was für ein Schlamassel! Und ich Dummkopf habe tatsächlich gestern Abend schon gedacht, in einem Alptraum zu stecken! Dabei ging es mir zu diesem Zeitpunkt noch vergleichsweise hervorragend. Abgesehen von der Beule am Kopf und dem Umstand, dass ich nicht wusste, wo ich bin, saß ich da zumindest noch sicher im Haus der Sievekings und bekam Tee und Käsebrote serviert. Was gäbe ich jetzt nicht alles für ein Käsebrot! Mir wird ganz flau bei diesem Gedanken. Ich brauche ganz dringend etwas zu essen, aber die mühsam erstandenen Äpfel habe ich vorhin alle beim Beinahe-Zusammenstoß mit den schwarzen Friesen verloren.
Seufzend öffne ich die Augen und werde mir erst jetzt meiner Umgebung bewusst. Diese ist alles andere als heimelig, um nicht zu sagen ein wenig gruselig. Ich befinde mich in einer engen, dunklen Gasse. Die heruntergekommenen, baufälligen Häuser stehen hier so dicht, dass nicht einmal die Augustsonne es schafft mit ihren Strahlen das Pflaster zu erreichen. Letzteres starrt vor Dreck, denn in der Mitte der Gasse verläuft eine Art Rinne, in der sich eine stinkende Brühe und allerhand Unrat angesammelt hat. Erst jetzt wird mir der penetrante Gestank nach verfaultem Essen, Urin und allerhand anderem Unaussprechlichem bewusst. Die feuchte, mit weißem Schimmel überzogene Ziegelwand hinter meinem Rücken tut das Ihrige, um den Gestank zu verstärken. Entsetzt rücke ich von der Wand ab und presse meine Tasche an mich, als sei sie ein Schutzschild.
Auf einmal fällt mir auf, wie still es hier ist. Viel zu still.
Ich habe das Gefühl, als würden mich aus den dunklen Fensterhöhlen rundum hundert Augen heimlich beobachten. Eine Gänsehaut überläuft mich. Ich muss hier weg. Das ist der einzige klare Gedanke, den ich zu fassen vermag. Das Problem ist jedoch, dass ich nicht mehr mit Sicherheit weiß, aus welcher Richtung ich in diese Gasse gekommen bin.
Egal, entscheide ich. Erst einmal nur raus hier. Zögernd mache ich einen Schritt vorwärts, wobei mir das leise Quietschgeräusch der Gummisohlen meiner Sneaker auf dem Pflaster unnatürlich laut in den Ohren hallt. Ganz bewusst zwinge ich mich dazu einen Fuß vor den anderen zu setzen und dabei aufrecht und selbstsicher zu gehen, in der Hoffnung, dass man mir meine Furcht dann nicht ansieht.
Trotzdem hätte ich um ein Haar laut aufgeschrien, als plötzlich eine magere Ratte vor mir durch den Unrat huscht und dann in einem dunklen Kellerloch verschwindet.
Entsetzt frage ich mich, wie arm die Menschen in diesem Viertel wohl sein mögen, wenn nicht einmal die Ratten genug zu fressen finden, um fett zu werden?
Kurz darauf erreiche ich das Ende der Gasse, nur um mich in einer weiteren wiederzufinden, die mindestens genauso verwahrlost ist wie die davor. Hier sind die Häuser teilweise sogar derart altersschwach, dass sich ihre Fassaden nach vorne einander zuneigen, als würden sie sich voreinander verbeugen. Wahrscheinlich um ein endgültiges Umkippen der Gebäude zu verhindern, spannen sich im Bereich des ersten Stockwerks in regelmäßigen Abständen dicke Balken von einer Seite der Gasse zur anderen und halten die brüchigen Fassaden auf diese Weise in Position.
Ich mache ein paar zögerliche Schritte und entdecke in einer Ecke einen Katzenkadaver im stinkenden Modder. Er liegt sichtlich nicht erst seit gestern hier und verbreitet einen widerlich süßen Gestank, der sich mit dem übrigen Mief vermischt und mich unwillkürlich würgen lässt.
Ich bin mir sicher, dass dies nicht der Weg ist, den ich gekommen bin. Aber mir fehlt der Mut, um umzukehren, war das Loch hinter mir doch auch nicht wesentlich heller als dieses hier. Also gehe ich weiter, immer vorwärts. – Und verlaufe mich heillos in einem unübersichtlichen Gewirr aus Stiegen, Gassen und Durchgängen, die teilweise so eng sind, dass ich mit meinen Schultern abwechselnd links und rechts die Mauern berühre.
Nervös blicke ich mich immer wieder um. Ich werde das Gefühl nicht los beobachtet und verfolgt zu werden. Gleichzeitig beunruhigt es mich, dass mir überhaupt niemand begegnet, während ich durch dieses Labyrinth irre. Es ist, als wäre ich völlig alleine hier. Aber der Schein trügt. Ich glaube zu wissen, dass sich hinter den windschiefen Mauern und undichten Fenstern Menschen aufhalten. Menschen, die mich im Auge behalten, die den Atem anhalten und miteinander flüstern, wenn ich vorbeigehe.
Ich verspüre einen dicker und dicker werdenden Kloß im Hals, je mehr das Grauen von mir Besitz ergreift, gleichzeitig ist mir eiskalt, sodass ich meine Tasche noch fester an mich presse, um mich zu wärmen.
Und dann sind sie plötzlich da. Fünf abgerissene Gestalten in nachlässig geflickten Kleidern. Halbwüchsige Jungs noch, aber mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Wer in dieser Umgebung aufwächst, der hat gelernt zu überleben, soviel ist klar. Sie stehen auf einmal da, wie aus dem Nichts aufgetaucht. Vor mir und hinter mir, jeweils am Ende eines grob gezimmerten Stegs, der über ein besonders morastiges Stück Gosse führt. Ich werde eingekreist von schmutzigen Gesichtern, die siegessicher grinsen und deren genaue Zahl ich in meiner plötzlichen Panik noch nicht einmal exakt zu bestimmen vermag. Das Einzige was sicher ist, ist die Gewissheit, dass sie überall um mich herum stehen und dass es daher keinen Ausweg für mich gibt. Ich fühle mein Herz in die Hose rutschen, denn sie sind jeder einzelne für sich, entweder erstaunlich kräftig oder aber drahtig und daher bestimmt wieselflink. In jedem Fall aber sind sie in der Überzahl und mir allein schon deswegen haushoch überlegen.
Eine halbe Ewigkeit wie mir scheint, sehen sie mich nur schweigend an, entblößen bloß ihre sichtlich ungepflegten Zähne und kosten den Moment der Macht aus, die sie in diesem Augenblick zweifellos über mich haben. Bis es dem Kräftigsten und Längsten von ihnen irgendwann reicht.
„Gib her“, sagt er auf Platt.
Wider besseres Wissen stelle ich mich dumm. „Was?“, piepse ich.
„Die Tasche“, antwortet er geduldig.
Intuitiv drücke ich die Tasche fester an mich, schließlich enthält sie alles, was ich noch habe.
Aber diese Geste macht ihn nur entschlossener. „Die Tasche“, wiederholt er, diesmal mit Nachdruck, und unverhohlene Habgier leuchtet in seinem Blick auf.
Als ich mich nicht rühre, starr vor Schreck, kommt er auf mich zu. Ganz ruhig, denn er weiß, dass ich keine Chance habe zu gewinnen. Langsam, fast in Zeitlupe greift er nach den Griffen der Tasche und zieht sie mir entspannt aus den verschränkten Armen. Ich will protestieren, um Hilfe schreien, aber aus meiner Kehle kommt bloß ein klägliches Krächzen.
Einen Wimpernschlag später sind sie dann auch schon wieder weg. Genauso geisterhaft verschwunden wie sie gekommen sind. Wäre ich nicht um das Gewicht der Tasche erleichtert, würde ich nicht glauben, dass sie überhaupt da gewesen sind.
Ein Schluchzen löst sich aus meiner Kehle. Dann endlich habe ich wieder die Gewalt über meine Stimmbänder und schreie so laut wie ich kann um Hilfe: „Diebe! Diebe! Haltet sie! Polizei!“ Dabei renne ich in die Richtung los, von der ich glaube, dass die Jungs dorthin verschwunden sind und versuche ihre Fährte aufzunehmen, meiner kostbaren Tasche hinterher. Aber natürlich habe ich keine Chance.
Die Burschen kennen sich im Viertel aus und kennen gewiss jeden Winkel, in dem man sich verstecken kann. Während ich noch immer wild schreiend durch die engen Gassen laufe, sitzt die Bande bestimmt schon längst in einem der umliegenden zahllosen Behausungen und lacht sich ins Fäustchen.
Den übrigen Bewohnern des Viertels scheint das ohnehin klar zu sein, denn die wenigen, denen ich auf der Straße begegne, schütteln nur den Kopf über mich oder blaffen mich sogar an, ich solle gefälligst mit der Schreierei aufhören.
Also gebe ich die Hoffnung darauf, meine Tasche – oder vielleicht zumindest ein wenig Freundlichkeit – zu finden irgendwann auf und renne danach reichlich kopflos durch diese düstere Welt, aus der es aber kein Entrinnen zu geben scheint. Wieder biege ich um düstere Ecken, hetze Treppen hinauf, laufe über Galerien, auf denen Wäsche zum Trocknen hängt und steige die Stufen am Ende wieder hinab. Nimmt das denn nie ein Ende?
Als ich an einem schmalen Torbogen vorbeikomme, schnellt plötzlich eine schwielige Hand daraus hervor und packt mich. Noch ehe ich begreifen kann, was mir geschieht, komme ich abrupt zum Stehen, werde rückwärts in den engen Durchgang geschleudert und pralle dort gegen eine breite Brust. Sekundenbruchteile später fühle ich ein Messer an meiner Kehle und zwei Arme die mich festhalten wie ein Schraubstock.
Ein Wimmern entfährt mir. Soll ich nun nach meiner Habe auch noch mein Leben verlieren?
„Was haben wir denn da für ein Bürschchen? Du bist jedenfalls nicht von hier“, flüstert eine heisere Stimme an meinem Ohr. Der Atem des Mannes stinkt nach billigem Fusel und lässt mich unwillkürlich würgen.
Die Klinge des Messers drückt sich noch etwas fester an meine Kehle, während der Typ mich mit der anderen Hand nach Geld oder anderen Wertgegenständen abtastet. Schnell stellt er fest, dass er zu spät kommt. Ich bin bereits ausgeraubt worden. Unwillig grunzend wandert seine Hand nochmals auf und ab, findet schließlich meine Brust. „Heheee, Bürschchen, bist ja gar keins!“, stellt er fest und drückt meinen Busen, dass es weh tut. „Na schön. Wenn du schon nichts hast, was man zu Geld machen kann, dann kannst du ja wenigstens auf andere Weise bezahlen“, kichert er leise.
Mir läuft ein eiskalter Schauer über. Erneut wird mir schlecht, aber ich zwinge den Würgereflex hastig hinunter und konzentriere mich stattdessen darauf, meinen Verstand einzuschalten. Fieberhaft überlege ich, was ich mal im Selbstverteidigungskurs gelernt habe. Immerhin habe ich es jetzt ja nur mit einem Gegner zu tun, anstatt wie vorhin mit gefühlten zehn. Also wie war das? Den Angreifer möglichst fest auf die Zehen treten und mit dem Hinterkopf nach hinten schlagen, war es so? Darüber, was man mit weichen Gummisohlen gegen derbe Lederstiefel ausrichten kann, wenn einem noch dazu ein Messer an der Kehle sitzt, haben wir meines Wissens nach aber nie gesprochen… Was also, soll ich jetzt machen?!
Vor meinem inneren Auge sehe ich mich bereits geschändet und mit aufgeschlitzter Kehle in dieser dreckigen Gasse enden, wo mich dann irgendwer finden und dafür sorgen wird, dass meine Leiche irgendwo anonym verscharrt wird. Niemand wird nach mir suchen, niemand wird mich vermissen, denn ich befinde mich in einer Zeit, in der es mich überhaupt gar nicht gibt. Also wird es wahrscheinlich noch nicht einmal eine polizeiliche Untersuchung geben und ich einfach spurlos vom Erdboden verschwinden. Falls denn in diesem finsteren Mittelalter überhaupt eine Polizei existiert?!
Ich fühle Tränen der Hilflosigkeit und der Verzweiflung in mir aufsteigen, als plötzlich ein Schatten den Ausgang aus der Nische zur Gasse verdunkelt. Gleichzeitig vernehme ich ein leises Klicken und dann eine bekannte tiefe Stimme, die vollkommen ruhig meint: „Ich störe Ihr kleines Stelldichein ja nur ungern, aber diese Dame gehört zu meinem Hausstand. Daher wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie von ihr ablassen würden.“
Augenblicklich löst mein Angreifer seine Umklammerung und nimmt das Messer von meinem Hals.
„Falls es tatsächlich hier etwas zu bezahlen geben sollte, schicken Sie doch bitte eine Rechnung an meine Adresse“, fährt Henry Sieveking ungerührt fort, selbst in dieser absurden Situation korrekt bis zum Geht-nicht-mehr, wie es wohl seine Art zu sein scheint.
Als ich mich vorsichtig umdrehe, erkenne ich im Dämmerlicht der Gasse zwar nicht sein Gesicht, sehe aber, dass er meinem Angreifer mit entschlossener Haltung eine Pistole an die Schläfe hält. Mir entfährt ein erleichterter Seufzer.
„Oh. Nein, nein, nein“, wehrt der Typ ab, der mich überfallen hat und zieht den Kopf ein. „Nichts zu bezahlen. Ein Missverständnis. Alles nur ein Missverständnis.“ Er hebt abwehrend die Hände. Während er spricht, bewegt er sich mehr und mehr auf den Torbogen zu.
Ich drücke mich an die Wand und mache ihm bereitwillig Platz. Auf keinen Fall möchte ich nochmals mit ihm in Berührung kommen.
Auch Herr Sieveking scheint keine große Lust zu verspüren, sich mit diesem Widerling noch weiter auseinanderzusetzen, denn er lässt es zu, dass der Kerl schließlich den Ausgang zur Gasse erreicht und sich gleich darauf unter der Pistole wegduckt, um dann blitzschnell um die Ecke zu verschwinden.
Nur wenige Sekunden danach ist bloß noch das Geräusch sich hastig entfernender Schritte zu hören. Dann ist es wieder totenstill bis auf das Greinen eines Säuglings, irgendwo weit entfernt, tief in den Eingeweiden des düsteren Gassenlabyrinths.
Herr Sieveking sichert wortlos die Pistole, ein schweres Ding aus blank poliertem Metall und mit einem elegant geschwungenen Holzgriff. Er steckt sie jedoch nicht weg, sondern behält sie in seiner Rechten, jederzeit bereit uns damit gegen weitere mögliche Angreifer zu verteidigen.
Ich stoße einen erneuten Seufzer der Erleichterung aus. Niemals hätte ich gedacht, dass mich der Anblick des grimmigen Henry einmal mit einer solchen Freude erfüllen würde, noch dazu, wenn er dabei eine geladene Waffe in der Hand hält.
Umgekehrt scheint die Begeisterung allerdings nicht ganz so groß zu sein. Er schenkt mir einen Blick, wie er finsterer wohl nicht sein kann und der sämtliche Dankesworte, die in mir aufsteigen mögen, in meiner Kehle steckenbleiben lässt. Aber das macht mir im Moment nicht allzuviel aus. Dieser Gesichtsausdruck ist doch immer noch um Längen weniger schrecklich als alles, was mir in den letzten Stunden passiert ist.
Stumm rückt er seinen Zylinder gerade – also besitzt auch er einen, natürlich – und zupft seinen Gehrock zurecht, unter dessen Aufschlägen er die Waffe zu verbergen sucht. Mit der anderen Hand ergreift er dann weiterhin schweigend die meine und zieht mich zum entgegengesetzten Ende der Gasse, fort vom Torbogen, durch den mein Angreifer verschwunden ist.
Ich folge ihm nur allzu gern, bin ich mir doch völlig darüber im Klaren, dass meine Chancen hier einigermaßen unbeschadet wieder herauszukommen, in seiner Begleitung wesentlich höher sind, als allein auf mich gestellt.
Wir erreichen eine neue, ähnliche Gasse, wie all die hunderte, durch die ich zuvor gekommen bin, und er zieht mich nach links.
Vertrauensvoll wie ein Kind gehe ich ihm hinterher und genieße insgeheim die beruhigende Wärme seiner Hand, die die meine umschließt und mir somit die einzige warme Stelle an meinem Körper verschafft, denn obwohl es eigentlich sommerlich warm sein müsste, glaube ich um mich herum auch weiterhin nichts als sibirische Kälte zu fühlen. Ich vermute, es handelt sich dabei um die Folgen des soeben erlittenen Schocks.
Auf dem Weg durch die engen, sich windenden und in ihrer Trostlosigkeit überall gleich aussehenden Gassen, wechseln wir kein Wort. Ich wage es nicht, ihn anzusprechen und in seiner Wachsamkeit und offensichtlichen Konzentration zu stören. An der nächsten Abzweigung hält er kurz inne, als müsse er überlegen, wo es langgeht. Dann wendet er sich entschlossen wieder in eine bestimmte Gasse und führt mich den Weg hinab. Er scheint die ganze Zeit hindurch eine grobe Orientierung zu haben, auch wenn er das Gebiet offensichtlich nicht unbedingt wie seine eigene Westentasche kennt. Zumindest habe ich aber den Eindruck, dass er die Richtung weiß, in die er will. Auf diese Weise geleitet er mich durch das Labyrinth des Gängeviertels, und ich folge ihm widerstandslos durch das dunkle Gewirr. Und tatsächlich, nach und nach werden die Gassen, die wir durchschreiten breiter, verdienen irgendwann sogar die Bezeichnung Straße wieder, obwohl sich der desaströse Zustand der Häuser nur geringfügig bessert. Schließlich steckt er die Pistole weg, was ich als gutes Zeichen werte.
Schon bald kann ich in der Ferne wieder Möwengeschrei vernehmen und mir wird auf einmal klar, dass er sich die ganze Zeit über zum Hafen hin orientiert hat. Mit jedem Schritt erahne ich jetzt mehr und mehr die Geräusche des Hafens. Zwei weitere Straßenecken noch, dann treten wir plötzlich aus dem Dämmerlicht der düsteren Gassen hinaus auf die sonnendurchfluteten Kaianlagen. „Die Sonne! Ach wie schön!“, bricht es – zugegebenermaßen etwas melodramatisch – aus mir heraus.
Dann wird mir schlagartig bewusst, wie heiß diese Sonne ist. Wie sehr sie mir auf den Schädel brennt und die Beule unter der Mütze wieder zum Pochen bringt. Hinzu kommen der Hunger und die gerade eben erst überwundenen Schrecken und Anstrengungen. Sie alle tun ihren Teil dazu, dass sich plötzlich alles um mich herum zu drehen beginnt und mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Meine Knie werden weich, ich sinke zu Boden und sehe schon das Kopfsteinpflaster auf mich zurasen.
Kurz bevor ich aufschlage, spüre ich jedoch noch, wie die Arme Sievekings geistesgegenwärtig hervorschnellen und mich auffangen.