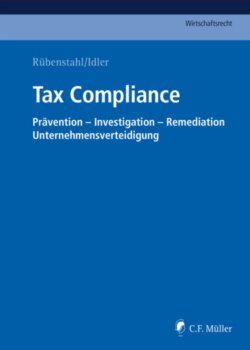Читать книгу Tax Compliance - Markus Brinkmann - Страница 14
b) Ursprung und Einordnung des Compliance-Begriffs
Оглавление4
Als Fachbegriff tauchte Compliance ursprünglich in der Medizin auf; in dieser Disziplin beschreibt der Begriff das therapiegerechte Verhalten von Patienten.[5] In der Pharmakologie und im Gesundheitssektor wird heute noch mit Compliance die Befolgung von Einnahme- und Dosierungsempfehlungen bestimmter Medikamente verbunden.[6]
5
Erst mit der US-Exportkontrollgesetzgebung während des Kalten Krieges, im Rahmen derer Compliance als Einhaltung von gesetzlichen Ausfuhrvorgaben gesehen wurde, erlangte der Begriff auch eine rechtswissenschaftliche Bedeutung, wenngleich sich das damalige Verständnis von Compliance – wie nachstehend noch ausgeführt wird – nicht mit dem heutigen Begriffsverständnis deckt, da lediglich die korrekte Bearbeitung von Formularen im Vordergrund stand.
6
Ein weiterer juristischer Hintergrund für den Compliance-Begriff nach heutigem Verständnis wird vielfach auch in den angloamerikanischen Regulierungsansätzen im Finanzdienstleistungssektor Ende der 1980er Jahre gesehen. Schon im Jahr 1960 kristallisierten sich Anforderungen zu einer strafrechtlichen Compliance durch die Verfolgung von wettbewerbsrechtlichen Straftaten (im konkreten Fall Preisabsprachen durch amerikanische Unternehmen der Elektroindustrie) heraus.[7] Als Ausfluss aus der Regulierung von Banken und Wertpapierdienstleistungsunternehmen umfasste der Begriff der Compliance dann später alle Maßnahmen, die der Sicherstellung gesetzeskonformen Manager- und Mitarbeiterverhaltens in den klassischen Risikobereichen der Kreditinstitute dienen.
7
Im Zusammenhang mit großen Wirtschaftsstrafverfahren in den USA (insbesondere im Anwendungsbereich des Foreign Corrupt Practices Act – also der Korruptionsbekämpfung) sowie durch Zusammenbrüche von US-amerikanischen Unternehmen gewann der juristische Compliance-Begriff zusätzlich an Bedeutung. Nachdem zunächst Energie-, Telekommunikations- und Mischkonzerne wie ENRON, WorldCom und Tyco in den USA durch ihre Skandale eine Vertrauenskrise am Kapitalmarkt ausgelöst hatten, förderten später auch in Deutschland zahlreiche Insolvenz- und Haftungsfälle das Bewusstsein für die Bedeutung eines „Compliance-Regimes“.
8
Die regulatorischen Maßnahmen gegen Insiderhandel, Korruption und Geldwäsche sowie die Reaktionen des US-amerikanischen Gesetzgebers auf die massiven Rechtsverstöße in der Banken- und Finanzwelt und das dadurch entstandene Bewusstsein für eine Vermeidung strafrechtlicher Sanktionen durch Präventionsmaßnahmen werden somit als Ursprung der juristischen Compliance angesehen.[8] Auch wenn anfänglich mit der Verwendung des Begriffs Compliance (nur) ein systematisches Konzept zur Kontrolle des regelkonformen Verhaltens der Banken bezeichnet wurde,[9] so sind entsprechende Rahmenbedingungen inzwischen von allen Unternehmen zu beachten,[10] sodass der Begriff nun auch über den Finanzdienstleistungssektor hinaus Anwendung findet.
9
Ein eigener deutscher Begriff hat sich bislang nicht herausgebildet, stattdessen wurde hierzulande im Zusammenhang mit der vorstehend skizzierten Entwicklung auf das englische Wort Compliance zurückgegriffen. Bei dem Begriff Compliance handelt es sich insofern um einen Rechtsimport, einen sog. Legal Transplant aus den USA. Weil es an einem deutschen Begriff für Compliance fehlt,[11] stellt jede Übersetzung nur eine Annäherung an den Wortsinn im juristischen Kontext dar. In diesem Sinne werden die voranstehenden, allgemeinen Übersetzungen im rechtlichen Zusammenhang dahingehend konkretisiert, dass unter dem Begriff Compliance in der Rechtssprache die Einhaltung von Rechtsvorschriften zu verstehen ist.[12] In dieser Weise wird verschiedentlich in den Wörterbüchern dann zwischen dem Oberbegriff Compliance an sich und „Legal Compliance“ differenziert, welche sich auf die Befolgung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie rechtlicher Bestimmungen bezieht.[13]
10
Die vielen Definitionsansätze, die sich seit erstmaligem Auftreten des Begriffes in der deutschen Rechtssprache herausgebildet haben, sind zuletzt noch einmal erweitert worden. Es zeigte sich, dass die allgemeine Definition von Compliance als „Handeln in Übereinstimmung mit bestimmten bestehenden Regeln“ der (gewandelten) Begriffsbedeutung nicht mehr gerecht wird.[14] Inzwischen wird Compliance nicht mehr nur als Gesetzestreue an sich begriffen, sondern als die in einem Unternehmen strategisch gewollte und durchgeführte Gesetzesbefolgung verstanden, verbunden mit einem Sicherungssystem, das vor Gesetzesverstößen schützen soll.[15]
11
Somit fällt nicht mehr nur die Einhaltung von Gesetzesvorschriften, sondern auch die Befolgung der unternehmensinternen Regeln unter diesen Begriff.[16] Betont wird inzwischen das Erfordernis der rechtlich ordnungsgemäßen, systematischen Organisation eines Unternehmens mit dem Ziel, eine zivilrechtliche Haftung oder sogar strafrechtliche Sanktionierung des Unternehmens und seiner Organe zu vermeiden.[17] Als ein Teilgebiet eines solchen Compliance-Systems wird beispielsweise die wirksame Korruptionsbekämpfung verbunden mit einer entsprechenden unternehmensinternen Selbstkontrolle genannt.[18]
12
Aufgrund des voranstehend skizzierten unternehmens-organisatorischen Bezugs wird verschiedentlich die Frage aufgeworfen, welchem Fachgebiet die „Legal Compliance“ zuzuordnen ist (vgl. insofern bereits die verschiedenen Definitionsansätze zum Ursprungs des Compliance-Begriffes). Eine Zuordnung zu den Rechtswissenschaften erscheint schon deswegen naheliegend, da das Compliance-System einerseits die Einhaltung von Regeln und Gesetzen zum Ziel hat[19] und anderseits die Einrichtung eines solchen Systems inzwischen selbst als von den Unternehmen zu beachtende Rechtspflicht begriffen wird.[20] Denkbar wäre jedoch auch eine Zuordnung zur Betriebswirtschaftslehre, weil zu einem Compliance-System auch immer die Einführung von unternehmensinternen Prüfungs- und Freigabeprozessen sowie die Einrichtung entsprechender Kontrollmechanismen gehören[21] und damit Fragen der Steuerung und Ausgestaltung betrieblicher Organisationsprozesse verbunden sind, mithin also die Teildisziplin der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre betroffen ist. Als dritte Möglichkeit ließe sich die Compliance der Wirtschaftsethik zuordnen, immerhin wird sich im Rahmen dieses interdisziplinären Diskurses die Frage gestellt, wie ein arbeitsteilig organisiertes und auf Gewinn angelegtes Unternehmen verantwortungsvoll[22] und nachhaltig arbeiten kann.[23]
13
Letztlich ist eine Zuordnung nur zu einem Fachgebiet aufgrund der Überschneidungen nicht möglich. Zwar darf nicht verkannt werden, dass die Compliance-Tätigkeit juristische Kenntnisse erfordert, weil nur derjenige über Rechtspflichten, gesetzliche Gebote sowie Verbote informieren und deren Einhaltung überwachen kann, der über entsprechende Rechtskenntnisse verfügt.[24] Es darf aber ebenso wenig außer Acht gelassen werden, dass in der Unternehmenspraxis die organisatorische Umsetzung der strategisch gewollten, systematischen Gesetzesbefolgung die ungleich größere Herausforderung ist.
14
Daher beschränken sich die Darstellungen des vorliegenden Handbuchs auch nicht auf die bloße Beschreibung rechtlicher Anforderungen und die Untersuchung einzelner rechtlicher Risikofelder. Vielmehr werden an passender Stelle immer auch Hinweise zu geeigneten Organisationsmaßnahmen zur Bewältigung der dargestellten Risiken gegeben.