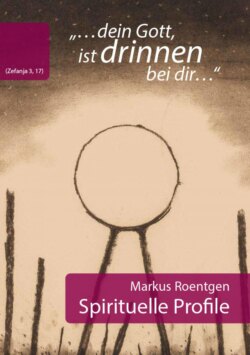Читать книгу "dein Gott, ist drinnen bei dir" (Zefanja 3,17) Spirituelle Profile - Markus Roentgen - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеP. Thomas von Aquino Op „Thomas a Creatore“
(Thomas von Gott dem Schöpfer)
der „doctor angelicus als doctor communis“oder
„der stumme Ochse hat gebrüllt – und geschwiegen“
Leben
Um 1225 wird Thomas von Aquin auf dem Schloss Roccasecca im Neapolitanischen geboren, gleichsam zwischen den Todesjahren des heiligen Dominikus (1221) und des heiligen Franziskus (1226), den beiden Begründern der für die Kirche so wesentlichen Reformbewegungen der Bettelorden (der spirituellen Armutsbewegung des Mittelalters im Gefolge des armen Jesus). Bis 1239 lebt er in der Benediktinerabtei Monte Cassino, dann Universität Neapel (dort Studien über Aristoteles und den Araber Averroes). 1244 Eintritt in den Dominikanerorden („Mendikanten“ – Bettelorden). Seine standesbewusste Familie lässt ihn von seinen Brüdern auf dem Weg nach Paris überfallen, setzt ihn gefangen unter Hausarrest für ein Jahr in San Giovanni. Er beharrt auf seiner Entscheidung, ein Bettelmönch zu sein. Nach der Freilassung geht er nach Paris, um bei Albertus Magnus zu studieren. Ihn begleitet er auch 1248 nach Köln, im Jahr der Grundsteinlegung des Kölner Domes! Dort Generalstudium seines Ordens unter Alberts Leitung. Dieser entdeckt seine große Begabung. Thomas galt während des Studiums als großer Schweiger. Seine Mitstudenten nannten ihn, der auch von enormer Leibesfülle war, deshalb im Spott den „stummen Ochsen“. Albertus Magnus jedoch erkannte bald die hinter dem Schweigen wartende Geistesgröße. Von ihm ist der Ausspruch über Thomas aus der Kölner Zeit zu den Studierenden überliefert: „ Ihr nennt ihn den ‚stummen Ochsen’, ich aber sage euch, das Brüllen dieses ‚stummen Ochsen’ wird so laut werden, dass es die ganze Welt erfüllt.“ (Vgl. Chesterton, S. 48). 1252 geht Thomas nach Paris zurück Er beginnt seine akademische Laufbahn im Dominikanerorden. Dies geschieht zugleich mit dem Franziskaner Bonaventura. Zwischen Paris, Italien, dem päpstlichen Hof, Rom, Viterbo und Paris pendelt dieser in jeder Hinsicht gewichtige Mensch ab 1259, um ein philosophisches und theologisches Werk ohnegleichen auszuarbeiten, immer in der Vitalität der „disputatio“ (der lebendig entwickelten Lehre zwischen Lehrern und Schülern) in der besten Dynamik scholastischen Geistes! Von seinen Werken seien nur benannt: „Über das Dasein und das Wesen“ (1254-1256); „Über die Wahrheit“ (1256-1259); „Summe wider die Heiden“ (1259-1264), sein Meisterwerk, die unabgeschlossene „Theologische Summe“ – „Summa theologiae“, ein enorm umfängliches dreiteiliges Werk, deren erster Teil („prima pars“) zur Gottes- und Trinitätslehre verfasst ist, der zweite Teil eine Handlungstheorie als theologische Ethik enthält, und dessen dritter in die Christologie und Sakramentenlehre einführt (1266-1273), das „Kompendium der Theologie“ (1272-1273), dazu wesentliche Kommentare zu Aristoteles und biblischen Büchern, besonders zu Jesaja, Jeremias, zum Johannesevangelium, zu den Paulusbriefen, worin der Kommentar zum Römerbrief eine ganz besonders hohe Güte besitzt! Seine Spiritualität spiegelt sich auch in geistlicher Dichtung, die bis heute ihn allgemein in der Kirche bekannt sein lässt, vor allem in seinen Liedern zum Fronleichnamsfest zum Geheimnis der Eucharistie: „Pange, lingua“ (NGl 494) „Lauda Sion Salvatorem“ (NGl 497) und „Adore te devote“ (Gottheit tief verborgen) (Gl 546).
1272 geht Thomas nach Neapel. Berufen zum 2. Konzil von Lyon (1274) und unterwegs dorthin bereitet er sich in Fossa nuova zum Sterben. Er lässt sich nur noch aus dem „Hohen Lied – dem Lied der Lieder“ vorlesen. Am 7. März 1274 stirbt er dort. Wurde noch 1277 sein Denken durch den Bischof von Paris verurteilt, so sprach ihn die Kirche 1323 heilig. Seit 1567 ist er zum Kirchenlehrer erhoben worden.
Chesterton schreibt über ihn: „St. Thomas wirkte wie ein sehr großer, schwerer Bulle, mächtig, langsam und ruhig, sehr mild und großmütig, aber nicht sehr umgänglich; abgesehen von der Demut der Heiligkeit, war er von Natur aus scheu und geistesabwesend, auch außerhalb seiner gelegentlichen und sorgfältig verborgenen Erlebnisse mystischen Entrücktseins.“31.
31 Chesterton, S. 12.
Philosophie, Theologie und Spiritualität
Thomas von Aquin versöhnt das Denken des Aristoteles mit dem Christus des Glaubens. Er gibt, ähnlich wie Franziskus und doch in der Art ganz anders, der Kirche, der Theologie und dem Glauben der Menschen in neuer Leuchte das Geheimnis der Menschwerdung Gottes zurück und schenkt der Erde somit ihre tiefste Gottverbundenheit in Art und Weise seines Denkens wieder. Er bewahrt dabei das theologische Denken vor jeglichem platonischen Hochmut, der mitunter bis in unsere Tage grassiert, denn er fundiert alles Gedachte in den Konkretionen, in der Materie, im Leib, in der Erde. Keine Idee ist bei ihm rein und ewig überzeitlich einfach da! Nein, die Sinne und das Sinnfällige sind ihm Fenster der Seele und aller Geist ist eingewoben in Materie, Geschichte, Zeit! Thomas bestand darauf, dass Gott und das Ebenbild Gottes, der Mensch, sich durch die Materie mit einer konkreten Welt verbunden hat.
Er schreibt: „Das Wort Gottes hat Leib und Seele miteinander vereint angenommen. So hat diese Annahme Gott zum Menschen und den Menschen zu Gott gemacht. (…) Ich kann sagen: beides, Gott und Mensch, sei Gott – wegen des annehmenden Gottes; und beides, Gott und Mensch, sei Mensch – wegen des angenommenen Menschen.“32
32 Summa III, 50,4 ad 1; Summa III, 17, 1 ad 1; zitiert auf Deutsch nach Thomas, Sentenzen, S. 284f.
So hat Thomas der Kirche und der Theologie die volle Bejahung unseres Leibes, unseres Fleisches, ja der gesamten Materie zurück gegeben, welches gipfelt im wunderbarsten Glaubensgeheimnis der Kirche: im Dogma von der Auferstehung des Fleisches als Hoffnung der vollen und vollendeten Wiederherstellung des Entstellten und Sterblichen und Toten bis hinunter ins Anorganische.
Kein Wunder, dass seine großen Dichtungen und Lieder deshalb auch der Eucharistie, also Gott in den Gestalten von Brot und Wein und, im Geheimnis der Fußwaschung Jesu Christi, Gott in Antlitz und Gestalt jedes konkreten Menschen im Geflecht von Ich-Du-Wir, gewidmet sind. Darin feiert der Denker den Glauben des Christen, der im Tiefsten darin gründet, dass Gott in seiner unfasslichen Heiligkeit sich mit der Materie, mit der Körperlichkeit, mit der Leiblichkeit allen Seins verbunden hat und in die Welt der Sinne wirklich eingetreten ist.
Im Denken des Thomas von Aquin wird das Leben voll bejaht! Die damit einhergehende Bejahung der Materie ist darin kein neuzeitlicher Materialismus, welcher alles Sein auflöst in zufällige Bestandteile, Elementarteilchen, chemische Partikel des Seienden. Sein in der Materie gründendes Denken ist demütiges Denken „a Creatore“, eine Bejahung also des Leiblichen, des Körpers im Sinne der tiefen Bedeutung der Erschaffung des Leibes und alles dessen, was ist, rückgebunden an den Schöpfer, den Thomas schön beim ureigenen Namen nennt, der da heißt: „Ich-Bin“33 (vgl. Ex 3, 14)
33 Vgl. Chesterton, S. 85.
Sein Denken hat das Ziel, der Vernunft so weit zu folgen wie sie reicht und ihre Grenzen darin zu bestimmen. Er folgt darin dem Grundsatz, der sehr zeitgemäß uns erscheint: „Alles, was der Intellekt enthält, ist zunächst in den Sinnen gewesen.“ (Vgl. Chesterton, S. 116). Unsere fünf Sinne sind also die Fenster zu Welt und selbst. Und nun beginnt er, bei der Frage nach G O T T, seiner zentralen Erkenntnis leitenden Frage, die als „erste ins Reine zu bringen sei“ (Vgl. den Eingang seiner „Summe“), nicht mit der Idee Gottes, vielmehr fragt er gleichsam kinderschwer nach elementaren Erkenntnissen, die bereits das Kind, vorphilosophisch, weiß, auf die sich weiteres Denken wirklich gründen kann.
Und nun kommt etwas, was dem Alltagsverstand des Menschen lächerlich banal erscheinen wird, was jedoch der philosophischen Disziplin bis heute nachhaltigstes Grübeln verursacht. Sind unsere Sinnenerkenntnisse und die daraus abgeleiteten Worte und Sätze überhaupt solche über Wirkliches und Wirklichkeit – oder sind sie Einbildung und Schein, Trugbild, Selbstspiegelung, Sprachspiel, gesellschaftlicher Kompromiss, Konvention etc.?
Thomas insistiert darauf, dass das elementare Wirklichkeitswissen bereits des Kleinkindes, vor aller Bezeichnung, vor aller erlernten Benennung, ist, dass
etwas ist.
„Da!“ ruft das Kind, und kann es nicht sprechen, greift es nach „Da!“ Kann es nicht sehen, fühlt es „Da!“ Kann es nicht hören, sieht es „Da!“ – Sind alle Sinne beschädigt, und es lebt doch, fühlt es den Herzschlag und das Atmen „Da!“
Der befreiende Ausgang dieses Denkens ist so schlichtwunderbar: „Es ist ein ist!“34
34 Vgl. Chesterton, S. 120.
Alles Weitere baut sich von hier auf – an dieser seiner Zweifelsfreiheit am Dasein des Seins selbst! Und selbst alle Auflösungen von Statischem ins Werden (etwa wie das Wasser ins Fließen, ins Kalte und Warme und Gasförmige etc.) sind stets nur eine Seinsprägung in unserer beschränkten Wahrnehmung, welche die Fülle und das Gesamt des Seins niemals sinnlich fassen kann, jedoch vom ist des „etwas ist und nicht vielmehr nichts“ mit Vernunftgrund darauf schließen kann, dass die Fülle und das Gesamt des Seins alles in sich ist und enthält, was sein kann!
Hieraus erwächst ein erstaunlicher Optimismus im Blick auf alles, was ist. Mit Augustinus, dem er ansonsten auch oft widerspricht, denkt er: „Sofern etwas ist, ist es gut!“ (Augustinus, Confessiones VII, 3, 4). Dies knüpft an den wunderbaren Satz der Heiligen Schrift, aus dem Buch der Weisheit 11, 24: „Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von alledem, was du gemacht hast; denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen…Gott, Du Freund des Lebens.“ So ist er mit jedem Hälmchen Gras mit dem verbunden, den er Gott nennt. Denn alles was ist, sofern es ist, führt er zurück und hin zu Ausgang und Ziel, Anfang im Ende und Ende im Anfang, worin volle Möglichkeit zugleich Fülle des Seins selbst ist, ohne das Vorhandene in Geschaffenem, in wirklicher Unterschiedenheit, Freiheit, Geschichte und Zeit darin zu leugnen. Nichts verliert jedoch je die Beziehung und den Zusammenhang zum alles in allem und allen bewegenden Ausgangspunkt: „Alles, was ist, und sei es auf welche Weise auch immer – sofern es seiend ist, ist es gut.“ 35
35 Summa contra Gentes 3, 7.
Daraus folgt dann auch der unbedingte Vorrang des Guten vor dem Bösen: „Gutes ohne Böses kann es geben; Böses aber ohne Gutes kann es nicht geben.“36
36 Summa I, 109, 1 ad 1
Im Jahr 1259, also genau vor 750 Jahren, beginnt Thomas von Aquin in Italien seine Römerbriefstudien und seine Vorlesungen über diesen zentralen Brief des Apostels Paulus, der bis heute eine große Wirkung ausstrahlt. 1272, kurz vor seinem Tod, nimmt er sich den Römerbrief ein zweites Mal vor. Darin denkt er, im Meditieren des 1. Römerbriefkapitels, in dem Paulus von der Erkennbarkeit Gottes in und aus der Schöpfung schreibt, dass es die größte Gnade des Menschen ist, nicht von anderen her (als gestützt im blinden Vertrauen auf übergeordnete Autoritäten), sondern aus sich selbst heraus das Gute zu vollbringen.
Über den Glauben heißt es bei ihm, dass er durch die Liebe gewirkt wirkt und durch sie, die Liebe, zur Relevanz in den Früchten tätigen Lebens gelangt. Bei Thomas heißt dies im Lateinischen: „Fides quae per caritatem operatur.“37
37 Vgl. Klein, S. 268.
Aber in alledem bleibt auch das ungleich größere Meer des Unsagbaren und Unsäglichen, welches Pater Karl Rahner SJ später das „heilige Geheimnis, das letzte Wort vor dem Verstummen“ nennen wird, das nicht anders und immer noch nicht besser als „Gott“ genannt werden kann.38
38 Vgl. Karl Rahner, Meditation über das Wort „Gott“ : H. J. Schultz, Wer ist das eigentlich – Gott?. München 1969, S. 13 ff.
Pater Wilhelm Klein SJ schreibt: „zu Thomas dem großen Wissenschaftler gehört Thomas der Christ, der die ganze Bedingtheit und Relativität seines Sprechens und Schreibens erfasst und versteht und der in diesem Scheitern alles Wissens das Gesetz des Sterbens und im Sieg alles Glaubens das Gesetz des Lebens im sterbenden Gottmenschen sieht.“39
39 Vgl. Klein, S. 269.
Zu Thomas zentralen Erkenntnissen gehört, in aller Größe des Geschauten und Gedachten, in aller fundierenden Gotteserkenntnis aus dem Fundament der Seinserkenntnis, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts, dennoch die größere Unsagbarkeit und Unerkennbarkeit Gottes im Verhältnis zur Sagbarkeit und Erkennbarkeit. Wer hätte tiefer und klarer mittels des Denkens und mittels der Verstandesmöglichkeiten versucht, die Gottesfrage ins Reine zu bringen. Und doch, und gerade darin dies, wenn Thomas schreibt: „Bei der Betrachtung der Wirklichkeit Gottes ist aber vornehmlich der Weg der Verneinung zu beschreiten. Denn die Wirklichkeit Gottes übersteigt jede Form, die unser Verstand erreicht, durch ihre Unermesslichkeit, und so können wir nicht begreifen, was sie ist. Wir haben jedoch irgendeine Kenntnis von ihr, indem wir erkennen, was sie nicht ist. Und umso mehr nähern wir uns der Kenntnis von ihm, je mehr wir durch unsern Verstand von ihm verneinen. – Einzig dann erkennen wir Gott in Wahrheit, wenn wir glauben, dass er über alles hinausliegt, was Menschen über Gott zu denken vermögen.“40
40 Vgl. Zitat bei Jorissen.
„Diese ist das Äußerste menschlichen Gotterkennens: zu wissen, dass wir Gott nicht wissen.“41
41 Summa contra Gentes 3, 38.
Zu Thomas gehört eben auch der Abbruch seines größten Werkes, der Summa, sein: „Ich kann nicht mehr …es kommt mir alles wie Stroh vor, was ich geschrieben habe“ – „omnia quae scripsi videntur mihi paleae“. Auch eine Form, dem Lebensentscheid eines armen Bettelmönches im jung gegründeten Predigerorden eine letzte beeindruckende Form und Aussage im Glauben zu geben.
So ist es vielleicht einerseits besonders schön, anrührend und auch geheimnisvoll tief, dass Thomas, so berichtet es eine Erzählung, als ihm in einer mystischen Erfahrung in der Stille der Kirche des Hl. Dominikus in Neapel Christus selbst zuteil wurde in einer Audition, und dieser ihm zum Dank für sein so treffendes und gutes Schreiben und so zum Lohn alle Schätze der Welt anbot, Thomas in größtmöglicher Kühnheit und Demut zugleich zu seinem Schöpfer und Herrn gesprochen haben soll: „Dich selbst begehre ich – nur Dich!“ Denn was wäre, was nicht zuerst und zuletzt in Gott vollends enthalten wäre!?!“42
42 Vgl. Chesterton, S. 97-104.
Und dennoch, auch das Fehlen und Begehren, das Sehnen und das Nicht in diesem Leben braucht andererseits noch einen Hinweis. Als Thomas sich im Jahr 1274, noch nicht 50 Jahre alt, auf dem Weg zum Konzil von Lyon im Kloster Fossa Nuova zum Sterben nieder legte (und sein Ende kam schnell dort), bat er darum, dass man ihm nur mehr das Hohelied (Das Lied der Lieder) der Heiligen Schrift von Anfang bis Ende vorlese. Darin heißt es im 3. Kapitel:
„Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn,/
den meine Seele liebt./
Ich suchte ihn und fand ihn nicht.
Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen,/
die Gassen und Plätze,/
ihn suchen, den meine Seele liebt.
Ich suchte ihn und fand ihn nicht.
Mich fanden die Wärter/
bei ihrer Runde durch die Stadt.
Habt ihr ihn gesehen,/
den meine Seele liebt?
Kaum war ich an ihnen vorüber,/
fand ich ihn, den meine Seele liebt.“
(Hohelied 3, 1-3)
Entspricht dies nicht in unfasslicher Weise dem, was im Buch Exodus, Kapitel 33, 18-23, geschrieben ist, wo Mose Gott bittet, dessen Herrlichkeit zu schauen. Ihm wird gesagt: „Ich will alle meine Schönheit an dir vorüberziehen lassen und den Namen Jahwes vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein will und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will.“ Weiter sprach er: „Mein Angesicht kannst du nicht schauen, denn kein Mensch sieht mich an und bleibt am Leben.“ Jahwe sprach: „Siehe, bei mir ist ein Platz (hebr. „Makom“!), da magst du dich auf den Felsen stellen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Höhlung des Felsens stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich meine Hand zurückziehe, wirst du meine Rückseite schauen. Aber mein Angesicht darf man nicht schauen.“
Thomas beichtete und empfing den Leib des Herrn in der Eucharistie. Der Beichtvater, der vermutlich anderes erwartet hatte bei einer solchen Größe des Geistes, soll berichtet haben, seine Beichte sei die eines fünfjährigen Kindes gewesen.
Literatur:
Thomas von Aquin, Sentenzen über Gott und die Welt. Hg. v. Josef Pieper Johannes-Verlag 2/1987. G.K. Chesterton, Der stumme Ochse. Über Thomas von Aquin. Freiburg u. a. 1960. P. Wilhelm Klein SJ, Gottes Wort im Kirchenjahr. Tübingen 1999. Fridolin Stier, Wenn aber Gott ist…Ein Lesebuch. Hildesheim 1991, darin zu Thomas v. Aquin: „Sitzen und schauen“, S. 91f.
Hans Jorissen, Kirchlicher Gedenktag von Thomas von Aquin : Woran sie glaubten – wofür sie lebten, hg. v. Rudolf Englert. München 1993, S. 36.
Markus Roentgen, Gottheit tief verborgen… : Pastoralblatt 1 (2000) 23f; Ders., Theologische Fragmente über das Böse : Pastoralblatt 1 (2005) 21f.