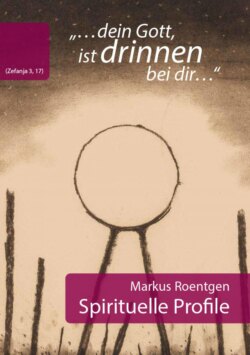Читать книгу "dein Gott, ist drinnen bei dir" (Zefanja 3,17) Spirituelle Profile - Markus Roentgen - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas dunkle Licht des Nichts
Lectio V
Otto Karrer hat Eckharts Mystik als „das katholische Gnadenerlebnis in seiner vollen subjektiven Entfaltung“ bezeichnet, ein Christentum neuplatonischer Prägung. Ist das zutreffend?
Einheit und Reinigung, die reine Gottheit wird von Eckhart der „schlechten Vielfalt“ in der Gott-rede seiner Zeit gegengehalten.
Hier ist er ganz in der Folge Plotins und dessen Zeit. In der Plotinforschung ist darauf hingewiesen worden, dass Plotin nur deshalb das Wort „das Eine“ benutzt, weil es im Griechischen kein Wort für die Null gibt, für das, was schon Scotus Eriugena „Nihil“ und Eckhart dann „Nichts“ nennen wird. Dieses „Nichts“, das „Nichts“ der Gottheit, das der vollkommen abgeschiedenen, gelassenen, losgelösten Seele auf ihrem Grund „innig“ werden soll, beinhaltet zugleich ein Nein zu allen geschichtlichen, dinghaften, welt- und personenbezogenen Heilsmittlern und Heilsmitteln.
Ist mit diesem Nein zur Geschichte, zur Natur, zur Materie auch, jedenfalls in der klassischen Zuordnung von Plotin her, ein Nein zur „Frau“ mitgesagt. Von Plotin wird ein Wort übermittelt, dass er nicht wissen wolle, wo er geboren sei, noch dass er von einem Weibe geboren worden sei.
Ist es in der klassischen männlichen Linie nicht eigentümlich, dieses Bestreben, in einem „reinen Geistsystem“ sich selbst zu zeugen? (Vgl. nochmals Eckharts „Ich bin der ich bin“).
Hier der „reine Ort“, die „leere Wüste“ – dort die Materie, das Stoffliche, das Unvollkommene, der Mangel, die Verworrenheit und Vielgestaltigkeit.
Die Geschichte, d.h. die konkrete Zeitsituation wird von Eckhart als hinfällige eliminiert. Zu dieser Geschichte gehört auch der geschichtliche Christus Jesus. So nennt Eckhart es in seinem Johanneskommentar, gleichsam eine Einführung in die Philosophie des deutschen Idealismus, wie folgt: „All dies, was jetzt von Johannes und Christus gesagt worden ist (im Evangelium), betrifft zunächst Dinge der geschichtlichen Wirklichkeit (res quaedam gesta sunt historica veritate); wir wollen aber darin Wahrheiten der Naturdinge und ihre Eigentümlichkeiten erforschen.“ (Lat. Werke III, 19)
Und Eckhart forciert dies, indem er in einem anschließenden Exkurs darlegt, wie Geschichte, Welt, Natur und historischer Christus aufgehoben werden müssten, um dem Menschen die Rückkehr in den reinen Geist, in die reine Gottheit zu ermöglichen.
Da der Mensch sich in der Regel, aus seiner Sehnsucht und seinem konkreten Liebesbedürfnis, gegen diese Aufhebung oder Nichtung sträubt, greift Eckhart nun auch die Liebe selbst noch an und predigt die Notwendigkeit zur Überwindung derselben. Dies geschieht in seiner sehr selbstbewussten „Korrektur“ der beiden „Liebeszentren“ der Heiligen Schrift: Des „Hohen Liedes“ und der johanneischen Schriften. So heißt es gegen das Hohe Lied, wo der Mensch-Gott- und Mensch-Mensch-Beziehung in Liebe gleichsam ursymbolisch gedacht wird: „Freilich die Braut in dem angegebenen Buche sagt: ‚Er ist mein, ich bin sein‘ Sie hätte aber besser gesagt: ‚Er ist für mich nicht da, und ich für ihn nicht.‘ Denn Gott ist nur für sich selber da, da in allem er ja ist.“59
59 Vgl. dazu J. Amstutz, Zweifel und Mystik, besonders bei Augustin. Bern 1950, S. 64.
Die konkrete Liebesbeziehung zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Gott wird also als hinderlich angesehen für die Rückkehr und den Eingang, die Innung des Menschen in die Gottheit.
Wie bereits mehrfach angedeutet, steht in der Grundabsicht der Eckhartschen Denkmystik die Dynamik, den Menschen hinter die Schöpfung zurückzuverwandeln!
Abgeschieden, losgelöst, gelassen so wieder zu werden „wie da er nicht war“, rückzukehren in das „Nichts der reinen Gottheit“.
Hierin, in diesem Purifikationsprozess der Läuterung und Lichtung des theologischen Denkens und Sprechens, wird auch die Trinität (der eine Gott in drei distinkten Personen subsistent) überwunden in eine Form von religiös-mystischem „Nihilismus“, die jeglicher Ideologie-Kritik gegen Religion und Gott-Rede, von der Devotio Moderna bis hin zu Feuerbach, Marx und Nietzsche standhält.
In der theologischen Tradition der Rede von der „Creatio ex nihilo“ ist für Eckhart dieses Nichts nicht, wie bei Augustinus, einfach Nichts, vielmehr ist Eckharts Nichts die nicht steigerbare Fülle der Gottheit.
Keine Mittler mehr, keine Möglichkeit mehr, „Gott“ zu nutzen für Politik, Mächte und Gewalten, Gegenmächte und Revolten!
Ist Eckharts „Nichts“, „die nackte Gottheit“, „die Wüste der Gottheit“, die die Fülle des Seins zugleich enthält, aus dessen Schoß wir entlassen worden sind um wieder darin zurückzukehren, nicht doch eine pantheistische Spekulation aus der großen Bewegung um Chartres im 12. Jhdt. erwachsen in neuplatonischem Erbe?
Gipfelt nicht dieses Denken, dem eine große Tradition vorausgeht und eine ebenso bedeutende Folge (von dem Gedanken der Immanenz Gottes in der Welt des Johannesevangeliums – „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet“ Joh 1, 14 – und das völlige Eingehen des Logos in die Welt von da an; das Wort Logos kommt nach dem Prolog nicht mehr vor... – bis hin zu Maimonides, Hegel, Fichte oder Spinoza) in dem Satz: „Der Mensch in Gott ist Gott“ (homo in deo deus est)!?
Nicht der Vermenschlichung Gottes wird hier das Wort gegeben, vielmehr der Vergottung des Menschen.
So heißt es in Eckharts „Reden der Unterweisung“ (noch sehr um den Sprachgebrauch der überkommenen Tradition trinitarischer Theologie bemüht) : „Fragt mich jemand, was Gott im Himmel tut, so würde ich antworten: Er gebiert seinen Sohn, er gebiert ihn dauernd neu und hat so große Lust zu diesem Werke, dass er nichts anderes tut als dieses Werk wirken mit dem Heiligen Geist und alle Dinge in ihm.“
Jeder Mensch soll werden, was er in Gott und aus Gott schon ist: Sohn Gottes/Tochter Gottes ineins Gott Selbst als das Wort, „das immer geboren ist und immer geboren wird“ (qui semper natus est et semper nascitur).
Es gibt demfolgend nur zwei Wahrheiten und Wirklichkeiten als im tiefsten eine je größere Wahrheit und Wirklichkeit: Gott und die Seele.
Die Einung, die in Gott immer schon ist, gelingt in Rückführung darin aber nur dem abgeschiedenen Menschen, der Seele, die ganz ausgegangen ist von allen irdischen Dingen; ihr wird möglich, alle Dinge zu tun, da ihr Leben Gottes Leben, Gott selbst ist – Gott – immerwährendes Gegenwärtigen. (Vgl. Eckharts „Reden der Unterweisung“).
So ist das, was zunächst wie größte Hybris aussieht im Wesen vielleicht doch tiefere Demut: Als Annahme von allem, was ist, als in und durch Gott Gottes.
Weitere Inhalte
Nochmals soll hier versucht werden, der Großaufgabe der Überwindung von Metaphysik im Werk Eckharts auf die Spur zu gelangen, dem vielleicht Folgenreichsten seines Denkens.
In Eckharts Pariser Quaestionen gibt es eine, für seine Zeit bereits, eigentümliche These vom Vorrang des Intellekts vor dem Sein, derart, dass in Gott das Erkennen Grundlage des Seins sei und nicht, wie sonst in der Tradition zumeist, umgekehrt. „Drittens zeige ich, dass es jetzt nicht so erscheint, dass weil (Gott) sei, er deswegen erkenne, sondern weil er erkennt, deswegen ist er, so dass Gott Erkennen ist, und dass das Erkennen selber das Fundament seines Seins ist.“ (Lw V, 40, 4ff.) („Tertio ostendo quod non ita videtur mihi modo, ut quia sit, ideo intelligat, sed quia intelligit, ideo est, ita quod deus est intellectus et intelligere et est ipsum intelligere fundamentum ipsius esse.“)
Der Gedanke stößt sich hier vom Sein ab; Sein aber, das stets als Sein des Seienden gedacht wird, ist dem Faktischen, dem etwas stets unterworfen. Diese Vorfindlichkeit geht dem seienden Seinsvollzug voraus und gibt ihm den Spielraum seiner Möglichkeiten vor, so dass die Rede vom Sein der Faktizität des „ist“ immer schon unterworfen ist (das ganze Gefängnis der Metaphysik, die eben nicht zur meta – physik gelangt, taucht auf).
„Der Satz „Ich bin“ heißt also dieses doppelte in einem: Ich bin schon de facto da, und ich bin, indem ich mich mir voraus entwerfe und vollziehe und so durch mich lebe.“ (Bernhard Welte)
Unser Selbstvollzug ist immer schon an den vorgegeben Spielraum gebunden, der nicht überschritten werden kann. Es ist das Vor-liegende, das Vor-handene.
In der überkommenen Weise ist das Sein ein zum Seienden hinzukommendes oder dem Seienden zu-kommendes in der -der Sprache bewussten- Differenz von Sein und Seiendem.
Eckharts Bemühen des vorrangigen intelligere als Vollzug oder Geschehen versucht diesen Vollzug vom Sein des Seienden und von der Bestimmung des Bestimmbaren zu befreien.
Er denkt es als ein lichtes Geschehen, das überall mit sich identisch und eins ist – und das keiner Faktizität unterworfen ist, keinem anderen ist, keiner Bestimmung außer sich selbst, nicht negativ an anderes oder korrelierendes grenzend, ohne anderes außer sich, rein mit sich Eins.
Hier gelänge eine erste kompetente vorausliegende Antwort auf die Kantische Kritik aller Gottesbeweise, die eben darin bestand, dass in der gängigen Gott-Rede von Gott geredet und gedacht wird in den Kategorien des Seienden. (Ein Gott, den es gibt, den gibt es nicht!)
Kant hat es in der Kritik der reinen Vernunft, unter B 641, so pointiert, indem er den als seiend angesetzten Gott sich selber fragen lässt (wie übrigens kleine Kinder schon sehr früh auf Gott hin fragend bemerken): „Aber woher bin ich denn?“
Und Kant fährt fort: „Hier sinkt alles unter uns, und die größte Vollkommenheit wie die kleinste schwebt ohne Haltung bloß vor der spekulativen Vernunft, der es nichts kostet, die eine wie die andere ohne die mindeste Hindernis verschwinden zu lassen.“
Nur der bestimmungs- und formlose reine und freie Geist, frei von allem Sein des Seienden, welchen Eckhart mit dem Begriff des vorrangigen Intelligere umschreibt, offen für alles in reiner Negation alles Bestimmten und Festgelegten, untergrübe die Kantische Kritik.
Eckhart stützt sich hier erstaunlicherweise durch ein Aristoteleswort: „Wie Aristoteles sagt: Der Gesichtssinn muss ohne Farbe sein, damit er alle Farbe sähe, und das Denkvermögen muss ohne alle natürlichen Formen sein, damit es alle denken könne, und so bestreite ich auch Gottes selber das Sein und ähnliches, damit er sein könne die Ursache alles Seins und alles voraus habe.“ (Lw V, 47, 15ff.)
Dieser Versuch der Überwindung von Metaphysik, als Weise vorstellenden Denkens, geschieht mit den Mitteln der Metaphysik. Es drängt Eckhart deshalb noch um eines darüber hinaus – im Durchbrechen durch alle Begriffe hindurch – in Gegenden, in denen nichts zu sehen ist, in Nichtes Nicht, in reine Negativität, Einöde, Wüste, reine und unermessliche Weite, Lichte-Sehende Finsternis....Nichts...
Hierzu noch einige Textzeugen – aus den Deutschen Predigten: Predigt 7: „Das Erkennen bricht durch die Wahrheit und Gutheit hindurch und wirft sich auf das reine Sein und erfasst Gott bloß, wie er ohne Namen ist.“(Dw I, 122, 6ff.)
Predigt 23: „Wenn er nun weder Güte noch Sein noch Wahrheit noch Eins ist, was ist er dann? Er ist gar nichts, er ist weder dies noch das.“ (Dw I, 402, 1ff.)
Und auf den Menschen der Abgeschiedenheit hin entsprechend in Predigt 6: „Die nichts gleich sind, die allein sind Gott gleich. Göttliches Wesen ist nicht gleich, in ihm gibt es weder Bild noch Form.“ (Dw I, 107, 5) Verlassen der Begriffe, Aufgabe des „Etwas-Denken“, der Mensch, ganz abgeschieden, nichts denkend, nichts wollend, nichts habend – reine Stille, Leere, Öffnung.
Aber erfahrend – denn nur ein Sehender kann die Finsternis sehen als das Nichts des Sehens!
Kostbar ist solche reine Gegenwart: „Darum bitten wir Gott, dass wir ‚Gottes‘ ledig werden.“
(s. „Beati pauperes...“)
„Dein Sein kann keine unsrer Sprachen fassen,
Das Wort, das es erschöpft, bleibt stets uns fremd;“60
60 Gertrud Kolmar, Gebet; zitiert nach Gertrud Kolmar, Weibliches Bildnis. Sämtliche Gedichte (=dtv 10779). München 1987, S. 590.
Lectio VI
Eckarts Erbe – Eckart in der Kritik
Nach der Verurteilung einzelner Sätze Eckharts durch die Bulle Johannes XXII. vom 27. März 1329 wird das Denken Eckharts gleichsam nach unten verdrängt (offiziell wird es über lange Zeiten totgeschwiegen). Gerade durch diesen Vorgang aber entwickelt sich die ungeheure Sprengkraft, die diese Schriften immanent besitzen, um so stärker aus.
Tauler, Seuse, Nikolaus von Kues, die Frauenklöster des Dominikanerordens, die Devotio moderna (mit der „Imitatio Christi“ des Thomas von Kempen als Höhepunkt), Jakob Böhme, Luther, Ignatius von Loyola, Franz von Sales, der Pietismus, mit seinem Einschlag auf Fichte, Schleiermacher, Hegel und Schelling, Schopenhauer – bis hin zu der kleinen Therese (Therese von Lisieux) mit ihrem „Alles ist Gnade“: Sie alle sind nachhaltig von Eckharts Schriften, vor allem von seinen Deutschen Predigten geprägt.
Es geschieht aber auch die fatale deutsch-national-faschistoide Adaption Eckharts durch Alfred Rosenberg, Hermann Schwarz u. a., die in Eckhart den Evangelisten eines deutschen, weltimmanenten Gottglaubens feiern. Hermann Büttner sieht in Eckhart eine Führergestalt „der Zurückbringung des Christentums in das Reinmenschliche“, welches im Deutschtum, im Deutschen alleine berufen ist, „die Geschäfte der großen Gottheit allein zu treiben in dieser Gotteswelt“.
Hier pervertiert sich eine Anlage im Denken Eckharts, die aus der Bewegung resultiert, das der Mensch Gott aus sich selbst heraus produzieren könne („ich bin selber Gott“ und „alle Besonderung, alle Persönlichkeit (wird) wieder aufgelöst in die Mutterlauge, aus der sie herausgelöst war.“)
Es ist zu billig, hier jegliche wirkliche Tendenz bei Eckhart abzustreiten, in dieser vulgären Form von Adaption.
Paul Celan wird dies nachdrücklich, und in ganz ausdrücklicher Rezeption Eckharts, ausweisen.
Im 20. Jhdt. finden weitere Eckhart-Spuren sich bei Gustav Landauer, Rilke, C.G. Jung (dessen „Mysterium Coniunctionis“ mit dem Streben nach „maximaler Integration“ in der Überwindung aller Gegensätze und Widersprüche), Heidegger, Jaspers, Fromm u.a..
So schildert Rilke ein Erlebnis in der Nacht des 26. September 1899, wo ihm offenbart worden sei, dass „die Wurzel Gott eines Tages Frucht tragen werde“. Diese Frucht aber ist, wie bei Eckhart so bei Rilke, der „göttliche Mensch“. Wie Eckhart flieht Rilke die Mauerkirche von St. Peter in Rom, die er als „hohle Puppe“ denunziert; wie Eckhart sucht er Gottunmittelbarkeit bar jeder Vermittlung, nicht Heilige, nicht Christus können dieses Streben mindern, mildern oder ersetzen.
Hier, wie bei vielen der zuvor erwähnten Eckhart-Rezipienten ist auch der entsprechend-überkühne hochfahrende Zug verspürbar, der gegen Eckhart in der Bulle vom 27. März 1329 anklagend vermerkt wird.
Weitere Inhalte
Das Eckhart-Triptychon Paul Celans61
61 Im Zusammenhag dieser Celan-Gedichte in Auseinandersetzung mit Meister Eckhart bin ich Lydia Koelle dankbar. Ihr Buch: Lydia Koelle, Paul Celans pneumatisches Judentum. Gott-Rede und menschliche Existenz nach der Shoah, Mainz 1997, gehört sicherlich ins Maßgebliche zur Eckhart-Rezeption Celans. Siehe dort vor allem das 4. Kapitel: „Zu dir hin.“ Das Eckhart-Triptychon in Lichtzwang , S. 167-231. Vgl. zur Frage nach der Möglichkeit einer Theologie nach der Shoah auch: Markus Roentgen, Alles verstehen hieße alles verzeihen....Prolegomena zu Anlaß und Unmöglichkeit von theologischen Reflexionen nach Auschwitz – Ein Versuch. Bonn 1991.
Paul Celans letzter selbst für die Veröffentlichung vorbereiteter Gedichtband zu Lebzeiten, in seinem Todesjahr 1970 (seine Lebensdaten: Geboren am 23. November 1920 als Paul (Pessach) Antschel in Czernowitz, Bukowina; Selbsttötung in der Seine, Paris April 1970; aufgefunden am 1. Mai 1970), mit dem Titel: Lichtzwang beschließt durch drei Gedichte mit unmittelbarem Eckhart-Bezug.
TRECKSCHUTENZEIT,
die Halbverwandelten schleppen
an einer der Welten,
der Enthöhte, geinnigt,
spricht unter den Stirnen am Ufer:
Todes quitt, Gottes
quitt.
Du SEI WIE DU, immer.
Stant vp Jherosalem inde
erheyff dich
Auch wer das Band zerschnitt zu dir hin,
inde wirt
erluchtet
knüpfte es neu, in der Gehugnis,
Schlammbrocken schluckt ich, im Turm,
Sprache, Finster-Lisene,
kumi
ori.
WIRK NICHT VORAUS,
sende nicht aus,
steh
herein:
durchgründet vom Nichts,
ledig allen
Gebets,
feinfügig, nach
der Vor-Schrift,
unüberholbar,
nehm ich dich auf,
statt aller
Ruhe.
Anmerkungen als Hinführung zu den Eckhart-Gedichten
Die drei Gedichte Celans „Treckschutenzeit“, „Du sei wie du“ und „Wirk nicht voraus“ stehen in einem hermeneutischen Zusammenhang. Alle bergen, teilweise wörtliche, Zitate aus den mittelhochdeutschen Predigten Eckharts. Celan hatte, so weist es seine eigene Bibliothek aus, die gegenwärtig im Deutschen Literaturarchiv in Marbach/N. aufbewahrt wird, Eckharts Schriften tief in sich aufgenommen. Er konnte sich auf große jüdische Denker wie Georg Simmel (in seinem Rembrandt-Buch) oder Gustav Landauer, der 1903 ein Buch mit Texten von Eckhart herausgibt, welche er selbst ins Hochdeutsche übertragen hatte, beziehen als Vorläufer seiner eigenen Auseinandersetzung mit der Mystik Eckharts. Wird die Mystik als cognitio Dei experimentalis auch von der theologischen Dogmatik heute geltengelassen als eine erfahrungsgetränkte Erkenntnisform innerhalb der Theologie, so korrespondiert dies ganz eigentümlich zu einem Wort Celans, welches sein Verständnis von Dichtung ausweist, dass Lyrik Mystik sei!
Celan erfährt in der mittelhochdeutschen Sprachform Eckharts, mit seinen Paradoxien, Grenzverschiebungen, Aufladungen und Erweiterungen das, was er selbst in seinem Ringen um das Sagbare und Unsägliche in seiner Dichtung preisgibt. Geschieht dies bei Eckhart aber vornehmlich als sprachlich-geistiges Geschehen, als Geburt Gottes im Intellekt und in der Seele, im Seelengrund des Menschen in der unio mystica, so greift dies, in Celans Dichtung nach der Shoah am jüdischen Volk durch Menschen deutscher Sprache, in die geschichtliche Existenz dieses Menschen, zeitvoll, von unermesslichem, von äußerstem Leiden sichtlich gebrannt (Celans Eltern sind in den Lagern aus Gas vernichtet worden, Celan erfährt davon im Winter 1942/1943; seine Mutter vor allem hatte ihm das Deutsche als Mutter-Sprache ins Herz gelegt); geschichtsverhaftet ohne Absprung in ein geschichtsjenseitig-geistig-seelisches Apriori, welches aposteriori wieder eingeholt werden soll.
Wie bereits im Gedicht „Tenebrae“ so auch in „Treckschutenzeit“ und „Du sei wie du“ dreht Celan Eckharts enthöhten (inthoeget) Gott aus der Geist- und Seeleneinheitserfahrung des Lebens regelrecht um in den zur leidensfähigen Menschengestalt erniedrigten Gott, mit dem leidenden Sprachleib des geschichtsgezeichneten Menschen eins, der einen Ort hat, konkret, geschichtlich, zeitgebunden – und nur daraus messianisch.
Die drei Eckhart-Gedichte entstehen in der ersten Adventswoche 1967. Celan wusste um die Verwendung der Verheissungen Jesajas in der christlichen Liturgie dieser Zeit im Kirchenjahr.
Während Eckhart in seiner Predigt 14 „Surge illuminare iherusalem“ den Jesajatext mit der Prophezeiung der Geburt des Messias und mit Jerusalem als Ort der endzeitlichen Sammlung der Völker allegorisch als reines Seelengeschehen der „Innung“ zwischen Gott und dem Menschen beschreibt, lässt Celan, in der Verwendung des Eckhartschen Wortes „geinnigt“ (gleichsam durch Eckhart hindurch) dies ganz und nur inkarnatorisch konkret-geschichtlich-ortsbezogen werden.
Texthinweise zum Verständnis der Gedichte
Zu Treckschutenzeit
„Trecken“ ist ein mittelhochdeutsches Wort mit der Bedeutung „ziehen“ (heute noch etwa im Eifeler Dialekt vorfindlich, wo der Traktor „Trecker“ heißt), „schleppen“ als schwere körperliche Arbeit; die „Treckschute“ (vgl. auch das seemännische „treideln“) ist die holländische Bezeichnung für ein Schleppboot, das von Menschen vom Ufer aus und längs dem Ufer gezogen wird. (Vgl. auch das Kirchenlied des Advent aus dem 15 Jhdt. „Es kommt ein Schiff geladen“). Das „Schleppen“ an „einer der Welten“, die „Stirnen“, die „am Ufer“ sind, schleppen die Last als „Halbverwandelte“. Der „Enthöhte“ ist „geinnigt“ mit denen, die am Ufer schleppen.
In Eckharts Predigt „Surge illuminare iherusalem“ (Dw I 230,4) übersetzt er den Vers Jes 60,1 ins Mittelhochdeutsche und nimmt durch die Übersetzung im Vers eine doppelte Bewegung wahr: „ ‚stant vp jherosalem inde erheyff dich inde wirt erluchtet‘ „. Allegorisch wird Jerusalem als eine Höhe ausgelegt, die herabkommen soll zu dem, was niedrig ist. Zum Niedrigen aber wird gesagt: „Komm herauf“. In dieser Doppelbewegung kann es zur „Verinnung“ kommen durch die „Enthöhung Gottes“. Dieser „inthoeget got“ soll im menschlichen Selbst „geinneget“ werden (vgl. Dw I 237,5f). Das Enthöhen Gottes hier ist keine Selbstentäußerung oder Katabasis (Kenosis) wie im Philipperhymnus, vielmehr meint das Enthöhen Gottes die Überwindung der Distanz und Transzendenz Gottes durch seine Immanenz in der Seele, wodurch diese erhöht wird im Eins-GottMensch.
Bei Eckhart sind also die „Halbverwandelten“ und der „Enthöhte“ der erhöhte Mensch und der enthöhte Gott. In der Innung ist der Prozess abgeschlossen.
Celan wendet dies diametral ins radikal inkarnatorische. In Treckschutenzeit gehört der Enthöhte zu den Halbverwandelten „unter den Stirnen am Ufer“. Er schleppt wie sie und er schleppt mit ihnen, muss das Geschick der Menschen mittragen und es erleiden. In Celans Werk findet auch sich ein in Eins – jedoch ist es ein „in eins“ im Zeichen der Wunde.62
62 Vgl. „In eins“ : Paul Celan, Gesammelte Werke in fünf Bänden, hg. v. Beda Allemann u.a. Frankfurt/M. 1983 = Gw I, S. 270.
Der Enthöhte steht in bewusster Opposition zum Erhöhten. Wie in den Gedichten „Tenebrae“ und „Spät und tief“ ist der Enthöhte der Leidende, nicht mehr und weniger nicht.
Der Tod des Todes scheint nur mit dem Tod Gottes ermöglicht. Celan wendet also Eckharts Höhepunkt der 52. Predigt „Beati pauperes spiritu“, die Bitte an Gott, „daz er mich ledic/quitt mache gotes“ am Ende von „Treckschutenzeit“ ins Materiale.
Das Wort Hegels brennt auf, dass am Kreuz Gott wirklich gestorben ist – „Gott ist tot“.
Verlegt Eckhart die Vorgänge in die Psyche des Menschen bar jeglicher Wahrung der heilsgeschichtlichen Dimension, so totalisiert Celan die geschichtliche Situation des Menschen so weit, dass kein Abhub des Geistes daraus gestattet wird.
„Nicht der Mensch wird in Celans Gedicht „Treckschutenzeit“ in die Position Gottes eingesetzt, sondern Gott in die Position des Menschen, und das heißt, daß er auf dem Weg seiner Entäußerung auch am menschlichen Schicksal mitträgt und es erleidet.“ (Lydia Koelle, a.a. O. 184, siehe Angabe hinter dem Kapitel.) Radikalisiert bis ins Äußerste wird der Gottverlassenheitsschrei Jesu am Kreuz „Eli, Eli, lama asabtani“ (Mk 15,34) für den nichttrinitarisch verwurzelten Juden Paul Celan zum Gebet Gottes vor seinem eigenen umröchelten Tod. (Siehe auch in der Tradition das Wort Luthers: „da streydet Got mit Got auf Golgatha“; zitiert nach Kerygma und Dogma 36 (1990) S. 275. Vgl. auch Helmut Gollwitzer in seinem Buch: Krummes Holz – aufrechter Gang, München 1970, S. 258.: „Der Riß geht nicht durch Jesus, er geht durch Gott selbst; Gott selbst ist von Gott verlassen, Gott selbst stößt sich aus.“)
Zu DU SEI WIE DU
Wie im Triptychon in der Regel üblich, nimmt DU SEI WIE DU die mittlere, d.h. die zentrale Position ein. Celan thematisiert hier, im Sprachdurchgang vom Hochdeutschen, durchs Mittelhochdeutsche zum Hebräischen (kumi/ ori übersetzt von Gunther Fleischer: „erhebe Dich/ leuchte“ ; 2. Sg. Imp. fem. – es macht so im Hebräischen, anders als im Deutschen, die Anrede Jerusalems als Frau sichtbar!) das unauflösliche Spannungsverhältnis zwischen christlicher Tradition, im deutschen Sprachgewand, zurück durch die mittelhochdeutsche Sprachtradition des Meister Eckhart, hinunter, hinein, ins Ziel der jüdischen Überlieferung, ins Wort, in die Vor-schrift des Propheten Jesaja, erinnert in der Ursprungssprache.
In der ersten Fassung sollte das Gedicht noch: „Nichts ist wie du, nirgends“ lauten. Der Eckhart-Zusammenhang, der die Gott-Rede ins Eins-Nichts hinein münden lässt leuchtet auf und wird zugleich gebrochen durch den Modus der, in der Endfassung durchgehaltenen, An-Redeform: „Du“.
Zugleich ist die Jhwh-Selbstprädikation in Ex 3,14, die in der Exodus-Theologie Eckharts ebenso eine große Rolle spielt, im Titel schon präsent („Ich bin da, wie ich da bin“), verliert aber hier den geschichtslos-allegorischen Deuterahmen Eckharts in der Anrufung Jerusalems als konkretem Ort: „Du sei wie Du“.
In der hebräischen Tradition ist Jerusalem der tatsächliche Ort, den Gott als Wohnsitz sich erwählt hat!!
Das zerschnittene Band „zu dir hin“ gibt doppelter Assoziation Raum. „Band“ und „Bund“ haben im Deutschen eine Wurzel. Jerusalem ist Ort für das Bundesband zwischen Gott und Israel. Die Bundestreue Gottes bleibt und ist unwiderrufene Zusage seit dem Noachbund – auch wenn das Volk den Bund bricht.
Bund evoziert auch „Bindung“; im Traditionszusammenhang Israels wird der „Bindung Isaaks auf dem Berg Moria“ (Akedah) gedacht; er wird nicht geopfert, er wird nicht getötet – aber er wird auf den Altar gebunden. In der jüdischen Tradition ist diese Akedah, seit den Kreuzzügen und bis hinunter in die Shoah ein zentrales Symbol für das jüdische Martyrium in der Heiligung des göttlichen Namens (Kiddusch Haschem). Die Erwählung, die bindet, wird und wurde zum „Schlammbrocken“, der im Turm (im Ort für Gefangenschaft, Exil und Isolation), heruntergeschluckt werden musste, heruntergeschluckt werden muss (vgl. Jeremia 38,6 – Jeremia in der Zisterne, der Schlamm als Materie der Todesbedrohung; vgl. auch Psalm 69, wo der Beter tief im Schlamm versunken ist). Die Bindung an den Bund, das Band, das zerissen wurde und das nur im Eingedenken, im Gedächtnis wieder geknüpft werden kann, sie ist durch eine unfassliche Blutspur der Opfer gezeichnet.
In „Du sei wie du“ geschieht eine Rückbindung des Neuhochdeutschen durch das Mittelhochdeutsche der Mystik Eckharts bis hinunter in die jüdische Wurzel kumi ori als Wahrung der Traditio, als Übergabe und Übernahme der messianisch-prophetischen Botschaft Israels in ihrem Ursprung.
Die Sprache wird hier („inde wirt/erluchtet“) zur Leuchtspur des Geschehens, wird zur „Finster-Lisene“, sie ist der Schwärze Lichtsaum. „Lisene“ entstammt dem franz. „lisière“ = Saum, Leiste, Rand, Grenze, in der Architektur ein flacher, senkrechter Mauerstreifen. Die Sprache wird Rand der Finsternis, sie spricht das Finstere und, indem sie Ort des Gedächtnisses („der Gehugnis“) ist, als Erinnerungs- und Bewahrungsort, der dem Vergessen entreißt, ist sie, die Sprache, die ephemere und angefochtene, die auch wie ein Nichts ins Schweigen tendiert, so und vielleicht nur so, als Finster-Grenze Lichtsaum und, in ihrer vollendeten Armut und Ausgesetztheit, Hoffnungsspur. Permanentes wechselseitiges Durchdringen und Durchdrungensein von Schweigen und Sagen, Licht und Finsternis.
Ist „gehochnysse (= gehugnisse)“ in Eckharts Predigt noch das geheim-verborgene Wissen, so wendet Celan es in den Ort des Eingedenkens, in das akut-aufmerkende Gedächtnis als den Ort der memoria passionis. Wesentlich ist, dass er „Gehugnis“ an dieser Stelle nicht kursiv als Zitat aus dem Eckhart-Werk kennzeichnet, sondern er dieses mhd. Wort als Eigenes sich anverwandelt, es gleichsam als dem jüdischen Erbe im Kern zugehörig markiert – selbst in seiner mhd. Sprachausgießung. „Zachor!“-Erinnere Dich!“ – das ist das Zentrum der Bundestreue Israels mit seinem Gott – es ist die anamnetische Dimension des Menschen in seinem eingedenkenden Einstehen (solidarisch nach rückwärts und vorwärts mit den Zernichteten, den Leidenden, den Entrechteten der Geschichte) und in seiner bewahrend-akuten Sprache.
Deshalb kann am Ende „kumi ori“ auch nicht durch ein deutsches Wort vertreten werden. Im Original hat Celan diese beiden Worte auch in hebräischer Konsonatenschrift geschrieben. Das „Aufstrahlen des Lichtglanzes“, im Jesajawort „kumi ori“ als Hoffnungsgestalt im Eingedenken der Leidenden und der Opfer der Geschichte Israels, erträgt keine Sprachübertragung. Die mit dem jesajanischen „Jerusalem“ verbundene Hoffnung auf Neuschöpfung, in der Weltanfang und –ende einander endgültig entsprechen, ereignet sich nicht in Geist und Bewusstsein, sie ist angewiesen auf den konkreten Ort, ist material. Jerusalem – die Stadt.
Celan hat die drei Gedichte zeitnah zum „Sechstagekrieg“ Israels gegen Ägypten 1967 geschrieben. Durch diesen war Jerusalem wiedervereinigt worden, hatte das Volk Israel wieder ungehinderten Zugang zu allen heiligen Stätten. Der Wallfahrtsort ist konkret, raumgebunden, material, ja politisch – er wird nicht zeitenthoben spiritualisiert.
Zu Wirk nicht voraus
Das Schlussgedicht des Lichtzwang-Gedichtbandes verschränkt nochmals christlich-mystisches mit jüdisch-kabbalistischem Gedankengut.
Der Mensch, der angesprochen wird, ist aufgefordert, sich jeglicher Providenz, jeglicher Vorausschau zu enthalten. Walter Benjamin hatte in seinen geschichtsphilosophischen Thesen zum Ende seines Lebens (am 27. September 1940 nahm er sich, auf der Flucht vor den deutschen Truppen, im spanischen Grenzort Port Bou das Leben) darauf hingewiesen, dass es dem frommen Juden versagt sei, der Zukunft nachzuforschen. Dagegen „steht herein“ die Unterweisung in das je jetzt zu praktizierende Eingedenken durch Wort und Herz und Mund und Tat und Leben (Walter Benjamin, Anhang B der Thesen „Über den Begriff der Geschichte“).
Wieder wird das mystische „Nu“ Eckharts, das Intellekt, Geist und Seelengrund anspricht von Celan in den Konkretionsraum und in die Zeithaftung der Geschichte verlagert.
Wieder kommt Eckhart wörtlich zum Tragen, diesmal jedoch nicht im mittelhochdeutschen Zitat, sondern vollends adaptiert von Celans eigenem Wortschatz.
Einig ist Celan mit Eckhart über die Bedingung der In-Besitz-Nahme der Je-Jetzt-Gegenwart. Bei Eckhart wie Celan geschieht dies durch das „Gott-lassen“, „ledig/allen Gebets“, „durchgründet vom Nichts“ als das, was in der Tradition der negativen Theologie die wirkliche Wahrung von Gottes Göttlichkeit auszeichnet. Zugleich verbindet Celan hier das Eckhart-Wort mit der lurianischen Kabbala, die in ihrem Zentrum der „creatio ex nihilo“ nachgeht, der „Schöpfung aus Nichts“, die, im Gegensatz zur plotinischen Vorstellung das Andere Gottes nicht durch Überfließen aus sich entlässt, sondern durch Selbst-Kontraktion, dadurch also, dass Gott im ersten Nu des Anfangs sich in sich selbst zusammenzieht (kontrahiert) und Platz macht, damit das Andere von-ihm-weg //zu-dir-hin//auf-ihn-zu überhaupt in Freiheit sein kann (im Hebräischen heißt dies Zimzum).
Setzt Eckhart sich von der Jesaja-Vor-schrift insofern ab, dass er sie hineinverwandelt in sein zeitenthobenes Durchbrechen zur Gottinnung im Nichts-Eins-Gottes des Seelengrundes, gleichsam in den vorgeburtlich-ungeschichtlichen Zustand zurück, der ewig-jetzt ist als unendliche Gegenwärtigkeit, der aber aposteriori vom geschaffenen Menschen durch das abgeschieden-arme Gott-quitt werden erst wieder erlangt werden muss, so ist die prophetische Vor-schrift für Celan unüberholbar, auch nicht durch das Christusgeschehen, in dem, nach christlicher Tradition die Prophetie Israels ihre Erfüllung gefunden hat.
In seinem Gedicht „Spät und tief“ hatte Celan die ihm einzig glaubhafte Bedingung für das Erscheinen des Messias, lastend schwer gegen Christus und das Christentum, genannt: „es komme, was niemals noch war!// Es komme ein Mensch aus dem Grabe.“
Ein Mensch – nicht der Gott-Mensch Christus Jesus des Evangeliums.
So lange dies nicht ist, wird jeglicher Spiritualisierung von Erlösung Absage erteilt. Hier darf nicht vorausgewirkt werden, hier darf keine Botschaft gesendet werden („sende nicht aus“) als sei etwas schon realisiert, was als sichtbar-geschichtliches Ereignis für den sterblichen Menschen radikal aussteht in dieser Welt.
So kommt dem Menschen, der das Band mit Jerusalem und damit die jüdische Prophetie als Verheißung aufnimmt bar jeder Gewähr auch keine Ruhe zu.
Ein anderer Großer der Tradition des Christlichen taucht nun unabweisbar auf und wird gekontert: Augustinus.
Wenige Celan Exegeten haben dies bemerkt. In Celans Exemplar von Augustinus Confessiones, welches er 1960 erwarb, ist im ersten berühmten Abschnitt die Zeile unterstrichen „...weil du uns schufest zu dir hin“ (vgl. das „zu dir hin“ in Du Sei Wie Du ). Der ganze Satz bei Augustinus heißt: „Du treibst ihn (= den Menschen), daß dich zu preisen ihm Wonne ist, weil du uns schufest zu dir hin, und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.“
Nun, in Wirk nicht voraus, wird dieses Ziel, die „Ruhe in Gott“, regelrecht attackiert durch das „nehm ich dich auf,/ statt aller/ Ruhe“. „Wer das Band zu Jerusalem neu knüpft und sich des Bundes mit Jhwh erinnert, nimmt die Bürde der Ruhe-und Heimatlosigkeit auf sich.“ (Lydia Koelle, a.a.O. 209)
Die Ruhe ist nicht das Ziel Celans – er gehört, wie Gustav Landauer und andere, zu denen, die durch nichts beruhigt werden können, solange die Welt sichtbar nicht wiederhergestellt ist ( vgl. hebr. Tikkun olam = die Welt zusammenfügen).
Literatur:
Maßgeblich für dieses Kapitel ist die Arbeit von Lydia Koelle, Paul Celans pneumatisches Judentum. Gott-Rede und menschliche Existenz nach der Shoah. Mainz 1997. Zitiert nach: Lydia Koelle, a.a.O.).
LECTURA ECKHARDI I-II. Hg. v. Georg Steer u. Martin Sturlese. Stuttgart u.a. 1998-2008.
Meister Eckhart. Deutsche Predigten. Eine Auswahl. Mittelhochdeutsch. Neuhochdeutsch (=Reclam 18117). Stuttgart 2001.
Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate (=detebe Klassiker 20642), hg. und übersetzt v. Josef Quint. München 1979.
Meister Eckhart, Predigten und Schriften, ausgewählt und eingeleitet von Friedrich Heer. Frankfurt/M. 1956.
Alois Dempf, Meister Eckhart. Herder-Tb 71. Freiburg i. Br. u.a. 1960.
Kurt Flasch, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums. München 2010.
Alois M. Haas, Mystik als Aussage. Erfahrungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik Frankfurt/M. 2007.
Dietmar Mieth, Meister Eckhart. Einheit mit Gott. Die bedeutendsten Schriften zur Mystik. Ostfildern 2/2014.
Klaus-Werner Stangier, Das Unsagbare sagen. Book on Demand 2017.
Bernhard Welte, Meister Eckhart, Gedanken zu seinen Gedanken. Freiburg i. Br. u.a. 1992.