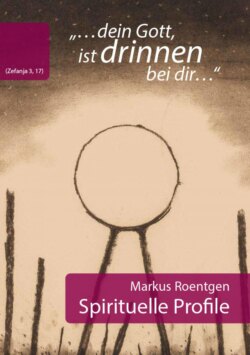Читать книгу "dein Gott, ist drinnen bei dir" (Zefanja 3,17) Spirituelle Profile - Markus Roentgen - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLeben und Werk IV
Ein Höhepunkt der „Confessiones“, die sogenannte Ostia-Vision im neunten Buch, an dessen Ende er den Bericht vom Sterben seiner Mutter Monika setzt, ist der einzigartige Bericht über die Gotteserfahrung von Ostia; Gedanken dazu sollen die spirituelle Hinführung zu Augustinus Bekenntnissen im vierten Angang beschließen.
Es ist nach der Taufe des Augustinus, geschehen in der Osternacht des Jahres 387 in Mailand.
Augustinus gibt seine bisherige berufliche Karriere (als Rhetoriklehrer) auf, ihm schwebt ein zurückgezogenes mönchisches Leben vor. In Cassiciacum am Comer See, wo er sich auf die Taufe vorbereitet hatte, kann er nicht mehr bleiben, dazu reichen die finanziellen Mittel nicht aus. Er will zurück in seine Heimat. Auf der Reise dorthin kommen sie, Augustinus und seine Mutter, nach Ostia nahe Rom, um dort ein Schiff zurück nach Afrika zu nehmen. In diesen Tagen des Herbstes 387 kommt es dort zwischen den beiden zu einem Gespräch, das, von Augustinus später beschrieben, nachgeschrieben, zum Schönsten in den Confessiones zählt.
Stil, Inhalt und Spiritualität sind einzigartig – es ist der Bericht einer gemeinsam erfahrenen Gottgegenwart in der Weise eines immer tiefer und weiter und höher sich schwingenden Gespräches zwischen zwei Menschen, einem Mann, einer Frau.
Solches lässt sich nicht zwingen und machen. Wer es einmal erlebt hat, wenn ein Sprechen allmählich wirklich zum Gespräch wird, wenn zwei einander hören, erweitern, vertiefen, wenn Inniges entsteht, wenn die Herzen zusammen finden, dass plötzlich nicht mehr unterscheidbar ist, wer nun spricht, wer hört, wenn darin Schwingen, Weite, Tiefe und Höhe entstehen, wenn die Worte einander ergänzend finden, wenn Ohr und Herz und Atem wie eins werden – und die Zeit wie im wundersamsten Kinderspiel sich aufzuheben scheint, jedenfalls nicht mehr bemerkt wird, wenn lautere Gegenwart entsteht, ohne dass der eine, die andere sagen könnte, wie – dann, wenn D u solches schon einmal im Leben erfahren hast, dann ist vielleicht eine Ahnung da von dem, was zwischen Augustinus und seiner Mutter sich in Ostia ereignete!
Sie lehnen am Fenster im kleinen Zimmer, schauen hinaus in den Garten, da fragt Monika, vielleicht in der Ahnung, dass ihr Leben kurz vor der Neige steht, nach dem ewigen Leben, nach dem, wie es wohl ist, im Himmel?!
Etwas, was niemand weiß, was kein Auge je geschaut, was keines Menschen Herz je erreicht – aber was zugleich Grund und Ziel allen Sehnens, allen Verlangens ist, wonach zumindest unser Ahnen sich ausstreckt.
Nun ist dieses denkwürdige Gespräch, im Rückblick des Augustinus aufgeschrieben, nicht voraussetzungslos, es besteht aus Kraftquellen, die Augustinus inwendig erfasst hatten, ebenso wie Einsichten darin mit vermittelt werden, die dem Bekenntnischarakter des Gläubigen entsprechen, und also Zeugnis sein wollen.
Auszumachen sind als Kraftquellen des Ostia-Berichtes bis in Form, Sprache und Inhalt, Plotins Enneaden als philosophischer Hintergrund dieser Seelenaufstiegsmystk, also ein an ewigen Ideen orientiertes Denken, das platonisch-neuplatonischen Ursprungs ist; hinzu kommt, bis in die Fülle des eingearbeiteten Schriftwortes hin, die Autorität der Heiligen Schrift als Bewusstsein für das Ereignishafte der Geschichte Gottes mit Menschheit, Israel, und Weltganzem im Glauben des Christusgeschehens, welches dann drittens nochmals konkret erfahrbar wird im Zusammensein nun vor Ort des Augustinus mit seiner Mutter Monika, also nicht eine philosophisch-theologisch-spirituelle Spekulation eines einzelnen Menschen, vielmehr die konkrete Gesprächspartnerin vor Ort, zu einer ganz klar datierbaren Zeit, unmittelbar vor dem Tod der Mutter. Im Rückblick also ein höchst bedeutsames Ereignis, gleichsam das Finale, das Vermächtnis im Zusammensein mit der Person, die, nach Auskunft Romano Guardinis, als einzige nicht weg zu denken ist aus der Gesamtentwicklung, die Augustinus genommen hat. Mit ihr geschieht das mystische Erleben, die Erfahrung der Berührung Gottes, des id ipsum (das Du, Eine, Ewiggleiche) für einen vollen gemeinsamen Herzschlag, nicht in einsamer Kammer, sondern im Du-Gespräch, vielleicht so, wie es Hölderlin einzigartig fasste im Zentrum seines Gedichtes Friedensfeier: „Viel hat von Morgen an,/ Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,/ Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.“ (Schlussfassung) In der zweiten Fassung des Gedichtes hieß es noch: „Viel hat erfahren der Mensch. Der Himmlischen viele genannt,/ Seit ein Gespräch wir sind/ Und hören können voneinander.“22
22 Vgl. Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe Band 1. München, Wien 1998, S. 355-366.
Nach dem Gespräch stirbt die Mutter, Augustinus beendet den autobiografischen Teil der Confessiones mit dem Bericht über ihren Tod, mit einer ergreifenden Totenklage endet dieser Teil, mit der Hoffnung auf das Wiedersehen im himmlischen Jerusalem, dessen unsagbare Wirklichkeit für einen gemeinsamen Herzschlag in Ostia erfahren wurde als Vorabahnung eines köstlichsten Augenblicks – in ictu cordis – „mit einem gemeinsamen vollen Herzschlag, in höchster Herzerhebung, Da streiften wir sie, die ewige Weisheit, das Göttliche“…
In seiner Trauer erinnert sich Augustinus der Verse seines Lehrers und Taufvaters Ambrosius, die ihm endlich die Tränen lösen zum Loslassen seiner Mutter in die Dimension der Hoffnung eines ewig währenden Jerusalems:
„O Gott und Schöpfer allen Seins,
Du lenkst so mild des Himmels Bahn,
Du kleidest aus den Tag in Licht,
Verleihst zur Nacht die sanfte Ruh’;
Dass rasten kann der müde Leib,
Und sich so labe, ruhevoll zu neuer Müh’
Herzauf der Atem frische neue Kraft
Und lasse Last und dumpfe Kümmernis.!
(eigener Übersetzungsversuch von Markus Roentgen)
Hier korrespondiert nun als Ahnen, womit das letzte Buch der Confessiones schließen wird, die Ahnung und das Noch-Nicht des siebenten Schöpfungstages, mit dessen Betrachtung Augustinus das 13. Buch und damit die Confessiones beenden wird.
Beides soll deshalb, als Textzusammenstellung, diesen kleinen vierteiligen Zyklus zu den Confessiones des Augustinus auch zu einem Doppelpunkt bringen, der Sie, die Lesenden, einladen will, selbst das Ganze zu lesen, staunend, mit denkend, fragend, hadernd, befremdet, fasziniert, mit sehnsüchtigen Augen, Ohren, Sinnen, denkend, betend – herzweit!
Spiritualität – Mystik des Gespräches
Die Ostia-Vision (Augustinus mit seiner Mutter Monika) als einzigartiges Dokument einer mitgeteilten und aufgeschriebenen Gotterfahrung, die zwei Menschen (einer Frau und einem Mann zugleich) im Gespräch zuteil wird. Die Szene erscheint auch wie ein Reflex auf eine kostbare Szene aus dem Buch des Propheten Daniel (und Augustinus hatte die Heilige Schrift inwendig und auswendig zur Verfügung), wo dessen Jerusalem-Sehnsucht im 6. Kapitel sich ähnlich ausdrückt, wie die ewige Jerusalem-Sehnsucht des Augustinus mit seiner Mutter Monika. Beim Propheten Daniel heißt es in Daniel 6, 11: „Als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, ging er in sein Haus. In seinem Obergemach waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er dreimal am Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott, ganz so, wie er es gewohnt war.“ Ähnlich beginnt die Schilderung bei Augustinus. So heißt es im 9. Buch der Confessiones:
„Schon nahte der Tag, da sie (Monika) aus diesem Leben scheiden sollte – Du kanntest ihn, wir nicht -, da traf es sich, wie ich glaube durch Deine geheime Fügung, dass wir beide allein, ich und sie, an ein Fenster gelehnt standen, das in den Garten innerhalb des Hauses ging, das uns beherbergte, dort in Tiber-Ostia, wo wir, dem Trubel entrückt, nach der Mühsal der langen Reise Kräfte sammelten für die Seefahrt. Wir unterhielten uns also allein, köstlich innig, und, ‚vergessend was hinter uns lag, auslangend nach dem, was vor uns liegt’ (Augustinus zitiert Phil 3, 13), fragten wir uns im Angesicht der Wahrheit, die du bist, welcher Art wohl dereinst das ewige Leben (vita aeterna) der Heiligen sei, jenes Leben, das freilich ‚kein Auge geschaut und kein Ohr vernommen, und das in keines Menschen Herz gedrungen ist’ (Augustinus zitiert 1 Kor 2,9). Und doch lechzte begierig unser Herz nach den Wassern aus der Höhe, und den Wassern ‚Deiner Quelle’, der ‚Quelle des Lebens, die bei Dir ist’ (Augustinus zitiert Psalm 36, 10), um von dorther nach unseres Fassens Maß benetzt, einem so erhabenen Gegenstand auf alle Weise nachzusinnen.
Im Fortgang des Gespräches ergab sich uns, dass mit der Wonne des ewigen Lebens kein Entzücken (delectatio), auch nicht die höchste Lust, sinnenvermittelt, wie groß es auch sei, wie gleißend auch und köstlich im irdischen Licht, sich vergleichen, ja daneben auch nur nennen lasse: da erhoben wir uns mit heißerer Inbrunst nach dem wesenhaften Sein (nach dem, was das Selbst ist; erigentes nos ardentiore affectu in ‚id ipsum’ – Augustinus zitiert den Psalm 4, 9 in der lateinischen Fassung; Joseph Bernhart weist in den Anmerkungen zu seiner Übersetzung (S. 889) auf dieses Verstehen des Psalmwortes hin: „o in pace! O in idipsum (Ps 4,9): Et tu es id ipsum valde, qui non mutaris. Im Psalmenkommentar 4,9 geht Augustinus auf ‚id ipsum’ nicht ein. Aber im Kommentar zu Psalm 122, 5 erläutert Augustinus ‚idipsum’: quod semper eodem modo est …quod est – also: ‚was schlechthin ist, im höchsten Sinne ist, das Sein ist’ … quod aeternum est. Dieser Ausdruck deutet auf die Selbstoffenbarung und Selbstbezeichnung JHWH‘S hin (vgl. Ex 3, 1-14), die im Lateinischen übersetzt wurde als ‚ego sum qui sum’– und ist so verwandt der Aussage des Plotin vom griechischen en, das jedoch hier bei Augustinus persönlich verstanden und gefärbt bleibt in der Weise der Anrede); und durchwanderten stufenweise die ganze Körperwelt, auch den Himmel, von dem herab Sonne, Mond und Sterne leuchten über die Erde. Und höher stiegen wir auf im Betrachten, Bereden, Bewundern Deiner Werke, und wir gelangten zu unserer Geisteswelt (et venimus in mentes nostras; „mens“, das ist der geistig-rationale Teil unserer Seelenwelt, worin die Sinneseindrücke, Gefühle, Begierden und Leidenschaften geordnet werden, zudem auch die Geisteswelt, unsere Abstraktionskraft, reines Denken und Logik). Und wir schritten hinaus über sie, um die Gefilde unerschöpflicher Fülle zu erreichen, auf denen Du Israel auf ewig weidest mit der Speise der Wahrheit; und dort ist das Leben die Weisheit (sapientia), die Weisheit, durch die alles Geschöpfliche entsteht (hier bezieht Augustinus sich auf Psalm 104, 24), was je gewesen ist und was je sein wird; und sie selbst ist ohne Werden, sie ist, wie sie gewesen ist, und also wird sie für immer sein. Es gibt in ihr kein Gewesensein noch ein Künftigsein (also keine Vergangenheit und keine Zukunft), sondern das Sein allein, weil sie ewig ist; denn Gewesensein und Künftigsein ist nicht ewig. (Die Weisheit – sapientia – bedeutet bei Plato Idee, in der Heiligen Schrift in Sprüche 8, 22 ist sie eine Art Hypostase, ein Heraustreten und Erscheinen Gottes, letztlich Schöpferkraft, Gestalt gewordene Idee, Logos, in und aus dem alles wird.) Und während wir so reden von dieser ewigen Weisheit, voll Sehnsucht nach ihr, da streiften wir sie leise in einem vollen Schlag des Herzens (attigimus eam –sapientiam – modice toto ictu cordis)
(Was da geschieht ist augenblicklich und ewig und hier nicht festzuhalten, denn)“ da seufzten wir auf und ließen dort festgebunden ‚die Erstlinge des Geistes’ (Augustinus zitiert hier Röm 8, 23); und wir wandten uns wieder dem Getön der Rede zu, bei der das Wort Anfang und Ende hat; was auch wäre ähnlich Deinem Wort, unserm Herrn, dem Wort, das in sich verbleibt, ohne zu altern und doch alles erneut!
(Und nun schwingt die Erfahrung nach, erdverhaftet wiederum!)
Wir sagten uns also: Brächte es einer dahin, dass ihm aller Tumult des Fleisches (sileat tumultus carnis) schwände, dass ihm schwänden alle Innbilder von Erde, Wasser, Luft, dass ihm schwände auch das Himmelsgewölbe (welches als Verkörperung des Feuers mit Erde, Wasser und Luft die vier Elemente bezeichnet) und selbst die Seele gegen sich verstummte und selbstvergessen über sich hinausschritte, dass ihm verstummten die Träume und die Kundgaben der Phantasie, dass jede Art Sprache, jede Art Zeichen und alles, was in Flüchtigkeit sich ereignet, ihm völlig verstummte – denn wer ein Ohr dafür hat, dem sagt das alles: ‚nicht wir sind’s, die uns schufen, sondern es schuf uns, der da bleibt in Ewigkeit’(Augustinus zitiert aus dem Psalm 100) -, wenn also nach diesem Wort das All im Schweigen versänke, weil es sein Ohr zu dem erhoben hat, der es erschaffen, und wenn nun er allein spräche (et loquatur ipse solus) nicht durch die Dinge, sondern nur durch sich selbst (non per ea, sed per se ipsum), so dass wir sein Wort vernähmen nicht durch Menschenzunge, auch nicht durch Engelsstimme und nicht im Donner aus Wolken, noch auch in Rätsel und Gleichnis (hier benennt Augustinus lakonisch in einem Halbsatz die Grenzen der Vermittlungsmöglichkeiten göttlicher Offenbarung durch uns Menschen), sondern ihn selbst vernähmen, den wir in allem Geschaffenen lieben, ihn selbst ganz ohne dieses (Geschaffene), wie wir eben jetzt uns nach ihm reckten und in windschnell flüchtigem Gedanken (rapida cogitatione) an die ewige, über allen beharrende Weisheit rührten; und wenn dies Dauer hätte (si continuetur – also der eben erfahrene Augenblick in seiner Jetztflüchtigkeit aeternum, Ewigkeit wäre) und alles andere Schauen, von Art so völlig anders, uns entschwände und einzig dieses den Schauenden ergriffe, hinnähme, versenkte in tiefinnere Wonnen (rapiat et absorbeat et recondat in interiora gaudia), dass so das ewige Leben wäre, wie jetzt dieser Augenblick des Erkennens, dem unser Seufzen galt (eben dieser blitzhafte Moment des Herzberührens göttlicher Weisheit selbst als vita aeterna): ist nicht dies, was da gesagt wird: ‚Geh ein in die Freude Deines Herrn’?“ (Hier zitiert Augustinus Mt 25, 21.)
(Übersetzung nach Joseph Bernhart)
Dieses blitzhafte vollständige Erahnen und Erfahren des göttlichen Allsamtes, ewig, ungebrochen, das im Danach wieder jäh zurück fallen lässt ins erdhaft Bedingte, es entspricht allen tradierten Mitteilungen von ausdrücklicher Gotteserfahrung – und ist doch so außergewöhnlich hier, weil im Gespräch Mitsammen erfahren von Zweien, ebenbildlich Gottes als männlich und weiblich (vgl. Gen 1, 26 f.) – und im Nichtfesthaltenkönnen sowohl das deutliche Erkennen dessen, was noch aussteht, zugleich aber auch darin eine kostbare Ahnung, welche als Zuversicht in diesem Ausstehen im Blick auf den 7. Schöpfungstag in der Schilderung des Buches Genesis den Menschen erfüllen kann.
Der Abschluss, die Ahnung und das Noch-Nicht des siebenten Schöpfungstages als Freude der Ruhefülle in und mit Gott ist dann auch Klammer des Buches zurück zur Anfangssehnsucht der Eingangsworte der Confessiones, „denn du hast uns geschaffen zu Dir hin, und unruhig ist unser Herz, bis es ruhevoll ist in Dir.“ (Confessiones 1)
So schließen die Confessiones mit einem Gebet, in der Bitte um Frieden und vollendete Ruhefülle Gottes in uns:
O Herr und Gott, schenke uns den Frieden – Du hast uns ja alles geschenkt (hier zitiert Augustinus Jesaja 26, 12)-, den Frieden der Ruhe, den Frieden des Sabbats, den Frieden ohne Abend! Denn diese ganze höchst wundervolle Wirklichkeit in der Ordnung der Dinge, die Du selbst ‚sehr gut’ nanntest, – sie wird, wenn ihr Maß und Ziel erfüllt ist, vergehen: denn darin ist je noch ‚ein Morgen’ und ‚ein Abend’ (hier ist immer das erste Kapitel der Genesis im Hintergrund).
Aber der ‚siebente Tag’ ist abendlos und hat kein Untergehen mehr, weil Du ihn geheiligt hast als Immerwährenden und Bleibenden. Und wenn Du nach Deinen sehr guten Werken am siebenten Tag ruhevoll bist, und aus dieser Ruhefülle alle Werke gewirkt hast, dann soll Deine Stimme in Deiner Schrift uns doch vorauskünden, dass auch wir nach unserem Wirken, welches, weil Du es uns im Kern aus Dir selbst gegeben hast, auch ‚sehr gut’ ist, am Sabbat des ewigen Lebens ruhen werden in Dir.
Dann wirst auch Du in uns so ruhevoll sein, wie Du jetzt in uns wirkst, und diese Ruhefülle wird Dein Selbst in und durch uns sein, so, wie jetzt Dein Wirken durch uns ist. Du, o Herr, bist immerwährendes Wirken und darin immerwährende Ruhefülle zugleich. Du siehst nicht in der Zeit, regst Dich nicht zeitlich oder ruhst zeitverhaftet – und doch bist Du es, der da wirkt und wirkt das zeitliche Sehen und Erkennen, die Zeit selbst und das vollendete Ruhen, ruheerfüllt, wann Zeit nicht mehr sein wird.“
(eigener Übersetzungsversuch von Markus Roentgen)
In allem aber gilt die größere Demut, die im Sermo 117, 5 Augustinus so beschreibt:
„Si enim comprehendisti, non est Deus“
„Wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott“.
Literatur:
Peter Brown, Der Heilige Augustinus. Lehrer der Kirche und Erneuerer der Geistesgeschichte (= Heyne Biographien 18). München 1967.
Ernst Dassmann, Augustinus. Heiliger und Kirchenlehrer. Stuttgart u.a. 1993.
Henri Marrou, Augustinus (=rororo Bildmonographie 8). Hamburg 1988. Des heiligen Augustinus Bekenntnisse (Confessiones), übersetzt von Alfred Hoffmann : Des Heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus ausgewählte Schriften, aus dem Lateinischen übersetzt. Vii. Band (= Bibliothek der Kirchenväter Bd. 18) Kempten/München 1914. F. van der Meer, Augustinus der Seelsorger, Köln 1951.