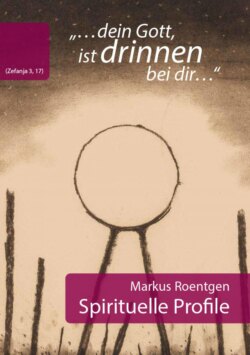Читать книгу "dein Gott, ist drinnen bei dir" (Zefanja 3,17) Spirituelle Profile - Markus Roentgen - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTeresa von Avila
„In Gottes Freundschaft durch und mit Jesus leben –
das Beispiel der großen Therese des Karmel“
„Das Buch des Lebens“ der Teresa von Avila I
Das Beispiel der Teresa von Avila im Blick auf ihr „Buch des Lebens“ (Vida)
Im Karmel, als einzigem Orden der Kirche, sind erster und zweiter Bund, Israel und die Kirche, im selben Maße innig geeint!
Teresa von Jesus (von Avila), von Paul VI. 1970 am 27. September als erste Frau der Kirche zur Doctor Ecclesiae, zur Kirchenlehrerin ernannt, mit den Lebensdaten 1515-1582, ist die eigentliche Reformerin des Ordens, Johannes vom Kreuz, mit den Lebensdaten 1542-1591, ist sein substantieller Theologe – und in Therese vom Kind Jesu (von Lisieux), mit den Lebensdaten 1873-1897, (1997 von Papst Johannes Paul II ebenfalls zur Kirchenlehrerin ernannt) ereignet sich das volle Ausdrücklichwerden des Ordens – sie finden im vielschichtigen Symbolwort Feuer ihr Wortbild!
Sie knüpfen damit an Elija und Mose an, deren zentrale Gottbegegnung unter dem Geheimnis von Feuer und verschwebendem Schweigen stehen. (Vgl. 1 Könige 19/ Exodus 3).
Teresa wird am 28. März 1515 in Avila geboren; gestorben ist sie am 4. Oktober 1582 in Alba de Tormes.
Als Papst Paul VI. Teresa von Avila zur Kirchenlehrererin ernannte, sicher auch der Anfang eines epochal neuen und vollständigeren Blickes der Kirche auf Frauen, da ernannte er sie ja zur Lehrerin für uns auf der Suche nach dem tieferen Sinn im Leben.
Den Weg, den sie da ging – dieser Weg ist viel komplexer und vielleicht deshalb uns heute nahe, näher, als allein das krönende Resultat, kirchlich ernannte „Heilige und Kirchenlehrerin“, erahnen lässt.
Teresa von Avila stammt aus einer jüdischen Familie, sie ist eine der conversos, eine Konvertitin in ihrem familiären Grund, deren Eltern eher dem massiven antisemitischen Druck in der Konversion sich beugten, bzw. ihren Tribut zollten (die Familie war 1485 in Toledo konvertiert – aber sie flohen, als beargwöhnte conversos, 1493 in das für sie anonymere Avila. 1492 wurden die Juden, 1502 die Muslime aus Spanien ausgewiesen; dies zum Zeitzusammenhang, der ausweist, in welch bedrängender Grundsituation sich ihr Leben und Glauben ausformt; ihre Brüder etwa wandern alle ins heutige Lateinamerika aus). Von ihrem Vater berichtet sie ob seiner großen Zuwendung zu Armen; ihre Mutter, die zweite Frau ihres Vaters, der Witwer aus erster Ehe war, bringt 10 Kinder zur Welt, ist ebenso wie Teresa von vielen Krankheiten heimgesucht und wird von Teresa als sanftmütig und von beachtlicher Intelligenz gekennzeichnet). Teresa (die als Mädchen damals erstaunlich reichen Zugang zur Bildung erhielt) selbst ist eine von Kindheit an um Gott und ihr Inneres ringende Frau (von früh an sind ihr die Worte „Himmel“, „immer“; „ewig“ wesentlich), oftmals hin- und hergerissen, auch (und gerade noch) nach dem Eintritt in den Karmel, das „Kloster der Menschwerdung (Encarnatión)“ in Avila, in dem sie fast 28 Jahre lebte.
Mit 20 Jahren tritt sie (auch aus Angst vor einer Verheiratung) am Allerseelentag 2. November 1535 in das Kloster ein, legt ein Jahr später ihre Profess ab und bleibt dort bis 1562/1563.
Ihr Lebensweg ist von zahlreichen, bisweilen chronischen, todnahen Krankheiten mit geprägt, mitunter fortwährend über mehrere Jahre (etwa ununterbrochen von 1538-1542).
Ihre mystischen Erfahrungen basieren auf dem Gefühl der Gegenwart Gottes, aus der ihre innere Gewissheit wächst: Gott ist da! Dies verstärkt sich ihr in der Erfahrung der Gegenwart Jesu Christi, mit dem sie in inniger Freundschaft verbunden ist (in der Weise „Inneren Betens“ und „Alltäglicher Lebensannahme“), der sie angstfreier macht; schließlich die Erfahrung der Einwohnung der in sich liebenden Dreifaltigkeit Gottes in ihr, Teresas, Selbst, im Jahr 1571, die sie als mystische Vermählung beschreibt in ihrer „inneren Burg“. Die inneren Erfahrungen bewegen zu äußeren tatkräftigen und ganz nüchternen Veränderungen, sie wird, gegen viele Widerstände der Kirche, Klosterneugründerin und reformiert, mit Johannes vom Kreuz, die Frauen– und Männerzweige des Ordens. Sie hält nichts von einem Rigorismus der äußeren rituellen Strenge, viel wichtiger ist ihr das menschliche Verständnis, die suavidad (Sanftheit) im Umgang miteinander. Dazu hilft ihr Jesus, der Freund, den sie als den wahren Menschen liebt, gerade auch in seiner Ohnmacht, Einsamkeit und Schwäche (Kenose). Sie fühlt sich in allem ihres Lebens von ihm und durch ihn verstanden und mit ihm verbunden. Von ihm her wird ihr inneres Beten zur Freundschaft mit Gott. Sie schreibt im 8. Kapitel (unter Abschnitt 5.) ihrer „Vida“: „Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher sind, dass er uns liebt.“
Das „Buch des Lebens“ schreibt Teresa im Auftrag ihrer geistlichen Begleiter (Beichtväter; vor allem die Dominikaner García de Toledo und Dominik Bánez)); sie beginnt es kurz nach ihrer tieferen und endgültigen „Bekehrung“, wie sie es selbst nennt (um die Jahre 1554/1555). Sie ist da fast 40 Jahre (sic!) und bereits fast 20 Jahre Nonne (Anm. Markus Roentgen: Allein darin liegt für uns Suchende und Glaubende und Zweifelnde heute ein großer Trost, ein Ahnung zu haben, wie lange und verschlungen Wege Gottes mit uns Menschen sein und werden können). Die erste Niederschrift datiert bis ins Jahr 1561, es folgen weitere Arbeiten daran bis ins Jahr 1566, so dass sie etwa 12 Jahre an der Abfassung des Buches arbeitet.
Ein Bild leitet die Wandlung ins Zentrum ihrer selbst ein. Um 1554 wird ihr das Anschauen eines Bildes des leidenden Christus zur Bekehrungserfahrung, in einer Zeit, da sie ihre Seele und sich selbst als müde und leer und ausgelaugt empfindet.
Christus der Schmerzensmann, der Schmerzensmensch rührt sie bis ins Mark.
Von diesem Bild her entsteht in ihr inneres Vorstellen des „Mit Jesus“ sein und leben – und zwar voll und ganz mit dem Menschen Jesus; vor allem in seiner Agonie, in seiner Betrübnis, in seiner Agonie am Ölberg und in der Passion.
Sie entdeckt, dass ihre bislang bereits vollzogene Praxis, innen zu beten, nicht nur Worte zu machen, daraus die stärkste Nahrung zieht, innerlich und im Vorstellen „Das Leben Jesu mit dem eigenen Leben zu Leben“ – und in diesem MIT großen Trost und klare Entschiedenheit zu finden (nie mehr ganz allein sein; den Jesus kennt und geht alle Wege mit).
Im Verweilen und fortschreitenden Mitgehen und Miterleben von Jesu Geschichte und in den Selbst-Erfahrungen damit, erschließt sich ihre eigene Geschichte als Jesusgeschichte; als Freundesgeschichte! So wird Lieben der Schlüssel zum Verstehen, mehr als jeglicher theologische Diskurs!
Eine starke zusätzliche Hilfe erfährt sie im Lesen der „Confessiones“ des Augustinus, dem sie besonders die Geduld Gottes mit dem suchenden Menschen, seine durchgängige Barmherzigkeit und Treue bis in die Abgründe hinunter Da, abgewinnt. Dazu die vestigia dei (die Spurenentdeckung Gottes in der gesamten Schöpfungswirklichkeit, die schon im letzten Satz ihres Prologes anklingt „…ihn mögen alle Dinge auf immer preisen. Amen.“ Darin ist der letzte Vers des 150. Psalmes (Vers 6) voll gegenwärtig: „Alles Atmen ist loben, oh DU“ (Übersetzung Markus Roentgen). Vgl. hierzu auch die beinahe parallel entstehende Konzeption aus Selbst-Erfahrung des Ignatius von Loyola in seinen „Geistlichen Übungen“.
Besonders Christus als den Menschen zu entdecken, in Beziehung und Beziehungen, in ihrem Innenraum, also die Imago Dei in jedem Menschen (vgl. Gen 1, 26 ff.) voll zu wahren, stärkt ihr Beten. Es ist eine Art fortwährender Imagination der imago dei. Sie wird ihr zu tieferem
Trost! In allen Anfechtungen und Niederlagen und Abbrüchen!
Und führt dazu; in den Verzweiflungen über das eigene Ungenügen, in allen Selbstanschuldigungen, von denen das Buch des Lebens (vielleicht auch aus taktischen Gründen im Blick auf den inquisitorischen Zusammenhang ihrer Zeit voll ist), in allem Versagen niemals an der tieferen und weiteren Liebe und Zuwendung und Barmherzigkeit Gottes zu verzweifeln! (Vgl. auch Benediktregel IV)
Und auch den Wohlgefühlen und der Wonne – bis in Eros, Selbstliebe und Zärtlichkeit mit sich selbst (vgl. Buch des Lebens X, Abschnitt 2) - große Bejahung und Achtung zuzumessen, als Beziehungsgeschehen in ihr selbst, in ihrer Gottesfreundschaft!
Nichts auslassen
„In Gottes Freundschaft durch und mit Jesus leben – das Beispiel der großen Terese des Karmel“
„Das Buch des Lebens“ der Teresa von Avila II
Berufung ist ein Ringen oft, selten eine Einbahnstraße ins Licht, mitunter ein Kampf auch in und mit Gott, aus dem Du nicht unversehrt heraus kommst
(vgl. Genesis 32, 23-33).
Teresas Weg nach ihrem Eintritt in das Karmeliterinnenkloster zur Menschwerdung ist von allen Höhen und Tiefen, Weiten und Engführungen menschlicher Existenz durchprägt.
Sie fühlt sich vom Bösen versucht, von der Einrede „Du bist hierfür ungeeignet!“ – und hilft sich, wie so oft im weiteren Gang ihres Lebens mit ihrer innigen Jesusfreundschaft. Ganz schlicht hilft ihr das, zu bestehen und sich gegen das Verzagen zu verteidigen: „Dagegen verteidigte ich mich mit den Leiden, die Christus durchgemacht hatte, weil es da nicht viel bedeuten würde, dass ich ein paar für ihn erlitt; und dass er mir schon helfen würde – so muss ich wohl gedacht haben.“ (Buch des Lebens 3, 6). So schreibt sie im Rückblick.
Das ist eine erstaunliche Medizin, die sie da findet.
Keine Lösungen in allem, vielmehr der Blick auf den, dem nichts wahrhaft menschliches fremd ist und der alles mitgeht, weil er Alles erfahren hat (bis zum Ölbergleiden, bis in die Gottverlassenheit und Antwortlosigkeit der Passion; vgl. auch den Eingang der Pastoralkonstitution des II. Vat. Konzils „Gaudium et spes“).
Sie beginnt ihr Klosterleben und erfährt es bis etwa in das 40. Lebensjahr nicht mehr als durchschnittlich. Die Struktur ist noch so wie vor der grundlegenden Reform des Karmelordens – eben durch Teresa, Jahre später (ad fontes). Teresa erkennt erst nach und nach, dass in den überkommenen Strukturen und Formen (mit vielen Adelsprivilegien und Ausnahmen starr und festgefahren) der Kern karmelitischen Lebens gefährdet war.
Ihr eigener Weg ist in diesen Strukturen und in ihren eigenen religiösen Formungen und Prägungen von vielen Umwegen, Krankheiten und Leiden, von Unverständnis und Borniertheit vieler Zeitgenossen durchsetzt.
In allem, und nichts an Lebenserfahrung wird im Buch des Lebens geschminkt oder geschönt oder weg poliert, ist die zentrale Lösung, die schon früh und keimhaft beginnt, die persönliche Beziehung zum Menschen Jesus aus Nazareth!
Das ist und bleibt wichtiger als der mystische Blitzeinschlag der fast orgiastischen Gottvereinigung.
Die Durchglühung zur Ekstase findet und hält (in den Abstürzen, die sie wie Hölle erfährt) nur und immer wieder durch die Rückbindung im inneren Beten, in dieser Einformung zur Umformung:
Und wo und wie bist du Jesus jetzt in deinem Leben eins meinem Leben und so Freundschaft und nie mehr allein, vielmehr in und mit Jesus mit Allen ALL – EINS!
Das ist schon früh ganz da! So nun der Blick auf das 3. Und 4. Kapitel im „Buch des Lebens“!
„Sobald ich eingekleidet wurde (am 2. November 1536, mit einundzwanzig Jahren für die damalige Zeit recht alt), gab mir der Herr bald schon zu verstehen, wie sehr er denen beisteht, die sich Gewalt antun, um ihm zu dienen, was bei mir jedoch keiner vermutete, sondern nur größte Bereitschaft. Sofort verspürte ich ein großes inneres Glück, in jener Lebensform zu stehen, das mich bis heute nie mehr verlassen hat, und Gott verwandelte die Trockenheit (Sequedad) meiner Seele in tiefste Beseligung.“ (Buch des Lebens Kapitel 3, 2)
Nun entfaltet Teresa die Wechselfälle ihres geistlich-leiblichen Lebens – und sie lässt nichts draußen. Ihr ist eine sehr erstaunliche Gabe eigen (bei allem Geschick auch gegenüber den Adressaten, die auch zur Gefahr werden konnten in Zeiten manifester Inquisition) des darin ungedeckten Schreibens!
Lust zum- und Abneigung gegen das Klosterleben.
Neid gegenüber im Beten reichen Schwestern.
Herzenskälte – ohne einen Affekt selbst gegenüber der Passion Jesu.
Eitelkeit und bloß äußerliches Beten.
Krankheiten aller Art (Fieberschübe, Ohnmachtsanfälle etc.), bisweilen psychosomatisch über Jahre.
Erste Aufhilfe und Lebensfreude über gute Bücher (etwa das Geschenk ihres Onkels, der ihr das Buch des „geistlichen Abc“ des Franziskaners Francisco de Osuna oder die „Briefe des Hieronymus“ gibt).
Zwangserfahrung(en) äußerlich und in ihr selbst.
Harte Einsicht „dass nämlich alles nichts sei, und die Vergänglichkeit der Welt, und wie es mit ihr in kurzer Zeit zu Ende wäre“. (Das Buch des Lebens 3. Kapitel, 5)
Aufhilfe gegen die Härten und Qualen des Klosterlebens durch Anschauen der Leiden, die Christus durchgemacht hat (vgl. 3, 10).
Immer wieder Rückfälle und tiefe Krisen.
Die Erfahrung: Jesus Christus ist der Arzt (Heiland); ein Motiv, dass Augustinus und die Kirchenväter früh einführten: Das „Christus-Medicus-Motiv“.
Sie ist im Kloster und hat keine Gottesliebe über längere Zeit! (vgl. 4, 1).
Aber auch: Spuren inneren Glücks; Verwandlungen durch Gottes Zuwendung aus innerer „Gott-Trockenheit“ in „Gott-Beseligung“ (4, 2).
Freude an alltäglichen Arbeiten; z. Bsp. Putzen.
Guten Eingebungen eher folgen, als schlechten; auch wenn die guten Eingebungen oft an den eigenen Umsetzungsmöglichkeiten scheitern. Dran bleiben! Mit der allerkleinsten Gnade leben! (Vgl. Peter Faber Sj, Memoriale).
Die eigene Zurückweisung der Gnade Gottes schmerzlich empfinden – und sich dennoch nicht abwenden oder wegducken. Viele resignieren an Gott, weil sie sich selbst ablehnen, hässlich und unwürdig, schlecht und klein fühlen.
Die Gnade kann immer mehr! (Vgl. 4, 3).
Üben: Gebet der Ruhe-Sammlung (Oración de quietud); Gebet der Gotteinung (Oración de unión); Gebet des Verstandes und des Nachsinnens und Lesens (Oración mental), Gebet der inneren Vorstellungen (Tener oración) – also eine Vielzahl von Formen aufsuchen, auch wenn noch keine wirklich durch trägt.
Die Emotionen bedeutsam finden, etwa die kostbare „Gabe der Tränen“!(vgl. 4, 7).
Einen Lehrmeister und Geistlichen Begleiter suchen – oder auch bewusst entbehren (beides kann dienlich sein).
Sich mit Jesus, dem Menschgewordenen innerlich verbinden; seinen Weg mitgehen, wie er in der Heiligen Schrift vergegenwärtigt wird (Heilsereignisse – den Weg Jesu mit dem eigenen Leben leben; mein Leben als der Weg Jesu – immer ist mehr Innung als Trennung)!
Seine Schwächen im Diskursiven, in Wille und Vorstellung nüchtern wahrnehmen; zur Not wieder anfangen mit Lesen!
Wenn ich nicht innen beten kann; dann ein gutes Gebetbuch lesen und im Lesen das Alleinesein üben.
Das sind die Anfänge Teresas (und so über fast zwanzig Jahre im Kloster). Welch ein Trost für uns!
Sie schreibt, „ich war so armselig (Ruin), dass mir alle meine Entschlüsse wenig nützen, obwohl sie mir in den Tagen, als ich Gott diente, eine große Hilfe waren, um die schrecklichen Krankheiten, die ich durchmachte, ertragen zu können. …“(4, 9).
Und doch und in alledem dann der große Bekenntnissatz,
in alledem den langen Atem der freundlichen und durch alles hindurch liebenden Gegenwart Gottes, diese Ökonomie Gottes zu erahnen!
„Er (Gott) sei für Alles gepriesen! (Das Buch des Lebens Kapitel 4, 10.)