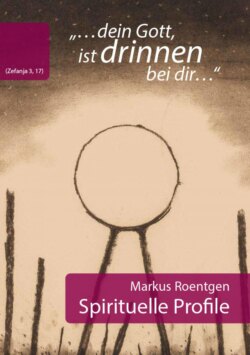Читать книгу "dein Gott, ist drinnen bei dir" (Zefanja 3,17) Spirituelle Profile - Markus Roentgen - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление„Narren in Christo –
die Briefe des Apostels Paulus
an die Korinther und deren Folgen“
Erläuterungen zur Narrheit in den Briefen des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Korinth und im Leben Jesu
Paulus schreibt im 12. Kapitel seines 2. Briefes an die Gemeinde in Korinth, in den Versen 9-11: „Aber er (Jesus Christus, der Herr) hat mir erklärt: ‚Es genüge dir meine Gnade; denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet.‘ Sehr gern will ich mich also um so mehr meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi sich auf mir niederlasse. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Notlagen, an Verfolgungen und Bedrängnissen um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Ein Tor bin ich geworden; ihr habt mich dazu gezwungen.“
Wenn Paulus sich und die Jüngerinnen und Jünger Christi als Narren in Christo ( vgl. 1 Kor 4, 10) bezeichnet, wenn Nachfolge Christi, konsequent gelebt, immer auch etwas Narrenhaftes, Anstoßerregendes, Skurriles, ja Komisches, Ex-zentrisches innewohnt, dann liegt abgründig darunter der Narr Jesus Christus selbst!
Schon in den Heiligen Schriften Israels gibt es prophetische Wahrnehmungen, denen anscheinend Törichtes anhaftet, etwa in Hosea 9,7: „Der Prophet ist ein Narr,/ der Geistesmann ist verrückt.“
Paulus nimmt dies auf in den Kern seiner Christusrede (1 Kor 1, 18-25; 3, 18; 4, 10), seiner Narrenrede (2 Kor 11, 16-30; aber auch in der lukanischen Sicht auf Paulus zum Ende der Areopagrede in Athen (Apg 17, 18. 32; 26, 24).
Immer, wenn es um den Erweis des Göttlichen in Jesus, dem Christus, geht – und dazu das Hindurchgehen durch Leiden, Kreuz und Tod als notwendig verkündet wird, damit Auferstehung wirklich wird, sei es im Leben Jesu der Evangelien, sei es in der Verkündigung des Paulus, korrespondiert eine Form der Rezeption in der Weise der Verspottung, Verhöhnung, der Zuschreibung des Verrückten, Törichten, Narrenhaften.
Beispiele: Über Jesus heißt es Mk 3, 21: „Er ist von Sinnen.“ Jesus selbst verkündet: „Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den Unmündigen geoffenbart.“ (Mt 11, 25)
Von Paulus heißt es in Apg 17: „Was will denn dieser Schwätzer?“ (Apg 17, 18); etwas weiter wird er ob seiner Predigt des von den Toten Auferstandenen „verspottet“ (Apg 17, 32). Als er von der Notwendigkeit des Leidens Christi spricht, der als erster von den Toten auferstanden sei und dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden werde, schreit einer der Zuhörer, Festus: „Du bist verrückt.“ (Apg 26, 24).
Theologisch kulminiert dies in Versen aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther (Verse 1, 18-28) :
„Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die zugrunde gehen: Aberwitz (Torheit). Denen aber, die gerettet werden, ist es: Gottes Kraft.
Es ist ja geschrieben:
Zugrunde richten will ich die Weisheit der Weisen; und den Verstand der Verständigen will ich entmachten.
Wo bleibt da ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wahrheitsforscher dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zum Aberwitz (zur Torheit) gemacht? Denn nachdem die Welt – angesichts der Weisheit Gottes – durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott: durch den Aberwitz (die Torheit) der Verkündigung die Glaubenden zu retten. Nachdem Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, verkünden wir dagegen einen gekreuzigten Messias; den Juden: ein Ärgernis; den Völkern: ein Aberwitz (eine Torheit). Ihnen aber, den Berufenen – Juden wie Griechen – den Messias: Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn: der Aberwitz (die Torheit) Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes stärker als die Menschen.
Blickt nur auf eure Berufung, Schwestern und Brüder! Das sind dem Fleisch nach nicht viele Weise, nicht viele Kraftvolle, nicht viele Hochgeborene. Doch das Aberwitzige (Törichte) der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Niedriggeborene der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt; das Nichtige, um das Wichtige abzutun -…“
Folgen – Rezeption –
Narren in Christo9 und das tiefere Spiel der Narrenfreiheit
9 Vgl. hierzu grundlegend: Hans Urs von Balthasar, Narrentum und Herrlichkeit : Ders., Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Band III, 1 Im Raum der Metaphysik. Teil II. Neuzeit, S. 492-551. Erzählender: Walter Nigg, Der christliche Narr. Zürich 1956. Strukturalistisch, psychologisch und philosophisch durchdringend: Michel de Certeau, Kloster und Marktplatz: Narrheiten in der Menge : Ders., Mystische Fabel. Berlin 2010, S. 54-80. Vgl. auch Harvey Cox, Das Fest der Narren. Das Gelächter ist der Hoffnung letzte Waffe. Stuttgart-Berlin 2/1970. Vgl. auch als Roman: Gerhart Hauptmann, Der Narr in Christo Emanuel Quint. (=Ullstein Tb 23446). Berlin 1994.
Heilige Närrinnen und Narren finden sich in der Tradition und transformiert als Narren und Närrinnen in Christo in Folge der paulinischen Verkündigung und der Evangelien Jesu Christi ab etwa dem 4. Jahrhundert n. Chr.
Namen: Symeon von Edessa und Andreas der Narr – oder alles, was tief ist, liebt die Maske. Jacopone da Todi – oder der Tor göttlichen Liebens; Philipp Neri, der Spaßmacher Gottes, Erasmus von Rotterdam mit seinem Lob der Torheit – und dann die epochalen Figuren aus Literatur und Kunst: Cervantes „Don Quichote“, Dostojewskijs „Idiot“; früher noch Wolframs „Parzival“ bis zur darstellenden Kunst: Rouault’s Christus als Clown – später auch von Litzenburger so gemalt.
Certeau schildert eine der frühesten Gestalten, eine namenlose Frau (mitunter wird sie auch Isidora genannt werden) aus dem 4. Jahrhundert.
Die Narren in Christo sind Menschen, die Kontrastfiguren ausbilden. Sie widersprechen in Gestalt und Haltung dem antiken Schönheits- und Weisheitsideal, welches die Menschengestalt an den heroischen Göttergestalten orientierte.
Heilige Narren/ Närrinnen kontrastieren das Bild des Heiligen als Held/ Heldin!
Eine neue Gestalt springt hervor aus der Nachfolge des Jesus, der als menschgewordener Gott die klassischen Kategorien von Oben und Unten umkehrt; der unermessliche Gott als hilfloser Säugling in der Futterkrippe; der, aus dem der Kosmos und das Allsamt wurde, der ewige Logos, das unendliche Wort, gegeißelt und verspottet, ein Narr Gottes am Kreuz, erleidet den schändlichen Tod eines daher gelaufenen Straßenräubers, den Verbrechertod eines „Gotteslästerers“, der zuvor seinen geliebten Freundinnen und Freunden zärtlich begegnet, der ewige und heilige Gott wäscht, in Knechtsgestalt, seinen Schülern und Jüngern die Füße und erweist Lieben bis zum Es-Geht-Nicht-Mehr (vgl. Joh 13).
Die daraus sich her leitenden Narren in Christo sind, von da her, „nie ganz ‚bei Sinnen‘ und ‚bei sich‘ (…. Dem rechten Narr) „fehlt das Schwergewicht, das ihn nieder zur Erde fesselt. Er steht dem Heiligen am nächsten, näher oft als der seine Vollkommenheit pflegende, moralisch geglückte Mensch. Die Russen wussten, dass der Narr Gott gehört, seinen eigenen Engel hat, ehrwürdig ist. (…) Heilige, auf den Stapfen des verachteten, geschmähten, als wahnsinnig (Mk 3, 21) und besessen (Mt 12, 24; Joh 7, 20; 8, 48) erachteten Jesus, sehnen sich danach, um seinetwillen für Narren angesehen zu werden. (…) Äußere Gebärden, die sie tun müssen, wie die Selbstentkleidung des Poverello (Franz von Assisi; Anm. Roentgen), können schon so gedeutet werden. Ihm riefen die Kinder ‚il pazzo‘ (der Verrückte; Anm. Markus Roentgen) nach, auf dem Portiuncula-Kapitel, unter Anwesenheit des Kardinals von Ostia, eröffnete er den Brüdern, dass der Herr ihm gesagt habe, er ‚solle ein Tor sein in dieser Welt‘, und dass Christus sie alle keinen anderen Weg als den dieser Weisheit führen wolle. (…) Manche, die sich mit Paulus anbieten, anstelle der Brüder von Gott weggeflucht zu werden (Röm 9, 3), werden in die Abgründe getaucht: nicht nur der Gottverlassenheit (wie Jesus selbst; Anm. Markus Roentgen; vgl. Mk 15, 34) (…) Für abschließend können die Formeln Ignatius‘ von Loyola gelten, der bei der ersten Leben-Jesu-Betrachtung sogleich den Finger auf die Nachfolge ‚im Ausstehen alles Unrechts und aller Schmach und aller Armut‘ legt, auf dem Höhepunkt der Einübung in eine gelassene Lebenswahl , die vollkommene Demütigung‘ fordert, die darin besteht, dass ich ‚jemehr mit dem armen Christus Armut wünsche und erwähle als Reichtum, jemehr mit dem schmerzerfüllten Christus Schmach als Ehrenerweise, und jemehr danach verlange als ein Tor und ein Narr angesehen zu werden um Christi willen, der zuerst als ein solcher angesehen wurde, denn für weise und klug in dieser Welt.‘ “10
10 Hans Urs von Balthasar, Narrentum und Herrlichkeit, a.a.O, S. 494 f
Es sind auch immer Wege aus der etablierten Kirche, aus Gemeinde und Kloster in die Wüsten des Lebens, der Städte, der Umstände (etwa bei Symeon dem Narren). Der Büßernarr Jacopone da Todi (gest. 1303), ein gebildeter Doktor der Rechte und Advokat, beschließt in Folge des Franziskus von Assisi, freiwillig als Narr aufzutreten. Die Ekstasis seiner Vernunft, diesem Heraus-treten, öffnete sich bislang unerhörter Poesie, Gesänge an Gottes verstörte und verstörende, ja ver-rückende und in den Augen der „Welt“ ver-rückte Liebe.
Gott, der uns allen die Füße wäscht!
Dieses Lieben Gottes sprengt jegliches Warum, öffnet ins Unermesslich-Maßlose, setzt sich aus: Aussetzung des Allerheiligsten bis in die Torheit sich hin-gebenden Liebens bis zur Durchstoßung, bis zur Durchkreuzung aller menschheitlich weisheitlichen Tradierung!!!
Jacopone da Todi singt „Gütigsein kennt kein Warum“: „Hinfälligkeit alles Irdischen bis zum All-Totentanz, Herrlichkeit der Gottesliebe bis zur franziskanischen All-Umarmung der gottgeliebten Kreatur, Eintauchen in bodenlose Tiefen des Gottwesens …“11
11 Ebd., S. 497.
Ich beschließe den Beitrag mit einer Närrin aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Überliefert ist diese Passage aus der „Historia lausiaca“, mit der diese erste Närrin (salé) eingeführt wird, von Michel de Certeau12, der auch einen profunden Kommentar zu dieser Geschichte formuliert hat – daraus abschließend einige Erhellungen:
12 Michel de Certeau, Mystische Fabel, a.a.O., S. 56 ff.
„In jenem Kloster war auch eine Jungfrau, die sich den Anschein gab, als ob sie verrückt und besessen sei. Darum hegte man allgemein solche Abscheu vor dieser, dass keine mit ihr essen wollte; sie aber hatte das freiwillig auf sich genommen. Sie irrte in der Küche umher, tat jede Arbeit, war sozusagen das Wischtuch des Klosters und erfüllte so, was geschrieben steht: ‚Dünkt sich jemand weise zu sein unter euch, der soll ein Tor werden, auf dass er weise werde!‘ Mit einem Lumpen hielt sie den Kopf umhüllt, während die anderen geschoren waren und Kapuzen trugen. So war sie angetan und versah den Dienst einer Magd. Keine von den vierhundert sah sie jemals essen, während der vielen Jahre; sie setzte sich niemals zu Tische, genoss kein Stücklein Brot mit den anderen und war mit den Krumen vom Tisch und mit dem Wasser aus den Kochtöpfen zufrieden, das sie beim Spülen fand. Sie kränkte niemanden, murrte nicht, sagte weder viel noch wenig, obgleich sie beschimpft, geschlagen, verwünscht und verächtlich behandelt wurde.
Es lebte zu jener Zeit am Porphyrgebirge der heilige Piterum, treubewährt in tugendhaftem Wandel. Zu diesem trat ein Engel und sagte: ‚Was bist du stolz auf deine Frömmigkeit und dein weltfernes Leben? Willst du ein Weib sehen, das frömmer ist als du, so geh nach dem Frauenkloster der Mönche von Tabennese! Dort wirst du eine finden, die einen Lumpen um den Kopf gebunden hat: diese ist besser als du; denn obgleich sie von dieser Menge alle Unbill erfährt, hat sie niemals ihr Herz von Gott gewendet; du dagegen sitzest hier, deine Gedanken aber schweifen in den Städten umher.‘ Obgleich er niemals die Zelle verlassen hatte, begab er sich zum genannten Kloster und bat die Lehrer, ihm den Eintritt zu gestatten. Ob seines ausgezeichneten Rufes und hohen Alters trugen sie kein Bedenken, ihn einzuführen. Er ging also hinein und wünschte alle zu sehen. Doch jene war nicht dabei. Er sagte zuletzt: ‚Stellt mir alle vor; es fehlt noch eine.‘ Sie sagten: ‚Eine haben wir noch drinnen in der Küche; aber die ist närrisch (salé).‘ Er sagte: ‚Führt sie herein; ich möchte sie sehen.‘ Sie gingen hinaus und sagten es ihr; doch sie weigerte sich; sie ahnte wohl, dass ihr Geheimnis verraten werde. Die anderen aber zogen sie mit Gewalt und sagten:‘ Der heilige Piterum wünscht dich zu sehen.‘ Sein Name war nämlich überall bekannt. Als er sie nun mit dem Lumpen am Kopf eintreten sah, fiel er ihr zu Füßen und sagte: ‚Segne mich!‘ Ebenso fiel ihm jene zu Füßen und sagte: ‚Segne du mich, Herr!‘ Da gerieten alle außer sich und sprachen zu ihm: ‚Vater, lass dich doch nicht zum besten halten! Sie ist ja närrisch!‘ Da sagte Piterum zu allen: ‚Ihr seid närrisch; denn sie ist meine und eure Mutter – so nennt man jene, die ein Leben des Geistes führen -, und ich wünsche nur ihrer würdig befunden zu werden am Tag des Gerichtes.‘ Als sie das hörten, fielen sie jener zu Füßen, und jede gestand ein anderes Vergehen: die eine, sie habe sie mit Spülwasser begossen; die andere, sie habe sie geschlagen, so dass sie blaue Flecken bekam; wieder eine andere, sie habe ihr die Nase mit Senf bestrichen; kurz, jede hatte auf andere Weise tollen Übermut getrieben an ihr. Da betete Piterum für alle und ging. Weil aber jene nicht Ruhm und Ehre bei den Schwestern genießen wollte und die vielen Abbitten lästig fand, entwich sie nach wenigen Tagen aus dem Kloster. Wohin sie ging, wo sie sich verbarg und wo sie gestorben ist, hat niemand erfahren.“13
13 Michel de Certeau Zitiert nach: Palladius von Helenopolis (gestorben vor 413 n. Chr.), Leben der Väter (Historia lausiaca).
Michel der Certeau kommentiert: „Eine Frau also. Nie verlässt sie die Küche. Nie hört sie auf, etwas zu sein, was mit Nahrungszerkleinerung und –abfall zu tun hat. Davon ernährt sie ihren Körper. Sie lebt davon, dass sie nichts ist als dieser verächtliche Gegenstand, das ‚Nichts‘, das Abschaum ist.“ (Vgl. hierzu auch Paulus in
1 Kor 4, 12 f., wo „Kehricht der Welt, Ab-schaum“, der Schmutz aller zu werden Form der Nachfolge des Lebens Christi, göttliches In-Der-Welt kennzeichnet: „ Geschmäht werden wir und lobpreisen; gejagt werden wir und halten aus; verleumdet werden wir und ermutigen. Wie aus der Welt Ausgestoßene sind wir geworden; Abschaum für alle – bis jetzt.“ (1 Kor 4, 12 f. – Anm. Markus Roentgen).
Certeau kommentiert weiter: „das ist es, was sie ‚vorzieht‘: der Schwamm zu sein. Um den Kopf hat sie einen Lumpen gewickelt, zwischen ihr und dem Abfall besteht kaum ein Unterschied, sie ‚isst‘ nicht, nichts trennt ihren Körper vom Müll. Sie ist dieser Rest, endlos, unendlich. (…) ist die Verrückte ganz und gar in dem symbolunfähigen Ding, das der Sinngebung Widerstand leistet. Sie nimmt die bescheidensten Funktionen des Körpers auf sich und verliert sich im Unerträglichen, das noch unter aller Sagbarkeit ist.“14
14 Ebd., S. 57.
Umkehrung Gottes zur Welt (Weihnachten – Karfreitag, Karsamstag; Trog und Schandkreuz), Umkehrung von oben und unten auch hier im Text.
Der verehrte Mönch Piterum auf der Höhe, ein spiritueller Aufsteiger – sein Ort, das Porphyrgebirge; er muss aufs Geheiß des Engels absteigen zur namenlosen, diese Frau unten, Küchenexistenz, Abfallwesen.
Das Ver-rückte von Ostern kann nur erahnt werden aus solchen Umkehrungen der gewohnten religiös-spirituellen Sichtungen: „töricht werden, um Weise zu werden“ (Paulus 1 Kor 3, 18).
Und in nochmaliger Steigerung die nochmalige Weigerung der Närrin: Sie lässt sich nicht einbinden in ein „Aschenputtel-Happy -End“, nachdem Piterum sie erkennt, vor ihr kniet und sie als „Heilige“ enttarnt vor den Mitschwestern. Sie entzieht sich. Sie bleibt die namenlose nur Gottalleinbezogene; unbedingte Verweigerung jeglicher Anerkennung als Heilig mitten in Welt! Sie entzieht sich der österlichen Wendung in den Augen der Welt aus Kloster, Kirche und „heiligem Mann“!
Sie geht aus der Geschichte, aus dem Symbolzusammenhang, aus der Signifizierung heraus. Ihr Grab ist unbekannt!!!
Gänzlicher Ex-zess (Außer Sich) – Nicht-Ort!
„Diese Frau kann nicht da sein – da, wo sie der Diskurs der Gemeinschaft hinstellt.“15
15 Ebd., S. 65.
Die Torheit dieser Frau beharrt auf der Nichtinklusion ihrer ex-zessiven, ek-statischen Gottbindung zu den etablierten Konventionen, Ritualen, Symbolisationen, Kommunikationsformen von Kirche und Welt.
Sie ist die Irritation schlechthin zu jeglicher Gottgewissheit, sie ist das Gott offen nackt und bloß ohne Rückversicherung, Nachfolge der radikalen Selbstentblößung Gottes, Aussetzung Gottes im Wahnsinn des Liebens bis zum Ex-zess an das Weltganze: Krippe, Leiden, Kreuz – Torheit Gottes zum Tor für alle Welt: unverfügbar, unvermittelbar: Ostern –
Literatur:
Michel de Certeau, Mystische Fabel, Berlin 2010, S. 54-80.