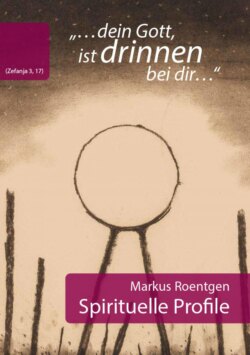Читать книгу "dein Gott, ist drinnen bei dir" (Zefanja 3,17) Spirituelle Profile - Markus Roentgen - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление„Stört die Liebe nicht…“
Eine spirituelle Lesehilfe zum „Hohen Lied der Liebe“
Kein Buch der Heiligen Schrift hat Phantasien so beflügelt wie das Lied der Lieder.
Oberfläche, Unterschicht, Tiefenschicht – was ist gemeint darin? Das hat die Menschen bewegt, argwöhnen lassen.
Schiere Erotik! Schönstes Erotisches in Bildern, Lauten, Gerüchen, Tiervergleichen, bis hin zum anziehendsten Benennen weiblicher und männlicher Sexualität.
Kraftquelle des Erotischen, Sehnsuchtsstöhnen – als Ausdruck der tiefsten Gotteslust im Menschen.1
1 S. Teresa von Avila, Bernhard von Clairvaux, Thomas von Aquin etc.
Nur ein Beispiel der Analogie:
Teresa von Avila, Das Buch meines Lebens, Kap. 10, 2: „Vorher schon hatte ich sehr anhaltend eine Zärtlichkeit empfunden, die man sich meines Erachtens teilweise in etwa selbst verschaffen kann: eine Wonne, die weder so richtig ganz sinnlich, noch richtig geistlich ist. Zwar ist alles von Gott geschenkt, doch sieht es so aus, als könnten wir zu letzterem viel beitragen…“2
2 S. 172f.
Und weiter: „…so ist es auch hier, dass sich Gott und die Seele schon allein deswegen verstehen, weil seine Majestät will, dass sie es versteht, ohne dass sich die Liebe, die diese beiden Freunde zueinander haben, durch einen sonstigen Kunstgriff kundtun muss. So wie hier auf Erden, wenn sich zwei Menschen sehr gern haben und gut verstehen, nur indem sie sich anblicken. So muss es hier sein, denn ohne dass wir sehen wie, blicken sich diese beiden Liebenden fest in die Augen, wie der Bräutigam des Hohenliedes zur Braut sagt; wie ich glaube, gehört zu haben, steht das dort.“ 3 Teresa tarnt sich, sie, die einen großen Kommentar zum Hohen Lied geschrieben hat, stellt sich als Ungebildete dar („wie ich glaube, gehört zu haben, steht das dort“); sie weiß, dass die Inquisition mit liest, wenn sie ihre „Vida“ aufschreibt. Natürlich kennt sie die Stelle, die sie imaginiert: Hld 4, 9: „Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut; ja verzaubert mit einem Blick deiner Augen.“ – In Teresas Kommentar selbst („Gedanken über die Liebe Gottes – Meditationen zum Hohelied, 4,8) zitiert sie nachdrücklich Hld 6,2 und 2, 16: „…das ich meinen Geliebten anblicke und mein Geliebter mich; und dass ich nach seinen Angelegenheiten sehe und er nach den meinen“ – sie tarnt sich in Unwissenheit, denn sie weiß, dass das Hohe Lied verdächtigt wurde und als „gefährlich“ galt.
3 Ebd., Kap. 27, 10; S. 391.
Die allegorische Deutung begann im 1. Jhdt. vor Christus; als „Lied des Salomo“ wurde es zusammen gefügt mit dem „Buch der Sprüche“ und dem „Buch Kohelet“ und so als Weisheitsbuch gelesen.
Daraus erfolgte, was das Christentum übernahm und systematisierte – ein Deutungsschema für lange Zeit:
Sprüche – Ethik
Kohelet – Naturerkenntnis
Hohes Lied – Erkenntnis des Ewigen und Unsichtbaren
Höchste Weisheit muss sich bergen und verbergen in Bildern und Vergleichen; das Gemeinte muss „über-setzt“ – also „hinüber gesetzt“, ans andere Ufer gebracht werden.
Daraus resultierte die heilige Hochzeit von Gott (unaussprechlich Jhvw// Jhwh) und seinem Volk Israel.
Ein Ringen um die legitime Deutung entsteht. Die Rabbinen streiten, Rabbi Aqib nennt es „das heiligste (qodesh qodashim) aller Schriften.“4
4 Vgl. Das Hohelied Salomos, übersetzt und kommentiert von Klaus Reichert. Salzburg 1996, S. 6.
Liturgisch wurde das Hohelied an das Ende der Passah-Liturgie gesetzt als Verheißung der Rückkehr aus dem Exil. In der katholischen Liturgie heute findet das Hohelied 13mal Verwendung (aus Kapitel 2; der Anfang von Kapitel 3, Verse aus Kapitel 4 und 8); zumeist bei „Jungfrauweihen“ und Ordensprofessen, für Ordensleute, bei Trauungen, beim Fest der Maria Magdalena (22.7), der Scholstika (10.2) – und am 21. Dezember, vielleicht dort zum Ausdruck der unmittelbar bevorstehenden Menschwerdung Gottes als Gottwerdung des Menschen im „Unvermischt und Ungetrennt“ des Geschehens in Jesus Christus.
Das Christentum identifiziert den Bräutigam (der im Hohenlied nie so genannt wird; sondern „Geliebter“ o.ä.) mit Christus; die Braut wurde „seine Kirche“.
Die Allegorien steigerten sich: die Kirche, Maria, die Bräute Christi, die Seele, die Menschheit – alle wurden heran gezogen, um sich mit Christus als Logos und Grund und Ziel zu verbinden und so erst das Wort lebendig werden zu lassen.5
5 Vgl. Origines, Bernhard von Clairvaux, Wilhelm von St.Thierry.
Vom Sprachduktus her ist das Hohelied eine locker gefügte Sammlung von Liebesliedern. Ohne bindenden Redaktor, deshalb auch stets in der Möglichkeit, in den Passagen und Strophen neu gruppiert, konstelliert zu werden. Topoi: Wiederholungen, Prahl-, Scherz-, Klage- und Sehnsuchtslieder. Hochzeitscarmina (wie für ländliche Hochzeiten verfasst. Projektionen einer Minne zwischen Hohem Herrn und Hirtenmädchen)6 Es ist aufgeschrieben worden wohl zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert v. Chr. Wortfindungen darin aus dem Hebräischen, Aramäischen, Persischen bis zu einem griechischen Wort (Hld 3, 9).
6 Vgl. bis zu Mozarts Opern; etwa „Figaros Hochzeit“ oder „Don Giovanni“). Fruchtbarkeitskulte gehen ein (sumerische, akkadische, syrische.
Der Text: Ein vielstimmiger Klangkörper! Echos! Hochkultur!!!
Schauplätze: Judah, Jerusalem, En Gedi und ein Teil im Nordreich Israel, das 721 fiel (Libanon, Antilibanon, Scharonebene, Karmel, Gileadgebirge usw.).
Immer neu: dieses Suchen im Hohenlied von etwas, was mich im Innersten elektrisieren, erbeben, erzittern lässt – der Ungrund, das Bodenlose des Liedes – das, was ich nicht begreife, das tiefere Nichtverstehen!
Lieben ist nicht zu verstehen!
Wie Traumsequenzen, wie ungleiche Dialoge, wie Tasten und Stammeln und doch in höchster Sprachkraft immer neu: Du bist unermesslich – Lieben.
Körper – auf und ab in allen Sequenzen und Nuancen, betastet beschrieben, als sei es eine Erkundung ohnegleichen! Atem spürbar in jeder Zeile, Hecheln, nach Luft ringen, atemlos – und auch das Gleichmaß (selten) im Atmen des Liebens.
Alles wird fundiert im Körperlichen! (Horchen, Augen-Blicke, Riechen, Düfte, Schmecken, Tasten, Fühlen).
Morgenländische Düfte, verschwindend-präsent. „Sprachgliedmaßen“ hat dies Moses Mendelssohn wunderbar genannt.7
7 Vgl. Reichert, a.a.O., S. 10.
Es ist klar: Das Hohelied kommt aus dem lebendigen Sprechen und Singen, lange bevor es Text wurde. Nur Buber/ Rosenzweig achten dies in ihrer Übertragung – allen anderen Übersetzungen haftet ein Zwingendes an in ihrer Kohärenzfixierung, Lücken schließen zu wollen.
Das Hebräische (bis zu Maimonides) selbst war lange Zeit gar nicht zu Abstraktionen fähig; alles wurde sinnlich, geschichtlich konkretisiert! So ist etwa „Nefesch“ nicht „Seele“, vielmehr „Kehle“ „Atem“ im Ursprung!
Das Mädchen sucht den Geliebten nicht mit der Seele, vielmehr „mit atmendem Leib“!
Es gibt den unerschöpflichen Zugang so frei, die Freiheit gleich-gültiger Möglichkeiten im Zugang zum Hohenlied!
Das Fragmentarische ist schön! Darin atmet der Rausch des Unverhofften!
Und jenes: Es fehlt mir (uns) immer (noch) etwas!
Als der Heilige Thomas von Aquino sich im Winter 1273/1274, auf dem Weg zum Konzil von Lyon, zum Sterben legte, nach einem Winter tiefen Schweigens als Folge seines Abbruchs der „Summa theologica“ (er hatte seinem Freund und Schreiber Reginald, der ihn zum Weiterschreiben drängte, gesagt: „Reginald, ich kann nicht. Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir vor wie Spreu“), da wollte er nur mehr das Hohelied vernehmen8 – eine Ahnung, in der schönsten Sprache des Eros, einer unendlichen liebenden Vereinigung als Gottgeschöpf, die im Sehnen und Begehren und Freien und Zarten und Lieben der Sprache des Leibes, der Hände, Zungen, Glieder, des Geschlechtlichen, der Haut und unseres Gehirns, vielleicht, das stärkstes vitale und konkrete Zeichen des Kommenden ist.
8 Vgl. Thomas von Aquin, Sentenzen über Gott und die Welt, zusammengestellt, verdeutscht und eingeleitet von Josef Pieper. Johannes Verlag Einsiedeln, 1987, S. 38 ff.
Leer ist
das Blatt
weiß
und
an den Rändern
mohnstark
eine einzelne
atmende
eine Blüte
du
Markus Roentgen
Literatur:
Johann Gottfried Herder, Lieder der Liebe (= Insel Taschenbuch 2643). Frankfurt/M. 2000. Das Hohelied Salomos, übersetzt, transkribiert und kommentiert von Klaus Reichert. Residenz-Verlag. Salzburg und Wien 3/1996. Teresa von Avila, Das Buch meines Lebens. Herder-Verlag. Freiburg i. Br. 2001.