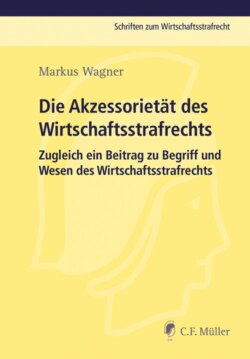Читать книгу Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts - Markus Wagner - Страница 63
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(1) Die Einheit der Rechtsordnung innerhalb einer Ebene
Оглавление96
Fragt man nach der Einheit einer Rechtsordnung im Sinne ihrer Widerspruchslosigkeit, setzt dies zunächst einmal Klarheit darüber voraus, welches überhaupt die Bestandteile dieser Rechtsordnung sind. Maßgebliches Abschichtungskriterium ist hierbei die rechtssetzende Instanz: Eine Rechtsordnung wird aus all denjenigen Normen gebildet, die auf denselben Rechtssetzer zurückzuführen sind.[231]
97
Ist die Identität der rechtssetzenden Instanz aber das prägende Kriterium zur Begründung einer bestimmten Rechtsordnung, so muss dieser Aspekt zugleich den Ausgangspunkt für Erwägungen hinsichtlich ihrer Einheit darstellen:
Gehen alle Normen eines Systems von ein und derselben rechtssetzenden Instanz aus, sind – grds. zunächst unabhängig vom konkreten politischen System – alle diese Normen dessen Willen zuzurechnen. Da es sich aber beim Normgeber um eine Einzelerscheinung handelt, muss dieser Wille notwendig einheitlich sein. Dies gilt jedenfalls insoweit, als der Wille in Form von Rechtssetzung geäußert wird. Durch ein Gesetz oder einen anderen Akt der Rechtssetzung bringt der dazu Berufene seinen (aktuellen) Willen bzgl. einer oder mehreren bestimmten inhaltlichen Frage(n) zum Ausdruck.
98
Ändert der Rechtssetzer seine Auffassung und möchte diese Veränderung auch mit Außenwirkung versehen, muss er dies erneut durch einen Rechtsakt deutlich machen. Dabei ist er jedoch nicht darauf angewiesen, zwangsläufig die betroffene Norm zu ändern. Hatte er beispielsweise eine bestimmte Summe gewisser Verhaltensweisen mittels einer sehr allgemein gehaltenen Formulierung umschrieben und diese für rechtswidrig erklärt, muss er, um einen bestimmten Teilausschnitt dieser Verhaltensweisen wieder vom Stigma der Rechtswidrigkeit zu befreien, nicht unbedingt den Anwendungsbereich der früheren Norm einschränken, sondern kann das betreffende Verhalten an anderer Stelle explizit für rechtmäßig erklären. Der Gesamtheit der Normen liegt damit der eine – nun aktuelle – Wille des Rechtssetzers zugrunde und ist Maßstab der Rechtsanwendung.
99
Damit ist bereits die zentrale These dieses Teilabschnitts formuliert: Aufgrund dem einer Rechtsebene zugrunde liegenden einheitlichen Willen der rechtssetzenden Instanz folgt, dass Widersprüche innerhalb einer Rechtsordnung gar nicht möglich sind; Widersprüche sind – wenn überhaupt – nur im Gesetz möglich.[232]
Wird der Rechtssetzer aktiv, um eine bestimmte Gestaltung des Rechts vorzunehmen, steht ihm dazu nur das Gesetz (bzw. welche Form von Rechtsakt auch immer) zur Verfügung. Häufig wird er dabei eine konkrete Einzelfrage im Sinn haben; das ändert aber nichts daran, dass sich möglicherweise ein grundlegender Wandel seiner Wertevorstellungen vollzogen hat. Bringt er diesen zum Ausdruck, liegt er aber der gesamten Rechtsordnung zugrunde und nicht nur dem einzelnen Gesetz, weil die gesamte Rechtsordnung als Abbild seines Willens verstanden wird;[233] einzelne Vorschriften stellen nur Symptome des dahinterstehenden Gedankens dar.[234]
100
Die logische Unmöglichkeit von Widersprüchen innerhalb einer Rechtsordnung mag folgendes – zugegebenermaßen „kauzig[e]“[235] – Beispiel[236] verdeutlichen:
Beispiel:
Ein chinesisches Gesetz enthält folgende Vorschriften:
§ 1: Jedermann ist verpflichtet, beim Besuch von Maos Grab seinen Hut abzunehmen.
§ 2: Wer bei einem Besuch von Maos Grab den Hut abnimmt, handelt rechtswidrig.
§ 3: Wer bei einem Besuch von Maos Grab den Hut nicht abnimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.
§ 4: Wer bei einem Besuch von Maos Grab den Hut abnimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft.
Wären jeweils die §§ 1 und 3 und die §§ 2 und 4 von unterschiedlichen Normgebern erlassen worden, würde man keinen Normwiderspruch proklamieren, sondern sich lediglich fragen, welcher der beiden Normgeber die konkrete Regelungskompetenz besitzt. Der Verdacht eines inneren Widerspruchs ergibt erst aus der Erkenntnis heraus, dass ein und derselbe Normgeber nicht zur selben Zeit ein bestimmtes Verhalten gleichzeitig gewollt und nicht gewollt zu haben scheint.
Auf den ersten Blick mögen die Vorschriften widersprüchlich erscheinen, auf den zweiten Blick jedoch nur unglücklich[237] formuliert: Der Gesetzgeber bringt seinen Willen zum Ausdruck, dass man keine Kopfbedeckungen zu Maos Grab mitbringen darf.[238] Auch das Abnehmen des Hutes beseitigt den Verstoß nicht (§ 2), allerdings wird diese reuige Geste strafmildernd berücksichtigt (§ 4).
101
Innerhalb eines Gesetzes – im Sinne eines erlassenen Rechtsakts, nicht im Sinne eines Gesetzbuches, dass durch mehrere historische Rechtsakte geändert wurde – ist der Rechtsinhalt der Normen vergleichsweise einfach freizulegen. Schwieriger kann die Rechtsfindung sich gestalten, wenn (vermeintliche) Widersprüche zwischen verschiedenen Normengebilden auftreten. Konsequent zu der obigen Darstellung muss hier – jedenfalls dem Grundsatz nach – zwangsläufig die zeitliche Reihenfolge der Rechtsakte ausschlaggebend sein: „Ältere Normen sind an den Wertungen heutiger Normen auszurichten.“[239] Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann etwa bestehen, wenn zwar eine Grundregel geändert wird, eine diesbezügliche schon vorher bestehende Ausnahme aber bestehen bleiben soll. In diesem Falle sind die neuen Vorschriften genau daraufhin zu untersuchen, in welche Richtung der Wille des rechtssetzenden Organs gezielt hat. Es zeigt sich also, dass die Grundsätze lex posterior derogat legi anteriori und lex specialis derogat legi generali auch dann Anwendung finden, wenn man von einer im Recht vorfindlichen Einheit ausgeht. Sie stellen sich dann aber nicht mehr als Rechtsschöpfungsmethoden, sondern als Auslegungsmethoden dar, die in erkennender Weise – den Naturwissenschaften nicht unähnlich – dem Rechtsanwender ermöglichen, den Schritt, den das Recht von selbst beschreitet, nachzuvollziehen und somit eine Subsumtionsgrundlage herzustellen.
102
Überträgt man diese rechtstheoretischen Gedanken auf die Bundesrepublik Deutschland – konkreter: auf die Bundesrechtsordnung in Gestalt der formellen Bundesgesetze – ergibt sich folgendes Bild: Im demokratischen Staat (Art. 20 Abs. 1 GG) geht alle Staatsgewalt und damit auch die gesetzgebende Gewalt vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Dies erfolgt durch regelmäßige Übertragung für einen begrenzten Zeitraum an die dafür vorgesehenen Organe; es handelt sich um das System parlamentarischer Demokratie.
Damit stellen sich für die Übertragbarkeit des oben dargelegten Modells mehrere Probleme: Zum einen wird nicht der Wille des gesamten Volkes abgebildet, weil die politische Linie der Organe lediglich die Mehrheit abbildet. Dass ein wirklich einheitlicher Wille über alle bestehenden sozialen und kulturellen Unterschiede hinaus besteht, ist zudem zu bezweifeln. Zum anderen handelt es sich bei den Organwaltern auch um Menschen, die psychologisch gesehen ihren eigenen Willen bilden, der zudem regelmäßig nicht von der Absicht der Vereinheitlichung des Rechts, sondern von politischen Opportunitäten getragen ist.[240] Diese Punkte wurden bereits von Hans Kelsen als Kritik an der Lehre Georg Jellineks,[241] der soziologische Einwand ebenfalls von Eugen Ehrlich[242] vorgetragen. Hinzu kommt unter der Ägide des Grundgesetzes, dass gem. Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG jedenfalls die Abgeordneten des Bundestages nicht an einen tatsächlich festgestellten Volkswillen gebunden, sondern nur ihrem Gewissen unterworfen sind;[243] diese Wertung kann auch auf die übrigen Staatsorgane übertragen werden.[244]
103
Doch selbst diese kritischen Literaturstimmen räumen die Richtigkeit des Grundgedankens einer die Einheit des Rechts bildenden Einheit des Rechtssetzers auch in der repräsentativen Demokratie ein: Handelt es sich für den Rechtssoziologen Eugen Ehrlich zwar nur um ein anzustrebendes Ideal,[245] weist Kelsen darauf hin, dass es nicht auf einen sozialpsychologischen Willensbegriff ankommen könne, sondern nur auf einen juristisch-normativen:[246] Die Handlungen der Staatsorgane stellen sich gerade nicht als ihre eigenen Willensäußerungen dar, sondern werden dem Staat – bzw. dem Träger der Staatsgewalt – zugerechnet, soweit Normen dies vorsehen. Dies ist der Fall, wenn sie in Handlungsformen des Staates tätig werden, z.B. durch Rechtssetzung. Aus dem Ergebnis dieses Zurechnungsvorgangs bildet sich dann aber ein (nicht-psychologischer) „Staatswille“. In der repräsentativen Demokratie ist dieser Staatswille der Volkswille. Das kommt auch in Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG zum Ausdruck, wonach die Abgeordneten des Bundestages als „Vertreter des Volkes“ fungieren. Das Grundgesetz sieht nur die Existenz eines Volkes vor, wie die Präambel sowie Art. 1 Abs. 2 GG, 20 Abs. 2 S. 1, 146 GG deutlich machen,[247] weshalb das Ergebnis der Zurechnung eine Einheit bilden muss, da der eine Volkswille auf eine Frage nur eine Antwort geben kann.
104
Da das Volk als Träger der Staatsgewalt und damit auch der Rechtssetzung „zeitlos“[248] ist, wird die Einheitlichkeit der Rechtssetzung auch nicht durch eine Diskontinuität der Repräsentanten des Volkes durchbrochen. Ein „neuer“ Gesetzgeber kann die bereits bestehenden Normen abändern oder aufheben,[249] da die Zurechnung an die dieselbe Instanz erfolgt, stellt die neue Rechtslage sich nur als aktualisierter Wille desselben Rechtssetzers und nicht als neuer Wille eines anderer Rechtssetzers dar. Soweit die neuen Repräsentanten sich zu einem bestimmten Sachgebiet noch nicht im Wege der Rechtsordnung geäußert haben, bleiben die bisherigen Normen samt der ihnen inne wohnenden politischen Überzeugungen bestehen, selbst wenn diese nicht von den neuen Repräsentanten geteilt werden. Wird aber eine Wertung im Normgefüge verändert, durchdringt diese Änderung auch das bislang vorfindliche Normensystem.