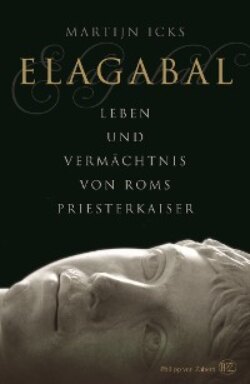Читать книгу Elagabal - Martijn Icks - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Antike Quellen
ОглавлениеBevor sich die Aufmerksamkeit nun auf Elagabal selbst richtet, lohnt ein kurzer Blick auf das Quellenmaterial. Wie bereits erwähnt, haben sich drei antike Autoren ausführlich mit der Regierungszeit des Priesterkaisers befasst. Der erste ist Cassius Dio, ein Senator aus Bithynia (Nordtürkei), der von ca. 164 n. Chr. bis irgendwann nach 229 n. Chr. lebte. Seine Römische Geschichte, auf Griechisch verfasst und in 80 Bücher aufgeteilt, schildert die Ereignisse von der Gründung Roms (die traditionell auf 753 v. Chr. datiert wird) bis ins Jahr 229 n. Chr. Große Teile von Dios Werk sind nur als Epitomen der byzantinischen Gelehrten Xiphilinos und Zonaras erhalten. Allerdings sind die zweite Hälfte des Buches LXXXIX sowie die erste Hälfte des Buches LXXX ungekürzt mit nur wenigen Lücken überliefert.
Als Griechisch sprechender Senator zeigt Dio eine klare Affinität für die griechische Kultur und billigt den Konservatismus der römischen Elite. Er wünscht, dass der Senat so viel Prestige und Macht wie möglich habe, während er allen der griechischen und römischen Kultur fremden Einflüssen ablehnend gegenüber steht.9 Wenngleich er Zeitgenosse Elagabals war, verfügte Dio über keine persönliche Anschauung des Kaisers, da er während dessen Regierungszeit nicht in Rom weilte. Wahrscheinlich ist, dass Dio seine Darstellung dieser Zeit vorwiegend auf die Gerüchte stützte, die ihn in Kleinasien erreichten, wo er damals lebte, und auf die mündlichen Informationen, die er nach seiner Rückkehr nach Rom sammelte.
Der zweite Autor ist Herodian, aller Wahrscheinlichkeit nach ein kaiserlicher Freigelassener (bzw. der Sohn eines kaiserlichen Freigelassenen), der in der Verwaltung des Römischen Reiches arbeitete. Er stammte vermutlich aus dem Westen Kleinasiens und lebte von ca. 175 n. Chr. bis ca. 255 n. Chr.10 Herodians Geschichte nach Kaiser Marcus, die acht Bücher umfasst und auf Griechisch geschrieben ist, schildert die Ereignisse seit dem Tod des Marcus Aurelius (180 n. Chr.) bis zur Thronbesteigung Gordians III. (238 n. Chr.). Das Werk ist unversehrt und ungekürzt überliefert.
Wie Dio legt auch Herodian eine Affinität für griechische Kultur und römische Traditionen an den Tag, wenngleich er sich weniger Gedanken um das Prestige des Senats als sein Historikerkollege macht. Seine Leserschaft scheint dieselbe gewesen zu sein wie die von Dio, nämlich die Griechisch sprechende Elite des Reiches. Allerdings zeigt er sich viel nachlässiger als sein Vorgänger, besonders, wenn es sich um Datums- und Jahresangaben handelt, und hat die Neigung, faktische Richtigkeit den Anforderungen dramatischen Erzählens zu opfern.11 Einem sorgfältigen Vergleich durch Andrea Scheithauer zufolge stützt sich Herodians Beschreibung des Zeitraums 218–222 n. Chr. an vielen Stellen direkt auf Dio.12 Dennoch liefert Ersterer viele Details, die bei Letzterem gar nicht erwähnt werden. Ob Herodian aber die von ihm beschriebenen Ereignisse persönlich miterlebt hat, bleibt ungewiss.
Drittens gibt es die Vita Antonini Heliogabali, angeblich verfasst von einem gewissen Aelius Lampridius und dem Kaiser Konstantin gewidmet. Die Vita ist Teil der Historia Augusta, einer Reihe von Kaiserbiographien, die die Kaiser von Hadrian (117–138 n. Chr.) bis Numerian (283–284 n. Chr.) beschreiben. Das auf Latein geschriebene Werk behauptet die Arbeit von sechs verschiedener Autoren zu sein, die während der Regierungszeiten Diokletians und Konstantins tätig waren. Tatsächlich muss es, wie Ronald Syme nachgewiesen hat, die Leistung eines einzigen Mannes gewesen sein, der wahrscheinlich um das 4. Jahrhundert n. Chr. gelebt hat. Viel ist über den Autor nicht bekannt, außer, dass seine Ansichten darauf hindeuten, dass er Heide war.13
Beim Verfassen der Vita Heliogabali benutzte ‚Lampridius‘ sowohl Dio als auch Herodian als Quellen (Ersteren vielleicht über ein dazwischen geschaltetes Werk). Wie viele der späteren Lebensbeschreibungen in der Historia Augusta besteht auch die Vita größtenteils aus wilden Erfindungen und fantastischen Anekdoten. Allerdings scheint das Werk einige zuverlässige Passagen mit Blick auf Elagabals Sturz zu enthalten. Laut Syme basieren jegliche faktische Informationen wahrscheinlich auf dem Bericht des Senators Marius Maximus, eines Zeitgenossen Elagabals, dessen Werk verloren ging.14 Generell jedoch ist die Vita Heliogabali von größerem Interesse als literarisches Werk denn als Quelle zur Rekonstruktion der Herrschaft des Kaiser-Priesters.
Die Darstellungen von Dio, Herodian und den Autoren der Vita Heliogabali ergänzen mehrere andere antike und byzantinische Autoren. Die meisten von ihnen schenken der Zeit von 218–222 n. Chr. nicht viel Beachtung. Überliefert sind dagegen zahlreiche Münzen und Inschriften aus der Regierungszeit Elagabals sowie einige Papyrustexte, kaiserliche Büsten und archäologische Überreste. Es existierten anscheinend mehrere kaiserliche Münzstätten während der Herrschaft Elagabals. Eine davon war sicherlich in Rom angesiedelt, andere an verschiedenen Orten in der Osthälfte des Reiches. Wann immer es notwendig ist, wird unterschieden zwischen kaiserlichen Münzen, die in Rom, und solchen, die im Osten geprägt wurden.