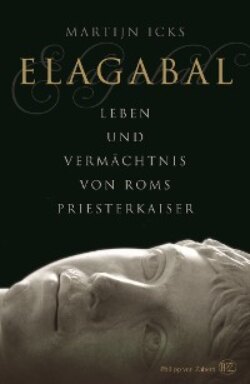Читать книгу Elagabal - Martijn Icks - Страница 15
Religiöse Reformen
ОглавлениеElagabals religiöse Reformen sind zweifellos der auffallendste und berüchtigtste Grundzug seiner Herrschaft. Jupiter als den römischen Hauptgott zugunsten einer exotischen, unbekannten Gottheit zu entthronen, war eine beispiellose Maßnahme, die sich über viele Jahrhunderte römischer Tradition hinwegsetzte. Was hoffte Elagabal durch die Neuordnung der Staatsreligion zu erreichen? Welche religiöse Ordnung schwebte ihm vor? Ganz gleich, welches die Antworten auf diese Fragen auch sind: Es besteht kaum Zweifel daran, dass die radikalen Reformen des Kaisers jeden Römer, der an seiner eigenen traditionellen Religion hing, schwer beleidigt haben müssen. Daher ist es auch höchst unwahrscheinlich, dass Elagabals politische Verbündete, die ihn unterstützten, um politische Macht zu erlangen oder zu erhalten, die Initiative für diese Reformen ergriffen.
Es muss der Kaiser selbst gewesen sein, seines Zeichens seit seinen Tagen in Emesa Hohepriester des Gottes Elagabal, der sich für seinen lokalen Gott einsetzte. Zosimos erwähnt, Elagabal habe seine Zeit mit ‚Magiern und Scharlatanen‘ verbracht.39 Bedenkt man, dass sowohl der Hohepriester als auch der schwarze Stein des Gottes Elagabal nach Rom gegangen waren, so liegt nahe, dass sie von vielen anderen Priestern und Dienern des Sonnengottes begleitet wurden. Wenn dies der Fall war, dann werden sie großen Einfluss auf den jungen, religiösen Kaiser ausgeübt haben.
Mag sein, dass sich Elagabal von seinen syrischen Priestern beraten ließ – seine anderen Berater scheinen weniger Kontrolle auf ihn ausgeübt zu haben. Akzeptiert man, dass der Junge hauptsächlich als Marionette auf den Thron gesetzt wurde, mit dem Ziel, den Interessen anderer zu dienen, so ging der Schuss offensichtlich nach hinten los. Der junge Kaiser zeigte vielleicht kein großes Interesse am Geschäft der Reichsverwaltung, doch vertrat er sehr feste Überzeugungen mit Blick auf religiöse Angelegenheiten, und er zögerte nicht, nach diesen Überzeugungen zu handeln. Bis zu einem gewissen Maße mögen Elagabals Familienmitglieder seine religiösen Reformen unterstützt haben, denn sicherlich verehrten sie ebenfalls den Gott Elagabal. Allerdings genügt ein kurzer Blick auf die Herrschaft des Severus Alexander, um festzustellen, dass zumindest einige Angehörige der emesenischen Sippe bereit waren, sich von dem unbesiegbaren Sonnengott zu distanzieren, wenn dies politisch opportun erschien. Gleiches lässt sich vom ‚Priesterkaiser‘ Elagabal nicht behaupten, der Sol Invictus bis zu seinem Tod ergeben blieb.
Cassius Dio hält fest, dass Elagabal sich zum Priester Elagabals in Rom wählen ließ. Frey weist darauf hin, dass der Senator das Wort ψηφισθῆναι benutzt, das er bei anderen Gelegenheiten ebenfalls gebraucht, wenn er anzeigt, dass der Senat zur Ehrung einer Person mit kaiserlichen Titeln eine Abstimmung durchführte. Anscheinend wies Elagabal den Senat an, seinen Priesterdienst gegenüber seinem Gott in seinen offiziellen Titel als römischer Kaiser einzubeziehen. Einige Inschriften erwähnen ihn nicht nur als pontifex maximus, sondern auch als sacerdos amplissimus dei invicti Solis Elagabali, ‚den erhabensten Priester des unbesiegbaren Sonnengottes Elagabal‘.40 Kaiserliche Münzen tragen die Legenden SACERD(OS) DEI SOLIS ELAGAB(ALI), SVMMVS SACERDOS AVG(VSTVS) und INVICTVS SACERDOS AVG(VSTVS), ‚Priester des Sonnengottes Elagabal‘, ‚hoher Priesterkaiser‘ und ‚unbesiegbarer Priesterkaiser‘.41 Soweit die Münzen sich genau datieren lassen, treten diese Legenden nur im Zeitraum 220–222 auf. Die Inschriften mit dem sacerdos-Titel können so gut wie alle auf die Jahre 221 oder 222 datiert werden (mit einer Ausnahme aus dem Jahre 220). Daher ist anzunehmen, dass der Senat Elagabal Ende 220 zum Hohepriester des Gottes Elagabal wählte.
Als Dio erwähnt, der Kaiser sei zum Elagabal-Priester gewählt worden, bemerkt er im gleichen Atemzug, die emesenische Gottheit sei über alle anderen Götter erhoben worden, einschließlich Jupiter. Auch wenn Herodian behauptet, der Kaiser habe bereits die Anrufung Elagabals vor allen anderen Göttern befohlen, als er im Winter 218–219 in Nikomedia weilte, ist es wahrscheinlicher, dass die Erhebung Elagabals zur römischen Hauptgottheit zur selben Zeit stattfand, als der Senat den Kaiser zu Elagabals Hohepriester wählte. Einige Münztypen erwähnen bereits vor 220 den schwarzen Stein als CONSERVATOR AVGVSTI, doch Jupiter wurde mindestens bis 219 als IOVI CONSERVATORI geehrt, möglicherweise sogar noch länger. Erst nach 220 verschwindet der traditionelle römische Hauptgott von Elagabals Münzen. Ab diesem Zeitpunkt fungierte nur noch der Gott Elagabal als göttlicher Beschützer des Kaisers.42
Wie aus Inschriften hervorgeht, kümmerte sich mindestens ein Sonnenpriester, der als sacerdos Solis Elagabali bezeichnet wurde, um die emesenische Gottheit, auch wenn es vermutlich mehrere gab. Interessanterweise war dieser Mann – Titus Julius Balbillus – bereits unter Septimius Severus und Caracalla sacerdos Solis gewesen.43 Zwar lassen die Inschriften, die Elagabal mit Priestertitel erwähnen, sich nicht datieren, doch wurde diese Angabe wahrscheinlich erst unter der Herrschaft Elagabals hinzugefügt. Es könnte auch sein, dass Balbillus in Rom schon auf Betreiben von Julia Domna zum Elagabal-Priester ernannt wurde, doch wenn dies der Fall war, hat der Gott anscheinend vor Ankunft seines Hohepriesters und Kultgegenstandes 219 keine herausragende Rolle im religiösen Leben Roms gespielt.
Die offensichtliche Frage lautet: Was hat diese erstaunlichen Reformen zur Mitte von Elagabals Herrschaft ausgelöst? Vor 220 hatte der Gott nur auf den kaiserlichen Münzen im Osten einen wichtigen Platz eingenommen. Wenn man die Münzprägung als Anzeichen kaiserlicher Überzeugungen betrachten kann, müssen die religiösen Traditionen der Römer in dieser frühen Periode weitgehend respektiert worden sein. Warum änderte sich dies Ende 220? Soweit es sich beurteilen lässt, war daran kein bestimmtes Ereignis schuld; möglicherweise waren sie einfach eine Folge von Elagabals zunehmender Macht innerhalb seines eigenen Hofstaates. Immerhin war der Kaiser zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 14 Jahre alt. Ende 220 muss er 16 oder sogar 17 gewesen sein, ein Alter, in dem man sehr wohl von ihm erwarten konnte, dass er eigene Initiativen ergriff und auch einmal gegen den Willen jener handelte, die anderer Meinung waren als er. Kurzum, der Junge auf dem Thron wuchs heran zu einem Mann – einem Mann mit festen religiösen Überzeugungen.
Eine alternative Erklärung könnte sein, dass die Jahre 218–220 als eine Zeit der ‚Vorbereitung‘ für das römische Volk gedeutet werden sollten, die dazu dienten, es mit dem Kult seines neuen Herrschers vertraut zu machen, bevor Elagabals religiöses Programm in all seiner exotischen Pracht zur Entfaltung kam. Das würde erklären, weshalb der Gott Elagabal in der Münzprägung bereits in diesen frühen Jahren eine verhaltene Rolle spielte: Der schwarze Stein tauchte nicht nur auf im Osten geprägten Münzen auf, sondern auch auf mindestens eines (seltenen) Typs des Antoninian, der 219 in Rom geprägt wurde. Mehrere römische Münzen mit einem anthropomorphen Sol als Motiv wurden in Umlauf gebracht. Da das Bildnis nicht mit einer Legende einhergeht, die den Gott als Sol Elagabal ausweist, könnte es sein, dass es bewusst vage blieb, ob der Gott die emesenische Gottheit darstellen sollte oder nicht.44 Zusätzlich gibt es die bereits erwähnte Geschichte Herodians über das Porträt des Kaisers, das dieser aus Nikomedia nach Rom schickte. Falls zutreffend, hätte es sich dabei um die erste offizielle Einführung des schwarzen Steins und seines Hohepriesters in der der Stadt gehandelt, mehrere Monate bevor die beiden tatsächlich in Rom einzogen.
Ein weiterer Hinweis, dass die religiösen Reformen womöglich einiges an Vorausplanung mit sich brachten, ist die Errichtung eines ‚enormen und prächtigen‘ Tempels für Elagabal. Nach der Historia Augusta sollte dieser Tempel auf dem Palatin liegen. Angeblich befand er sich dort, wo zuvor der Tempel des Orkus (aedes Orci) gestanden hatte. Da heute kein solches Gebäude bekannt ist, wurden mehrere alternative Lesarten vorgeschlagen, wie beispielsweise Adonidis horti oder Adonaea horti.45 Ausgrabungen durch die École française de Rome auf dem Palatin haben eine Antwort auf das Rätsel geliefert: Archäologen identifizierten Fundamente auf dem Standort der Vigna Barberini, unmittelbar neben dem Palast, als Teil des Elagabal-Tempels. In seiner Gesamtheit erstreckte sich der Komplex über eine Fläche von 160 × 110 Meter.46
Der Chronist Cassiodorus aus dem 6. Jahrhundert erwähnt, der Tempel sei 221 fertiggestellt worden. Hieronymus, der seine Chronik im 4. Jahrhundert n. Chr. schrieb, datiert die Fertigstellung des Tempels sogar noch früher, auf 220.47 Da er die Namen der Konsuln erwähnt, könnte Cassiodorus’ Datum präziser sein, doch bedeutet dies dennoch, dass der Tempel Elagabals binnen einem Jahr nach den religiösen Reformen abgeschlossen wurde – oder zumindest benutzt werden konnte. Außerdem führt Herodian noch einen zweiten, in einem Vorort Roms errichteten Tempel an. Da dieser Tempel in ähnlichen Worten beschrieben ist wie der Tempel auf dem Palatin und in keiner anderen Quelle Erwähnung findet, ist seine Existenz zweifelhaft, doch fügt Herodian hinzu, dass der schwarze Stein jedes Jahr im Hochsommer vom Palatin zu dem Vorstadttempel überführt wurde. Er liefert eine sehr detaillierte Beschreibung der feierlichen Prozession, die den Gott begleitete, was wieder für einen zweiten Tempel spricht. Das zweite Heiligtum könnte sich am Standort der Vigna Bonelli in Trastevere befunden haben.48
Wie gelang es dem Kaiser, binnen einem Jahr nach der Erhebung Elagabals zur Hauptgottheit des Reiches zwei Tempel zu bauen? Eine mögliche Antwort lautet, dass die Errichtung der Tempel bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Herrschaft begonnen hatte, nämlich unmittelbar nach oder sogar noch vor der Ankunft des Princeps in Rom. Möglich ist allerdings auch, dass es sich um bereits bestehende Tempel handelte, die dem Sonnengott neu geweiht wurden. In Trastevere, einem Viertel, in dem viele Götter aus dem Nahen Osten verehrt wurden, dokumentieren Inschriften das Vorhandensein eines Tempels für den palmyrenischen Gott Bel. Es scheint einleuchtend, dass, wie François Chausson ausführt, Elagabal dieses Bel-Heiligtum dem Gott Elagabal weihte.49 Gleichzeitig könnte Balbillus, der, wie Inschriften belegen, in dem Gebiet als sacerdos Solis tätig war, zum sacerdos Solis Elagabali erhoben worden sein.
Außerdem gibt es die Theorie, dass Elagabals Tempel auf dem Palatin ursprünglich ein Tempel des Iuppiter Victor war. Dieses auf einer Münze aus der Regierungszeit Trajans abgebildete Gebäude sieht angeblich einem Elagabal-Tempel auf einem Medaillon aus der Regierungszeit Elagabals bemerkenswert ähnlich.50 Dennoch sind die Unterschiede zwischen den beiden Heiligtümern zu groß, als dass allein das den Schluss zuließe, es handele sich um ein und dasselbe Gebäude. Archäologische Belege legen nahe, wie Henri Broise und Yvon Thébert konstatieren, der Tempel sei im Grunde eine Schöpfung ex nihilo gewesen, errichtet auf einer bereits bestehenden Terrasse.51 Allerdings hat es auch nicht unbedingt Jahre dauern müssen, ein solches Gebäude zu bauen. Selbst wenn der Kaiser mit dem Bau gleich nach seiner Ankunft in Rom begann, zeigt dies außerdem lediglich die Absicht, dem Gott Elagabal eine bedeutende Stellung in der Hauptstadt zu verschaffen. Der Tempel lag an einem herausragenden Ort in der Stadtlandschaft, doch gilt es im Auge zu behalten, dass er auf dem Palastgelände errichtet wurde, mithin auf einem Privatgrundstück. Also folgt daraus nicht zwangsläufig, Elagabal habe bereits in dieser frühen Phase beabsichtigt, die emesenische Gottheit an die Spitze des römischen Pantheons zu erheben.
Ein wichtiges Ereignis scheint gegen die Vorstellung zu sprechen, Elagabals religiöse Reformen seien bereits Jahre im Voraus geplant worden: die Heirat des Kaisers mit der Vestalin Aquilia Severa (die in Kürze ausführlicher zu erörtern sein wird). Offensichtlich muss dieser Bund zwischen Priest und Priesterin eine religiöse Bedeutung gehabt haben. Doch wenn Elagabal vom Beginn an beabsichtigte, Severa zu heiraten – weshalb nahm er dann zuerst Julia Paula zur Frau? Folgt man Dio, dann ließ er Julia Paula fallen, weil sie einen körperlichen Makel hatte. Frey deutet dies dahingehend, dass er sie dadurch als ungeeignet für eine bevorstehende religiöse Zeremonie ansah, nämlich eine symbolische Vermählung mit dem Kaiser als Widerspiegelung der Hochzeit des Gottes Elagabal mit der Göttin Urania.52 Doch Makel hin oder her – die Heirat Elagabals mit Julia Paula kann niemals die gleichen religiösen Konnotationen gehabt haben wie seine Vermählung mit Aquilia Severa, da Julia Paula keine Priesterin war, geschweige denn eine Vestalin. Deshalb kann die Idee von der Heirat des Priesterkaisers mit einer römischen Priesterin erst entstanden sein, nachdem Julia Paula bereits Elagabals Frau geworden war. Zumindest legt dies nahe, dass die von Elagabal und seinen Anhängern verfolgte Religionspolitik einigen Raum für Planänderungen ließ.
Statt von einer sorgfältig geplanten und vorbereiteten Umgestaltung der Staatsreligion auszugehen, sollte man die wachsende Rolle des Gottes Elagabal während der Herrschaft des Kaisers Elagabal eher als Folge einer Reihe mehr oder weniger spontaner Entscheidungen ansehen. Der Princeps, dessen Einfluss vermutlich stieg, als er heranwuchs, ging bei der Glorifizierung und Förderung seines persönlichen Gottes immer weiter. Aller Wahrscheinlichkeit nach überließ man es den Untergebenen, seine Handlungen einer zunehmend verwirrten und verstimmten Öffentlichkeit zu ‚verkaufen‘.
Ab dem Jahr 220 und bis zu einem gewissen Grade vielleicht sogar vor dieser Zeit sah sich die Bevölkerung Roms häufig mit ungewohnten religiösen Ereignissen konfrontiert. Dio und Herodian führen beide an, dass Elagabal öffentlich in seinem ‚orientalischen‘ Priestergewand auftrat, was ihm laut Dio den Spitznamen ‚der Assyrer‘ einbrachte. Die Geschichte wird durch Münzen bestätigt, die Elagabal beim Opfern zeigen, gekleidet in parthische Hosen und einen langen Umhang.53 Bedenkt man, dass er sich nun als sacerdos amplissimus des Elagabal betitelte, so ist es kaum verwunderlich, dass der Kaiser sich in Einklang mit seinem Priesteramt kleidete. Herodian vermittelt den Eindruck, als habe Elagabal gar nichts anderes als Priestergewänder getragen; Dio jedoch spricht lediglich davon, er sei ‚häufig‘ darin aufgetaucht.54 Wenn Dio recht hat, so zeigt sich darin das Eingeständnis des jungen Herrschers, dass ihm abgesehen von seiner Rolle als Hohepriester Elagabals noch andere Aufgaben oblagen. Nichtsdestoweniger war der Dienst am Gott Elagabal vermutlich das Hauptanliegen des Kaisers. Herodian schildert, wie der Princeps seinem Gott täglich riesige öffentliche Opfer darbrachte:
Jeweils am Morgen trat er auf, schlachtete ganze Hekatomben von Stieren und eine große Menge Schafe, die er auf die Altäre legte, und er häufte vielfältiges Räucherwerk dazu; er goss zahlreiche Amphoren des ältesten und besten Weins vor den Altären aus, sodass Ströme von Wein und Blut vermischt dahinflossen. An den Altären führte er unter vielfältigen Klängen von Musikinstrumenten Kulttänze auf, und Tänzerinnen seiner Heimat tanzten mit ihm zusammen, liefen um den Altar herum und trugen Zimbeln und Tympana in Händen. Ringsum standen der gesamte Senat und die Ritter als Zuschauer wie im Theater. Die Eingeweide der Opfertiere schleppten und die Rauchopfer in goldenen Gefäßen schwenkten über ihren Köpfen nicht etwa irgendwelche Opferdiener oder Menschen geringen Standes, sondern die Kommandanten der Prätorianer und die Männer in den höchsten Ämtern, bekleidet mit bis zu den Füßen und Händen reichenden Gewändern phönikischer Tracht, in der Mitte mit einem einzigen Purpurstreifen. Sie trugen Schuhwerk aus Leinen wie die Priesterkaste in jenen Gegenden. Und er glaubte denen die höchste Ehre zu erweisen, die er an seinen Opferriten teilnehmen ließ.55
Cassius Dio bestätigt, dass der Kaiser während der Opferhandlungen tanzte, dokumentiert jedoch nicht, ob alle Senatoren und Ritter diesen täglichen Ritualen beiwohnen, geschweige denn an ihnen teilnehmen mussten. Dies könnte sich aus der nachlässig gearbeiteten, schlecht strukturierten Beschaffenheit von Dios Darstellung erklären, obwohl man eigentlich nicht erwarten würde, dass er einen solchen Affront gegen die römische Tradition und senatorische Würde verschweigt. Wenngleich Herodians Bericht zu ausführlich ist, als dass man ihn gänzlich abtun könnte, übertreibt er möglicherweise die Häufigkeit des Rituals und die Zahl der zur Anwesenheit verpflichteten Personen. Dennoch scheint die obligatorische Anwesenheit von Senatoren und Rittern bei öffentlichen Opfern für Elagabal gut in die neue religiöse Ordnung gepasst zu haben, die der Kaiser zu etablieren suchte. Immerhin war der emesenische Sonnengott nun die Hauptgottheit der römischen Staatsreligion. Wenn Elagabal als sein Hohepriester Opfer darbrachte, handelte er als staatlicher Beamter.
Ein weiteres von Herodian ausführlich beschriebenes Ereignis ist die Prozession des schwarzen Steins vom palatinischen Tempel zu seinem vorstädtischen Heiligtum. Laut Herodian unternahm der Gott diese Reise jedes Jahr im Hochsommer. Unklar ist, weshalb der Stein von einem Tempel zum anderen bewegt werden sollte, doch muss es ein ziemlich spektakulärer Anblick gewesen sein:
Den Gott selbst setzte er auf einen mit Gold und wertvollen Edelsteinen ausgeschmückten Wagen und geleitete ihn von der Stadt aus in das Gebiet vor der Stadt. Den Wagen ließ er sechsspännig von sehr großen Schimmeln ziehen, die ohne irgendeinen Fehler und mit viel Gold und buntem Zaumzeug geschmückt waren, wobei die Zügel kein Mensch führte (es durfte ja keiner den Wagen besteigen), sondern sie waren dem Kultbild selbst als dem Wagenlenker umgehängt. Antoninus [der Kaiser] aber lief vor dem Wagen rückwärts schreitend, blickte auf den Gott und führte die Pferde am Zaum; so vollendete er die ganze Wegstrecke rückwärts laufend mit dem Blick auf die Front des Gottes. Damit er aber nicht ins Stolpern oder zu Fall käme, da er ja nicht sah, wohin er trat, war der Weg reichlich mit Goldsand ausgelegt, und die Leibwächter bildeten vorsorglich beiderseits einen Sicherheitskordon. Die Bevölkerung lief beiderseits parallel, vielerlei Fackeln tragend, und streute Kränze und Blumen aus. Die Bilder aller Gottheiten mit ihren wertvollen und ehrwürdigen Weihgeschenken, alle Kaiserinsignien und teuren Kleinodien, die Ritter und das gesamte Heer [der Stadt] zogen als Festzug dem Gott voraus.56
Danach opferte der Kaiser dem Elagabal und kletterte anschließend auf einen hohen Turm, von dem aus er der Menge Geschenke zuwarf: Gold- und Silberpokale, Gewänder, feine Wäsche und sogar Kleintiere. Letzterer Akt mag von Lukians Werk De dea Syria inspiriert sein, in dem der Autor erwähnt, vom Tempel der Atargatis in Hierapolis habe man Tiere geworfen;57 er könnte allerdings auch darauf hinweisen, dass ein ähnlicher Brauch in Emesa existierte. Laut Herodian herrschten bei der Geschenkvergabe regelmäßig chaotische Zustände, bei denen zahlreiche Menschen zu Tode getrampelt wurden oder von Speeren der Soldaten durchbohrt.
Eine der erstaunlichsten Geschichten über Elagabal ist seine Heirat mit einer Vestalin. Zunächst erscheint dies als kaum mehr als ein fabrizierter Topos, der veranschaulichen sollte, was für ein schlimmer Tyrann der Kaiser war. Der Kult der Vesta war einer der wichtigsten Kulte in Rom; einer der zur Keuschheit verpflichteten Vestalinnen zu heiraten war nichts weniger als eine vorsätzliche Beleidigung der römischen Religion. Allerdings dürfen wir angesichts der vielen Traditionen, die Elagabal bereits verletzt hatte, nicht annehmen, dass er eine solche Tat nicht zuzutrauen gewesen wäre.
Tatsächlich weisen einige Indizien darauf hin, dass diese Hochzeit tatsächlich stattfand. Erstens erwähnen alle drei literarischen Quellen eine Affäre Elagabals mit einer Vestalin, wenngleich Herodian der Einzige ist, der ausdrücklich darauf hinweist, das Paar hätte auch geheiratet. Zweitens überliefert Dio den Namen der priesterlichen Geliebten des Kaisers: Aquilia Severa; gemäß Dio war sie nicht irgendeine Vestalin, sondern Vestas Hohepriesterin. Ihr Name wird auf kaiserlichen Münzen erwähnt, und zwar begleitet von dem Beinamen AVG(VSTA). Die Rückseite eines Münztyps zeigt Elagabal und Severa, Händchen haltend; eine andere trägt die Legende VESTA.58 Obwohl Letzteres wahrscheinlich nicht viel bedeutet – einige Münzen von Julia Paula, Julia Soaemias und Julia Maesa tragen die gleiche Legende – scheint die Beweislage dafür zu sprechen, dass die Geschichte dieses bemerkenswerten Bundes zwischen dem Kaiser und Vestas Hohepriesterin der Wahrheit entspricht.
Ein genaues Datum der Eheschließung lässt sich nicht eruieren. Mittels einer Untersuchung alexandrinischer und syrischer Münzen ist Joseph Vogt zu dem Schluss gekommen, dass Elagabal Aquilia Severa Anfang 221 heiratete. Es gibt zahlreiche alexandrinische Münzen mit Julia Paula aus dem vierten Jahr von Elagabals Herrschaft, das nach alexandrinischer Zählung am 29. August 220 begann. Außerdem bezeugen mehrere syrische Münzen, dass Julia Paula im Herbst 220 noch immer Kaiserin war.59 Frey datiert ein Bronzemedaillon, das Elagabal und Severa auf der Vorderseite zeigt, vor den Beginn des Jahres 221, was er aus der Tatsache ableitet, dass der Kaiser noch ganz ohne Bart abgebildet ist.60 Dies würde die Hochzeit auf einen Zeitpunkt Ende 220 datieren – etwa um die Zeit der Erhebung Elagabals zur höchsten römischen Gottheit.
Warum tat Elagabal einen so außergewöhnlichen Schritt und verletzte damit einen der bedeutendsten und ehrwürdigsten Kulte Roms? Nach Dio war der Kaiser ziemlich eindeutig mit Blick auf seinen Beweggrund: „Er besaß sogar die Frechheit zu erklären: ‚Ich habe diesen Schritt getan, damit sämtliche Kinder aus mir, dem obersten Priester, und aus ihr, der obersten Priesterin, hervorgehen.‘“61 Das klingt durchaus plausibel. Indem er Aquilia Severa heiratete, konnte Elagabal eine priesterliche, eine geradezu ‚gottähnliche‘ Dynastie gründen, die Rom nach ihm regieren sollte. Gleichzeitig schmiedete die Hochzeit eine persönliche Verbindung zwischen der traditionellen Staatsreligion Roms, vertreten durch ihre wichtigste Priesterin, und dem neuen obersten Gott Elagabal, vertreten durch den Kaiser als sacerdos amplissimus. Ironischerweise mag also hinter dieser höchst kontroversen Maßnahme die Absicht gesteckt haben, die Religionen von Rom und Emesa einander näherzubringen.
Herodian überliefert, dass nicht nur der Kaiser heiratete, sondern auch der Gott Elagabal. Anscheinend war die erste Braut des Gottes die Göttin Athena, symbolisiert durch ihren Kultgegenstand, das Palladium. Allerdings war diese Göttin nach dem Geschmack des Gottes Elagabal zu kriegerisch, und so wurde die Verbindung aufgelöst, und man traf neue Vorkehrungen. Die Statue der punischen Göttin Urania wurde in Begleitung des gesamten Goldes aus ihrem Tempel von Karthago nach Rom gebracht. Nicht nur die Stadt Rom, sondern ganz Italien war angehalten, die göttliche Eheschließung zu feiern. Dio erwähnt die Heirat Elagabals mit Athena nicht, bestätigt jedoch, dass der Sonnengott Urania zur Braut nahm. Er fügt hinzu, sie habe zwei goldene Löwen als Mitgift gebracht, während der Kaiser von seinen Untertanen Hochzeitsgeschenke einsammeln ließ.62
Eine in der spanischen Stadt Córdoba (römisch: Corduba) gefundene Inschrift erwähnt Elagabal zusammen mit zwei Göttinnen. Eine davon ist Athena Allath, deren Name unmittelbar die angebliche Heirat zwischen dem Sonnengott und Athena ins Gedächtnis ruft. Der Name der anderen Göttin ist beschädigt, wurde jedoch als Kypris Charinazaia rekonstruiert. Bei Kypris handelt es sich um eine zyprische Liebesgöttin phönizischer Herkunft. Frey vertritt die Ansicht, sie sei aus Zypern nach Karthago mitgenommen worden, wo sie mit dem Mond in Verbindung gebracht und als Urania bekannt wurde, Elagabals göttliche Braut, so Dio und Herodian.63
Bleibt die Frage, weshalb Elagabal als Braut für seinen Gott ausgerechnet eine Göttin aus Karthago importierte, anstatt eine Gottheit aus Rom oder Syrien zu nehmen. Vielleicht war es einfach die Tatsache, dass die punische Göttin berühmt und hochverehrt war, oder es waren die mythischen Bindungen zwischen Rom und Karthago – immerhin derjenigen Stadt, von der aus Aeneas in See stach, um in Italien seine neue Heimat zu finden. Zudem konnte man eine Heirat zwischen Urania, der Mondgöttin, und Elagabal, dem Sonnengott, als Symbol kosmischer Harmonie deuten. Herodian deutet dies an, indem er feststellt, der Kaiser habe eine Hochzeit zwischen Sonne und Mond als „äußerst angemessen“ betrachtet.64
Dio und Herodian verknüpfen die Eheschließung(en) Elagabals und die des Kaisers nicht miteinander. Anders einige moderne Historiker: Halsberghe meint, Elagabal habe Aquilia Severa geheiratet, um eine Verbindung zwischen dem Kult Elagabals und dem Kult der Vesta herzustellen und dadurch zu versuchen, die emesenische Gottheit bei den Römern beliebter zu machen. Aus demselben Grund beabsichtigte der Kaiser angeblich, Elagabal mit Vesta zu verheiraten. Dass er den Gott stattdessen mit Athena verheiratete, sei ein Fehler gewesen: Laut Halsberghe hielt Elagabal das Palladium fälschlicherweise für eine Repräsentation der Vesta, weil es in Vestas Tempel aufbewahrt wurde. Der Historiker vermutet, sowohl die kaiserliche als auch die göttliche Heirat hätten für so große Bestürzung gesorgt, dass es Julia Maesa gelang, ihren Enkel von deren Auflösung zu überzeugen. Elagabal vermählte sich dann mit Annia Faustina, während der Sonnengott Urania als seine neue Braut nahm. Halsberghe folgert: „Diese Wahl lieferte den Nachweis größerer Weisheit und Vorsicht und erfüllte auch vollständig die Anforderungen der Situation, sodass Elagabal damit sein Reformwerk krönte.“65
Die Vorstellung, dass der Kaiser das Palladium versehentlich für eine Repräsentation der Vesta gehalten haben könnte, scheint wenig glaubhaft. Frey tut die ganze Heirat zwischen dem Gott Elagabal und Athena als falsch ab, als eine Einbildung, die aus Herodians Verkennung der wahren Geschehnisse erwachsen sein. Er weist auf ein auf dem Forum Romanum entdecktes Kapitell hin, das aller Wahrscheinlichkeit nach Teil des großen Elagabal-Tempels auf dem Palatin war. Es zeigt den schwarzen Stein des Elagabal, einen konischen Stein mit einem Adler auf der Vorderseite, flankiert von zwei beschädigten Figuren, die vermutlich Athena Allath und Kypris Charinazaia oder Athena und Urania darstellen.66 Wenn Elagabal eine Ehefrau gegen eine andere austauschte, würde man keinen gemeinsamen Auftritt Athenas und Uranias erwarten. Daher vertritt Frey die Auffassung, beide weiblichen Gottheiten bildeten eine Trias mit Elagabal, bei der Urania die Gattin des Sonnengottes und Athena vielleicht ihre Tochter war.67 Obwohl diese Theorie einleuchtend klingt, sollte man dennoch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Gott Elagabal Urania zu seiner zweiten Frau nahm, ohne sich von Athena scheiden zu lassen. Auf diese Weise könnte Herodian doch Recht gehabt haben mit seiner Behauptung, es hätten zwei göttliche Eheschließungen stattgefunden.
Frey verknüpft die Heirat des Gottes Elagabal und der Göttin Urania mit der Eheschließung des Kaisers Elagabal mit Aquilia Severa. Er weist darauf hin, dass sich in semitischen Religionen eine Heirat der Götter häufig auf Erden in einer symbolischen Heirat zwischen dem König und der Königin und einer Priesterin widerspiegelte. Diese Vermählungen wurden am Anfang eines neuen Jahres gefeiert, und das begann in Syrien und Phönizien im Herbst.68 Könnte es sein, dass der Kaiser die Hohepriesterin der Vestalinnen heiratete, um die Hochzeit seines Gottes mit Urania widerzuspiegeln? Die Theorie scheint nicht besonders zu den literarischen Berichten zu passen. Immerhin: wenn der Ehebund zwischen Kaiser Elagabal und Severa symbolisch für den Bund zwischen Elagabal und Urania gewesen wäre, würde man erwarten können, dass er eine Priesterin der Urania oder der Venus geheiratet hätte, nicht eine der Vesta – oder er umgekehrt Elagabal mit Vesta statt mit Urania verheiratet hätte.
Pietrzykowski, der Frey zustimmt, dass der Gott Elagabal nur einmal heiratete, legt nahe, dass die Verheiratung der emesenischen Gottheit mit Urania ein Mittel zum Zweck war, um Elagabal, Kypris Charinazaia und Athena Allath als neue Triade in Rom einzuführen, die den Platz der traditionellen Götter Jupiter, Juno und Minerva einnehmen sollte.69 Dies scheint eine plausible Theorie zu sein, selbst wenn man die Möglichkeit in Betracht zog, dass der Gott Elagabal nicht nur Urania/Kypris heiratete, sondern auch Athena (Allath) zur Frau nahm. Allerdings ist die Beweislage eher dünn: Juno taucht auf der Rückseite einer Münze von Julia Paula als IVNO CONSERVATRIX auf, fehlt jedoch auf Münzen Aquilia Severas und Annia Faustinas. Zudem tragen Münzen der Julia Soaemias sowohl die Legenden IVNO REGINA und VENVS CAELESTIS auf der Rückseite.70 Möglicherweise wurde Erstere vor der Einführung der neuen Triade und Letztere erst danach geprägt, doch da die Münzen nicht genau datiert werden können, handelt es sich um reine Spekulation. Letztlich bleiben die Beweggründe des Kaisers für die Göttervermählung(en) des Elagabal ein Puzzle ohne klar ersichtliche Auflösung.
Die Historia Augusta spricht von einer weiteren bedeutenden Maßnahme, die der Priesterkaiser angeblich ergriff. Nach dem Verfasser der Vita Heliogabali wollte der Herrscher alle Kultobjekte der Stadt im Palatintempel sammeln:
[Er] errichtete ihm [Elagabal] einen Tempel, entschlossen, auch das Idol der Göttermutter und das Feuer der Vesta, das Palladium und die Schilde der Salii und alle anderen Heiligtümer der Römer in diesen Tempel zu überführen mit dem Ziel, dass in Rom kein anderer Gott außer Elagabal verehrt werde. Außerdem pflegte er zu erklären, dass die Religionsgebräuche der Juden und Samaritaner und der christliche Kult dorthin zu verlegen seien, damit das Priestertum des Elagabal das Geheimnis sämtlicher Kultübungen in sich schließe.71
Herodian bekräftigt, Elagabal habe das Palladium entführt, behauptet jedoch, dies sei wegen der geplanten Heirat zwischen Elagabal und Athena geschehen. Auch hält er fest, dass die Statuen anderer Götter sowie die Tempelschätze an der Prozession im Jahre 221 teilnahmen. Obwohl er darüber hinaus nicht ausdrücklich angibt, ob der Kaiser alle Kultobjekte im Elagabal-Tempel versammelte, erwähnt er dennoch, sie seien nach dem Tod des Kaisers allesamt wieder an ihre ursprünglichen Orte überführt worden. Diese beiläufige Bemerkung verleiht der Geschichte in der Historia Augusta eine gewisse Glaubwürdigkeit, selbst wenn Dio zu dem Thema schweigt.
Die Frage, die all dem zugrundeliegt, lautet, was es genau bedeutete, dass Elagabal zur obersten Gottheit Roms erhoben wurde. Der Autor der Historia Augusta scheint in dieser Hinsicht zu keiner Entscheidung gekommen zu sein. Einerseits vermittelt er den Eindruck, der Kaiser habe vorgehabt, alle anderen Gottheiten Elagabal zu unterwerfen: „Er erklärte übrigens, sämtliche Götter seien Diener seines Gottes, wobei er die einen als dessen Kammerdiener, die anderen als Sklaven, wieder andere als Handlanger für verschiedene Dienstleistungen bezeichnete.“ Andererseits wird suggeriert, Elagabal wünschte alle anderen Religionen zu zerstören: „Auch wollte er nicht nur in Rom die Kultübungen beseitigen, sondern auf der ganzen Welt, von dem einen Gedanken besessen, dass der Gott Elagabal überall verehrt werde.“72 Anscheinend hielt dies den Kaiser nicht davon ab, sich als Venus zu verkleiden und eine Prozession für die Göttin Salambo abzuhalten. Dio erwähnt lediglich, dass Elagabal über Jupiter gestellt wurde; Herodian schreibt, der emesenische Gott habe vor allen anderen Göttern von den Magistraten und bei öffentlichen Zeremonien angerufen werden müssen.
Offensichtlich trug Elagabal sich nicht mit dem Gedanken, eine monotheistische Staatsreligion einzuführen. Es existierte keine monotheistische Tradition in Emesa, wie im nächsten Kapitel erörtert werden wird; noch lässt irgendeine Quelle außer der Historia Augusta darauf schließen, dass der Kaiser vorhatte, Elagabal zum einzigen Gott zu machen. Nach 220 werden Jupiter und Mars nicht mehr auf kaiserlichen Münzen erwähnt, doch Venus Caelestis und/oder Juno Regina tauchen weiterhin auf, ebenso Personifizierungen wie Providentia und Victoria.73 Staatskulte und Staatspriesterschaften wie die sodales, die pontifices und die Arvalbrüder bestanden fort.74 Wie sich an der Heirat des Kaisers mit der Hohepriesterin der Vesta und der Heirat Elagabals mit Urania (und vielleicht Athena) zeigen lässt, versuchte Elagabal die Religion aus Emesa mit der römischen Staatsreligion zu verschmelzen. Der Gott Elagabal war die neue Spitze des Pantheons, doch bedeutete dies nicht, dass man Jupiter, Juno und die anderen traditionellen römischen Gottheiten gänzlich aufgegeben hätte. Sie wurden weiterhin von Magistraten angerufen und bildeten einen Teil der öffentlichen Zeremonien, wie Herodian andeutet, indem er feststellt, man hätte Elagabal nun vor ihnen anrufen müssen. Es mag durchaus zutreffen, dass alle Kultobjekte im Palatintempel versammelt werden mussten; aber daraus ergibt sich lediglich, dass der Gott Elagabal unangefochten an erster Stelle stand, nicht dass die Verehrung anderer Götter verboten war. Die Hierarchie des römischen Pantheons hatte sich verändert, aber nichtsdestotrotz blieb er ein Pantheon.
Schwer einzuschätzen ist, wie viel Einfluss die Reformen des Priesterkaisers außerhalb Roms hatten. Abgesehen von Herodians Äußerungen, Italien sei als Ganzes angewiesen worden, die Hochzeit Elagabals und Uranias zu feiern, überliefern die literarischen Quellen nicht, in welchem Maße Anstrengungen unternommen wurden, um die Verehrung Elagabals jenseits der Hauptstadt zu exportieren. Selbstverständlich kamen überall im Reich Münzen in Umlauf, die entweder den Gott Elagabal oder den Kaiser beim Opfern für seinen Gott zeigten, doch kann es gut sein, dass dies die einzige Methode war, mittels der in den Provinzen aktiv für den Sonnengott geworben wurde. Rudolf Haensch hat darauf hingewiesen, dass ab einer bestimmten Zeit in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts römische Legionen von offiziellen Heerespriestern begleitet wurden. Er spekuliert, diese Priester seien ursprünglich von Elagabal eingesetzt worden, da sie auf Inschriften und in Papyrustexten gelegentlich als sacerdotes bezeichnet werden, was an den Titel des Kaisers sacerdos amplissimus erinnert.75 Falls Haensch richtig liegt, teilte Elagabal jeder Heereseinheit einen Elagabal-Priester zu. Auch wenn es sich um eine einleuchtende Theorie handelt, scheint sacerdos ein zu üblicher Titel zu sein, als dass er irgendwelche sicheren Schlussfolgerungen zuließe. Außerdem sind keine anderen Belege für Anstrengungen des Kaisers vorhanden, alle Soldaten des Reiches Elagabal verehren zu lassen.
Wie im dritten Kapitel zu besprechen sein wird, zeigen einige Provinzmünzen den schwarzen Stein von Emesa, und mindestens ein Fall einer Stadt ist bekannt, in der Elagabalia gefeiert wurden, doch da Beweise aus den meisten anderen Städten fehlen, sind dies wohl eher Beispiele für Städte, die dem Gott des Kaisers von sich aus Respekt zollten und nicht irgendwelchen in Rom ausgegebenen Befehlen gehorchten. Es gibt keinen Grund für die Annahme, die Anbetung Elagabals sei dem Reich im gleichen Maße aufoktroyiert worden wie im 4. Jahrhundert das Christentum.