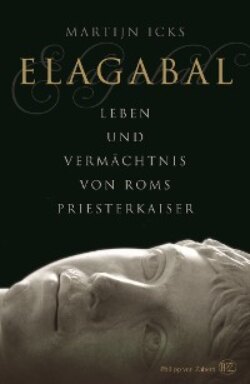Читать книгу Elagabal - Martijn Icks - Страница 8
In den Händen der Historikern
ОглавлениеAuch die Historiker waren und sind von Elagabal fasziniert. Im 20. und 21. Jahrhundert wurden dem Kaiser und seinem Sonnengott mehrere akademische Werke gewidmet. Den Anfang machte Georges Duviquet, der Héliogabale raconté par les historiens grecs et latins (1903) herausgab, eine Sammlung antiker Texte (und einiger anderer Quellen wie Münzen und Inschriften) zu Elagabal. Diese literarischen Quellen spielen eine zentrale Rolle in späteren Studien zur Person und Herrschaft Elagabals. Häufig geht dies auf Kosten von Münzen, Inschriften, Papyri, Büsten und archäologischen Überresten. Daher sind die Darstellungen des Kaisers im modernen akademischen Schrifttum oft einseitig und unausgewogen.
John Stuart Hay, der Verfasser von The Amazing Emperor Heliogabalus (1911), versucht sich in Elagabals Psyche zu vertiefen. Er kritisiert die literarischen Darstellungen und merkt an, dass sie den jungen Herrscher verleumdet hätten; andererseits basiert seine eigene, bemerkenswert positive Einstellung gegenüber Elagabal auf keinerlei Belegen oder plausiblen Schlussfolgerungen. Einen weiteren Versuch der Psychoanalyse unternahm Roland Villeneuve, dessen Héliogabale, le César fou (1957) dem Kaiser weniger positiv gegenübertritt als Hays Studie, jedoch ebenso wenig überzeugend ist.
Andere Forschern machten es kaum besser: G. R. Thompsons unveröffentlichte Dissertation Elagabalus: Priest-Emperor of Rome (1972) hat den Vorzug, dass sie in breitem Umfang nicht-literarische Quellen verwendet und akribisch auf diese eingeht, doch die kritische Haltung der Arbeit lässt immer noch viel zu wünschen übrig. Letzteres gilt auch für Robert Turcans Werk Héliogabale et le sacre du Soleil (1985), das meist die antiken Darstellungen für bare Münze zu nehmen scheint und sich dabei Quellenangaben einfach spart. Eine jüngere Studie von Saverio Gualerzi, Né uomo, né donna, né dio, né dea (2005), konzentriert sich auf Elagabals soziopolitische, sexuelle und religiöse Rolle, um aus dessen Herrschaft eine Art Sinn herauszuarbeiten. Obwohl der Autor sowohl die antike als auch die moderne Literatur umfassend nutzt, ignoriert er größtenteils die nicht-literarischen Quellen. Seine Schlussfolgerungen sind äußerst spekulativ und decken sich kaum mit dem verfügbaren Beweismaterial.
Als Letztes sind zwei Monographien zu nennen, die sich weniger auf den Kaiser Elagabal als vielmehr auf den Kult des emesenischen Sonnengottes Elagabal konzentrieren. Eine davon ist Gaston Halsberghes in die Irre führendes The Cult of Sol Invictus (1972), in dem der Verfasser Kaiser Elagabal als Monotheisten darstellt, der das Reich unter einer Universalreligion zu vereinigen suchte.3 Auf diese Ansicht stößt man ebenfalls in den Werken von Hay und Thompson, die Elagabal gleichermaßen als einen monotheistischen Gott betrachten.4 Entschlossen verwirft diese Vorstellung Martin Frey, der Autor des ausgezeichneten Werks Untersuchungen zur Religion und zur Religionspolitik des Kaisers Elagabal. Frey liefert wertvolle Informationen zu Elagabal und den anderen in Emesa verehrten Göttern, die er anschließend nutzt, um Elagabals religiöse Reformen in Rom zu rekonstruieren und zu interpretieren.5
Wenn man die Bilder von Kaisern genauer anschaut, lässt sich zwischen den positiven, von der kaiserlichen Verwaltung herausgegebenen Bildern – die man als kaiserliche Propaganda bezeichnen könnte – und den diversen von anderen, seien es Zeitgenossen oder Protagonisten späterer Epochen, konstruierten Bildern unterscheiden. Beispielsweise hat Olivier Hekster die Selbstdarstellung des Kaisers Commodus, der sich seinen Untertanen selbst als Herkules und Gladiator präsentierte, in Commodus. An Emperor at the Crossroads (2002) untersucht. Einige Jahre zuvor gaben Jaś Elsner und Jamie Masters Reflections of Nero (1994) heraus, das verschiedene Darstellungen des letzten julisch-claudischen Kaisers in der antiken Literatur und der modernen Populärkultur hervorhebt.7 Dieses Werk hat den Vorzug, eines der wenigen zu sein, das über die Antike hinausgeht und veranschaulicht, wie Bilder aus der Zeit des antiken Rom sich in späteren Jahrhunderten bemerkbar machten.8
Wie bereits dargelegt, wimmelt es nur so von Bildern Elagabals. Da gibt es einerseits die kaiserliche Propaganda, die während seiner Regierungszeit verbreitet wurde, zweitens die negativen Darstellungen in antiken Autoren und schließlich die diversen Repräsentationen des jungen Herrschers in der modernen Historiographie, Kunst und Literatur. All diese Bilder, ob nun visueller oder literarischer Natur, sind mehr oder weniger miteinander verknüpft. Letztlich speisen sie sich aus einem historischen Kern: dem ‚wahren‘ Elagabal, der die römische Welt zumindest nominell von 218 bis 222 n. Chr. regierte.
Warum hat gerade dieser Kaiser, dessen Regierungszeit nur vier Jahre in einer der weniger bekannten Epochen römischer Geschichte dauerte, so viele unterschiedliche und schillernde Bilder hervorgebracht? Wie kam es dazu, dass er in der antiken Literatur als einer der ‚schlechten Kaiser‘ Roms konstruiert wurde, und wie entwickelte sich sein negativer Ruf in späterer Zeit, in der gelehrten Forschungsliteratur wie auch in Dramen, Romanen und Gemälden von Künstlern? Welche Elemente der Persönlichkeit und Herrschaft Elagabals sind von denen, die ihn darstellten, hervorgehoben, übertrieben und verzerrt worden? Welche Elemente hat man heruntergespielt oder ignoriert? Welche Werte und Vorstellungen lassen sich aus den verschiedenen Darstellungen und Bewertungen des Kaisers herauslesen?
Dies sind alles faszinierende Fragen, und die Antworten darauf geben der Nachwelt nicht nur Aufschluss über die Wahrnehmung Elagabals im Laufe der verschiedenen Epochen, sondern auch über die Art und Weise, wie Geschichte von Gelehrten, Schriftstellern und Künstlern ständig neu gedacht wird, um zeitgenössische Werte, Ideen und Anliegen zu reflektieren. Für einen christlichen Autor mag Elagabal zuallererst ein ‚Heide‘ gewesen sein; für einen standhaften Republikaner mag er die Laster der absoluten Monarchie repräsentieren; für einen heutigen schwulen Mann mag er ein Artverwandter sein, mit dem er sympathisieren kann. Das Nachleben des Priesterkaisers in seinem bescheidenen Umfang und seiner facettenreichen Beschaffenheit macht ihn zu einem idealen Objekt für die Untersuchung dieses Phänomens.