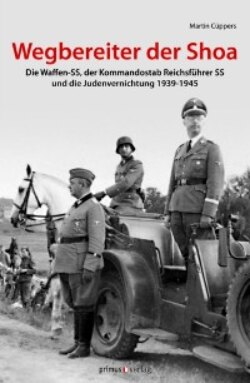Читать книгу Wegbereiter der Shoah - Martin Cüppers - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Teil: Vorgeschichte und Ausgangslage
I. Verfügungstruppe und Totenkopfverbände. Die Entwicklung der bewaffneten SS
1. Die SS als nationalsozialistische Kampforganisation
Als Adolf Hitler im März 1923 unter der großspurigen Bezeichnung „Stabswache“ seine aus einer Handvoll Männern bestehende Leibwache ins Leben rief, war die Wendung der dubiosen Schlägertruppe zu einer der bedeutendsten Organisationen des Nationalsozialismus und zu einem Synonym für die deutschen Massenverbrechen kaum absehbar. Wie der „Führer“ selbst rekrutierte sich auch die im Mai in „Stoßtrupp Adolf Hitler“ umbenannte Leibwache aus Männern der Kriegsgeneration. Frustriert über den Ausgang des Weltkriegs machten sie die Legende vom „Dolchstoß“ gegen die unbesiegte deutsche Armee zum Ausgangspunkt ihres Denkens. In der Folgezeit engagierten sie sich in rechtsextremen Freikorps und standen einer demokratischen Ordnung von Anfang an feindlich gegenüber. In diesem Dunstkreis fanden auch die völkischen und radikal antisemitischen Ideen, die den Nationalsozialismus hervorbrachten, einen bedeutenden Nährboden.1
Seine Leibwächter beteiligten sich im November 1923 am Putschversuch in München. Nach dessen Scheitern wurde der „Stoßtrupp Adolf Hitler“ zusammen mit der NSDAP und der SA verboten. Hitler wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, aber nach kaum neun Monaten bereits wieder auf Bewährung entlassen.2 Fünf Monate nach seiner Freilassung gründete er im Frühjahr 1925 eine neue, acht Mann starke Leibwache, die im Spätsommer die Bezeichnung „Schutzstaffel“ erhielt und zu einer reichsweiten Organisation mit eigenen Trupps in den wichtigsten Städten ausgebaut wurde.3 Die „Schutzstaffel“ oder „SS“, wie die Truppe unter ihrem Kürzel zunehmend genannt wurde, verstand sich von Beginn an als Elite, der in den einzelnen NS-Ortsgruppen nur besonders zuverlässige Parteimitglieder angehörten. Zu ihrem Aufgabenbereich gehörte der Schutz Adolf Hitlers oder anderer prominenter Nationalsozialisten, die Werbung neuer Mitglieder sowie der Kampf gegen politische Gegner. Mit der Reorganisierung der reichsweiten SA-Führung im November 1926 brach die Aufbauarbeit der SS vorerst ab. Gezwungen, die Oberhoheit der SA anzuerkennen, stagnierte der Organisationsumfang für mehrere Jahre. Noch Anfang 1929 betrug deren Gesamtstärke gerade 280 Mann.4
Erst die Ernennung des 28-jährigen Heinrich Himmler zum „Reichsführer-SS“ markierte am 16. Januar 1929 einen entscheidenden Schritt zu einer Entwicklung, an deren Ende die SS als unbestrittene ideologische Elite der Nationalsozialisten stand.5 Ende 1930 hatte Himmler bereits erreicht, daß die SS auch als interne Polizei der gesamten Partei fungierte. Darüber hinaus verfügte Hitler die Unabhängigkeit der SS gegenüber der SA, die ihr bislang in jeder Beziehung weisungsberechtigt gewesen war.6 Während dieser Zeit hatte die Parteiorganisation bereits einen beachtlichen personellen Aufschwung vollzogen. Die bei der Übernahme durch Himmler knapp 300 Mann zählende Schutzstaffel bestand am Ende des gleichen Jahres bereits aus etwa 1000 SS-Angehörigen. Am 31. Dezember 1931 zählte die Organisation 14 964 und ein Jahr später 52 048 Mitglieder.7 Die Ernennung Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler und die damit einhergehende Erhebung des Nationalsozialismus zur offiziellen Staatsdoktrin in Deutschland bedeutete auch für die SS den endgültigen Durchbruch. Mit einem Mal wollten Hunderttausende von Deutschen der selbsternannten Elite angehören. Angesichts des Andrangs mußten zwischenzeitlich die Aufnahmeverfahren ausgesetzt werden, trotzdem gehörten der SS gegen Ende des Jahres 1933 bereits 209 014 Männer an.8
Schon während der sogenannten Kampfzeit war die SS für unzählige Übergriffe auf mißliebige Organisationen und Einzelpersonen verantwortlich gewesen. Im nationalsozialistischen Deutschland wurde die SS dann zu einer der zentralen Organisationen, zu deren Aufgabenbereich die erbarmungslose Verfolgung „rassischer“ und ideologischer Feinde gehörte. Nach dem Reichstagsbrand und der in der Folge verabschiedeten „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ schwärmten neben der SA auch 15 000 zu Hilfspolizisten ernannte SS-Männer aus, um sogenannte Staatsfeinde jeglicher politischer Couleur zu verfolgen und sie anschließend in den Polizeiwachen und Konzentrationslagern zu terrorisieren oder zu ermorden.9
Zu den erklärten Feinden der SS gehörten in ganz besonderem Maße die etwa 560 000 deutschen Juden, die immer wieder einzeln terrorisiert, aber auch in pogromartigen Ausschreitungen wie den sogenannten Ku’dammkrawallen vom 12. September 1931 in Berlin öffentlich angegriffen wurden.10 An den im März und April 1933 erstmals deutschlandweit organisierten anti-jüdischen Boykott-Aktionen hatte die SS wesentlichen Anteil. Wie sehr sich dieser Terror zu verselbständigen drohte, belegt eindrucksvoll ein Befehl Himmlers vom August 1935. Darin verbot er sämtliche Einzelaktionen von SS-Angehörigen gegen Juden „aufs Schärfste“ und kündigte an, selbst kleinste Zuwiderhandlungen mit dem Ausstoß aus der SS zu ahnden. Überlegungen und praktische Ansätze zur „Lösung der Judenfrage“, so Himmler weiter, seien der höchsten Führung vorbehalten und nicht Sache einzelner SS-Männer.11 Daneben war die Organisation eifrig um die Unterbindung jeglichen Kontakts aus den eigenen Reihen zu den Juden bemüht. Himmler kündigte im November 1934 an, er werde jeden SS-Angehörigen, der in jüdischen Geschäften einkaufe, sich von jüdischen Ärzten behandeln oder von Anwälten beraten lasse, aus der SS ausschließen.12
Der rasant verlaufende Prozeß zunehmender Barbarisierung, in den sich die Deutschen begeben hatten, verlief nicht ohne innere Widersprüche und Fraktionskämpfe. Die SS konnte einen vehementen Bedeutungszuwachs verzeichnen, als es ihr am 30. Juni 1934 gelang, der bis dahin bedrohlichen Konkurrenz der SA durch die Liquidierung ihrer Führung Herr zu werden. Die im Zuge des internen Machtkampfes zur Ermordung der SA-Führer eingesetzten Kommandos stellten zwei neu entstandene SS-Verbände, die „SS-Leibstandarte Adolf Hitler“ und die SS-Wachmannschaft des Konzentrationslagers Dachau. Als Dankesgeste für die loyalen Mörder verfügte Hitler mit Verweis auf die „großen Verdienste der SS, besonders im Zusammenhang mit den Ereignissen des 30. Juni 1934“, die Erhebung der SS zu einer selbständigen Organisation innerhalb des Parteigefüges. Seitdem war Himmler als Reichsführer-SS nur noch seinem „Führer“ persönlich unterstellt.13 Beide SS-Gruppierungen, mit deren tatkräftiger Hilfe die NS-Hierarchie im Juni 1934 von oppositionellen Strömungen und unliebsamen Einzelpersonen gesäubert worden war, bildeten in der Folge den Kern von zwei bewaffneten Organisationssträngen, die sich unabhängig voneinander entwickelten und erst im Krieg Ende 1939 organisatorisch zusammengeführt werden sollten.
Nach der Ernennung zum Reichskanzler hatte Hitler am 17. März 1933 zum dritten Mal in seiner Karriere die Aufstellung einer persönlichen Leibgarde, der „Stabswache Berlin“, verfügt. Auf dem nächsten Reichsparteitag im September wurde der Truppe der Titel „SS-Leibstandarte Adolf Hitler“ verliehen.14 Kommandeur der Leibwache wurde Sepp Dietrich. Er war Unteroffizier im 1. Weltkrieg, anschließend Angehöriger des Freikorps Oberland und fand in den frühen 20er Jahren Anschluß an die nationalsozialistische Bewegung. Ab 1929 stand Dietrich als SS-Oberführer Süd in Bayern in persönlichem Kontakt zu Hitler.15 Unabhängig von der Aufstellung der Leibstandarte gründeten die SS-Oberabschnittsführer außerhalb von Berlin ihre eigenen bewaffneten Schutztruppen. So entstanden in München, Ellwangen, Arolsen, Hamburg und Wolterdingen ab Ende 1933 sogenannte Politische Bereitschaften. Durch ihre Verwendung als Hilfspolizei konnten sich die SS-Trupps bis 1934 eine gewisse Legitimität verschaffen, die sich unter anderem in deren Finanzierung durch die jeweiligen Landespolizeien ausdrückte.16
Die Reichswehrführung stand dem Aufbau der paramilitärischen Verbände äußerst skeptisch gegenüber, sie fürchtete das Erwachsen einer unliebsamen Konkurrenz und suchte durch strukturelle Beschränkungen, den weiteren Ausbau der bewaffneten SS zu verhindern. Ein Erlaß des Reichswehrministers Werner von Blomberg legte am 24. September 1934 den Verfahrensrahmen für die Aufstellung dieser Verbände fest, die die offizielle Bezeichnung „SS-Verfügungstruppe“ erhielten. In dem Erlaß war festgehalten, daß die Verfügungstruppe im Friedensfall die einzige bewaffnete Formation innerhalb der SS sein sollte. Als Gesamtstärke wurden drei Regimenter und eine zusätzliche Nachrichtenabteilung festgeschrieben. Im Kriegsfall war deren Unterstellung unter das Kommando der Wehrmacht vorgesehen. Das Personal würde aus dem Kreis der Wehrpflichtigen rekrutiert werden, dafür wurde der Dienst in der Verfügungstruppe zukünftig dem allgemeinen Wehrdienst gleichgestellt. Die Wehrmacht sagte zu, der Truppe die militärische Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, darüber hinaus wurde die Heranbildung von Führernachwuchs an SS-eigenen Führerschulen zugestanden. Die ab 1934 eingerichteten Schulen in Bad Tölz und Braunschweig sahen die jährliche Ausbildung von 500 Führerbewerbern vor. Ein solches Maß ging weit über den Bedarf der bewaffneten SS in ihrer damaligen Größe hinaus und unterstrich damit, daß auf diese Weise bereits das Offizierskorps für eine wesentlich erweiterte Verfügungstruppe geschaffen wurde.17
Zum militärischen Aufbau und zur Führung wurde ergänzend am 1. Oktober 1936 innerhalb des SS-Hauptamtes die „Inspektion der SS-Verfügungstruppe“ eingerichtet, mit deren Führung Paul Hausser, ein ehemalige Generalleutnant der Reichswehr und bisheriger Chef der SS-Führerschule in Braunschweig betraut wurde.18 Als sich 1938 im Zuge der aggressiven deutschen Expansionspolitik die außenpolitische Situation dramatisch verschärfte, brachte die politische Lage gleichzeitig eine deutliche Stärkung der Rolle der Verfügungstruppe mit sich. Durch einen von Hitler unterzeichneten und im Entwurf von Himmler persönlich bearbeiteten Erlaß wurde am 17. August 1938 die Autonomie der Verfügungstruppe gegenüber der Wehrmacht endgültig festgeschrieben.19 Weiter konkretisiert wurde deren Stellung durch einen Erlaß am 18. Mai 1939. Diesmal bestimmte Hitler die Zusammenfassung zu einer Division, gleichzeitig wurde deren Gesamtstärke auf insgesamt 20 000 Mann begrenzt.20
Die eigentliche Bedeutung beider Erlasse liegt in der Festschreibung des militärischen Charakters der SS-Verfügungstruppe, der damit endgültig gegen den Widerstand der Wehrmacht durchgesetzt worden war. Mit Kriegsausbruch zeigte sich zudem, wie schnell die als hinderlich anzusehende Personalbeschränkung, die auf Drängen der Wehrmacht im Erlaß vom Mai 1939 auftauchte, obsolet war. Neben der ab Oktober 1939 zügig aufgestellten Verfügungs-Division, wurde die „SS-Leibstandarte Adolf Hitler“ zu einem kompletten Regiment erweitert; dessen Umgliederung zur Division wurde 1941 realisiert.21 Im November 1940 gab Hitler außerdem den Befehl zur Aufstellung einer weiteren Division mit der Bezeichnung „Germania“. Den Stamm dafür bildete das von der Verfügungs-Division abgegebene Regiment „Germania“; hinzu kamen die beiden neu aufzustellenden Standarten „Nordland“ und „Westland“.22 Am 21. Dezember 1940 erhielt die bisherige SS-Verfügungstruppe auf Weisung Hitlers den Namen SS-Division „Reich“ und der neu aufgestellte Verband „Germania“ wurde in SS-Division „Wiking“ umbenannt. Mit beiden Divisionen und der Leibstandarte hatte die Gesamtstärke der früheren Verfügungstruppe die im Mai 1939 festgesetzte quantitative Begrenzung bei weitem überschritten.23