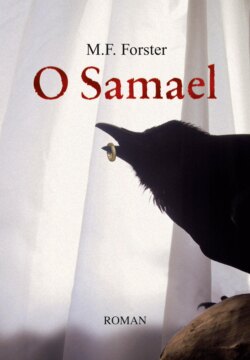Читать книгу O Samael - Martin Francis Forster - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVII
Von nun an blieb ich des Nachts allein. Katharina stahl sich zwar nicht mehr in mein Zimmer, aber ihre Blicke suchten immer wieder den meinen, und wenngleich ich ahnte, wie schwer es ihr fallen mochte, das Erlebte zu verarbeiten, wusste ich doch keinen Grund, sie zu trösten. Für mich hatte das Kind nie existiert.
Niemand, vor allem Meister Esau nicht, hatte etwas bemerkt. Bald schon hatte ich diese unselige Geschichte vergessen, und ich ging weiter meiner Arbeit nach, gewissenhaft und konzentriert.
So sehr Katharina den Augenkontakt zu mir suchte, so sehr vermied Elena ihn, wenn wir bei ihren regelmäßigen Besuchen in ihres Vaters Haus aufeinander trafen.
Der Meister freute sich ungemein auf diese Besuche. Er war überaus stolz auf seinen ersten Enkel, der auf den Namen Paul getauft worden war, und er strahlte jedes Mal vor Glück, wenn er den Knaben auf den Schoß nahm und liebevoll an sich drückte.
Wie der Großvater, waren auch die Tanten ganz vernarrt in den Buben. Katharina und Ida nähten Jäckchen, häkelten Mützchen und Decken und buhlten um die Aufmerksamkeit ihres Neffen. Eine ungekannte Leichtigkeit hatte den Weg in die Schreinerei gefunden, Unbeschwertheit durchzog die Tage.
Alles schien in bester Ordnung, und so ging ein weiteres Lehrjahr ins Land.
Irgendwo wartete etwas auf den günstigen Augenblick.
Ich stand vor der Schreinerei, als ich Sebastian zum ersten Mal sah. Er schlenderte mit dieser unnachahmlichen Selbstsicherheit, die ständig, als wolle er die ganze Welt necken, zwischen Frechheit und Bescheidenheit balancierte, durch die Hofeinfahrt auf mich zu. Er trug die typische Kluft der Wandergesellen, den staubigen Schlapphut hatte er in den Nacken geschoben, eine dunkle Locke fiel ihm in die Stirn. Seine Stiefel waren ausgetreten, aber das weiße Hemd, die Staude, war blütenrein, und sein goldener Ohrring blitze in der Sonne auf. Als er mich bemerkte, setzte er ein breites Grinsen auf.
Es war Anfang Juli, der Tag war heiß und drückend, und wir warteten seit Stunden sehnsüchtig auf ein erlösendes Gewitter. Tief am Horizont zeichnete sich schon die graue Wolkenfront ab, die von Westen her herauf zog.
Ich hatte das Tor zur Werkstatt weit geöffnet. Drinnen war es unerträglich stickig, schwer hing der Holzstaub in der Luft. Ich nahm meine Schirmmütze ab, um den Staub auszuklopfen, als ich den Donner heranrollen hörte. Ich sah nach oben, doch der Himmel über mir war blau und wolkenlos.
Als das Grollen begann, ließ der Fremde schlagartig Felleisen und Stenz fallen, rannte auf mich zu, sprang mich an und warf mich zu Boden.
Eine knappe Handbreit neben unseren Köpfen krachten mehrere Dutzend Dachschindeln auf die Erde. Ein paar Tonsplitter trafen mich und auch ihn, der schützend über mir lag, doch wir blieben beide unverletzt.
Seinen keuchenden Atem hörte ich nicht, spürte ihn dafür umso heißer an meinem tauben Ohr. Sein Körper lag so schwer auf meinen, dass ich sein pochendes Herz fühlte.
Auch mir, den Schreck in den Knochen, raste das Herz in der Brust. Nur um Haaresbreite war ich einem Unglück entkommen; die Schindeln hätten mich töten können.
Der Geselle stand erst auf, als Meister Esau, aufgeschreckt vom Lärm, hinter uns aus der Werkstatt gelaufen kam und laut »Jesses!« schrie.
»Junge, ist dir was passiert?«
Er, der Wanderer, stand jetzt breitbeinig über mir, grinste wieder und streckte mir die Hand entgegen.
»Hast wohl ‘nen Schutzengel gehabt«, lachte er und zog mich hoch.
Der Meister sah, dass ich wohlauf war, fasste sich langsam wieder und nickte dem Fremden zum Gruß zu. »Einen Schutzengel oder einen ehrbaren Gesellen auf Wanderschaft. Gott segne dich!«, sagte er.
»Gott zum Gruße! Und danke für den Segen.« Der Geselle machte eine Kopfbewegung zum Dach. »Wie ich sehe, könnte es hier Arbeit für mich geben«, meinte er.
»Da hast du wohl Recht. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.« Der Meister kratzte sich am Kopf.
»Ein paar Sparren werden sich vermutlich von der Hitze verzogen haben.«
»Ja, mag wohl so sein ...« Der Meister überlegte. »Aber vom Dach einmal abgesehen, hätte ich auch sonst Beschäftigung für dich. Wenn du also Arbeit suchst? Die Geschäfte laufen gut, und es gibt ziemlich viel zu tun für den Lehrling und mich. Ein weiteres Paar fleißige Hände kann nicht schaden.«
»Na, das höre ich gerne«, freute sich der Neue.
»Also! Dann sollten wir nicht lang reden. Ich will dich gerne für ein Jahr bei mir aufnehmen.«
Meister und Geselle stellten sich einander vor. Die Bedingungen waren schnell ausgehandelt, und wie ich es vor mehr als drei Jahren schon einmal gesehen hatte, spuckte Meister Esau jetzt in seine Handfläche. Der Wandergeselle tat es ihm nach und hielt die Hand hin.
»Es gilt.«
Sie schlugen ein, und der Vertrag war besiegelt.
Als der Meister vor ihm die Werkstatt betrat, drehte der Geselle sich um und zwinkerte mir zu.
Ich stand allein auf dem Hof. Mein Herz wollte nicht aufhören zu klopfen.
Ich war sechzehn und nicht dumm. Die letzten Reste meiner jugendlichen Naivität hatte ich im Wald zurück gelassen, an jenem Tag, als wir mit Neles Hilfe das Ungeborene abtrieben.
Als ich vor der Werkstatt auf dem Rücken im Staub lag, Sebastian auf mir, einen winzigen Augenblick länger als nötig, als sein Körper sich mit all seiner Männlichkeit an meinen drückte, wusste ich instinktiv, dass hinter der eigentlichen Berührung etwas Fremdes lauerte, etwas Neues. Etwas Wildes und Verbotenes, das fernab meiner Träume und jenseits der Nächte mit Katharina zu suchen war. Etwas, dass mir gleichermaßen die Scham ins Gesicht trieb ...
Und, ja, das Blut in die Lenden.
Das Offensichtliche schien jeder zu sehen, nur ich selber war blind. Er vielleicht auch.
Wir waren uns sehr ähnlich. Nicht nur äußerlich hätten wir Brüder sein können. Im Geiste waren wir es vielleicht sogar. Unsere Gedanken schienen oft dieselben zu sein. Wenn Sebastian mich während der Arbeit ansah, wusste ich genau, was ihm durch den Kopf ging. Ein Lächeln, ein Blick, ein leichtes Nicken genügten, und ich spürte, was er meinte oder wollte. Wir verstanden einander wortlos.
Er, der Geselle, der vier Jahre älter war als ich, wurde mir bald zum Vorbild. Ich lernte von ihm, sah und hörte ihm zu, und mehr als dem Meister je zuvor, eiferte ich ihm nach.
Sein Können, sein Geschick, seine Perfektion bei der Arbeit bewunderte ich grenzenlos. Ihn selbst bewunderte ich. Seine Hände (mir fiel auf, dass sie im Gegensatz zu denen des Meister weder rissig noch rau waren) packten das Werkzeug fest und das Holz mit liebevollem Respekt. Unter seinen Fingern entstanden Kleinode der Tischlereikunst, Preziosen des Handwerks. Was er begann, führte er zielstrebig zu Ende. Was der Meister ihm auftrug, erledigte er, wollte mir scheinen, zweimal schneller und dreimal besser als verlangt.
Das Bemerkenswerte daran war, dass Sebastian eigentlich kein Schreiner, sondern Zimmermannsgeselle war. Doch ob Dachstuhl, Radspeichen, Fensterrahmen oder Schmuckschatulle: alles, was er fertigte oder ausbesserte, war makellos und von bemerkenswerter Vollkommenheit – gerade so, wie er selbst es in meinen Augen war.
Ich brauchte seine Nähe nicht zu suchen. Sebastian war immer dort, wo ich war. In der Werkstatt ohnehin. Bei Tisch saß er neben mir. Und schlafen tat er in meinem Zimmer, in meinem Bett. Nur eine Handbreit Matratze trennte uns des Nachts.
Ich wurde es nicht müde, seinen Geschichten zu lauschen, die er vor dem Einschlafen erzählte, bekam nie genug von den Anekdoten über seinen kauzigen Meister und den tollpatschigen Altgesellen.
Er erzählte von Zuhause, von seinem Vater, einem Dachdecker, der früh verwitwet war, von der Tante, bei der er aufgewachsen war, und von der klugen Hündin, die ihm einmal im Winter, als er im Wald auf Wölfe, die sich nah an die Stadt getraut hatten, gestoßen war, das Leben rettete, und die ihn jahrein, jahraus jeden Tag vom väterlichen Hof zur Zimmerei begleitet und abends wieder pünktlich abgeholt hatte. Oh, ich wünschte mir einen Hund!
Er beschrieb seine Heimatstadt Münster, mit der Lambertikirche und ihren mahnenden Körben aus Eisen, die breiten Straßen und den Prinzipalmarkt so lebendig, dass mir bald war, als wäre ich selbst dort gewesen, wäre unter den Bogengängen gelaufen und hätte vor dem Rathaus gestanden und zum Giebel empor geblickt.
»Du solltest einmal hören, wie laut es zugeht, wenn Pferdemarkt ist! So was hast noch nicht erlebt. Die ganze Stadt ist voller Bauern und Kaufleute, und an den Marktständen gibt es die unglaublichsten Dinge zu sehen«, meinte er.
So begannen die Bilder, die in meinem Kopf entstanden, langsam meine Neugier auf die Welt zu wecken. Eine erste Ahnung von Fernweh und Reiselust erwachte in mir, und ich träumte von neuen Orten und fremden Städten, malte mir das geschäftige Treiben in Münster, Kassel und Frankfurt aus und stellte mir vor, wie es wäre, selbst auf Wanderschaft zu gehen.
Alle zwei bis drei Wochen, wenn die Frauen nach dem Essen die Küche aufräumten, setzte Sebastian sich an den Tisch und schrieb einen Brief an seinen Vater. Ich saß ihm dann meistens gegenüber, beobachtete bewundernd, wie er die Schreibfeder in die Tinte tauchte und sie dann ebenso schwungvoll wie bedachtsam über das Papier zog und lachte mit ihm, wenn die Tinte aller Vorsicht zum Trotz kleckste.
»Dein Vater schreibt dir nie zurück«, überlegte ich eines Abends laut.
Er blickte auf. »Weil er kaum schreiben kann, deshalb. Immerhin kann er lesen. Mehr schlecht als recht zwar, aber wenn ich sauber und ordentlich schreibe, kann er meine Briefe ganz gut entziffern. Und wenn ich auch selber keine Post bekomme, weiß ich doch, dass er sich freut zu hören, dass es mir gut geht.« Dabei lächelte er mich an und schob das Blatt Papier zu mir über den Tisch.
»Hier. Schreib etwas drunter!«, forderte er mich auf.
»Ich? Was soll ich denn schreiben?«, wehrte ich ab.
»Na, dass ihr hier überaus froh seid, einen so fleißigen Gesellen bekommen zu haben, der euch mit seinem sagenhaften Geschick begeistert und den ihr nie wieder missen wollt. Was sonst?«, lachte er.
»Spinner«, sagte ich, doch dann schrieb ich unbeholfen einen kurzen Gruß unter den Brief und unterschrieb mit meinem Namen.
Wie immer begleitete ich ihn Tags darauf ins Dorf, als er nach der Arbeit den Brief zur Poststelle brachte. Die Männer unterwegs grüßten ihn, die Frauen lächelten, und die Mädchen kicherten und steckten eilig die Köpfe zusammen.
»Die Leute mögen dich«, sagte ich auf dem Rückweg. Die Sonne stand schon tief, und die Luft war mild.
Sebastian riss im Vorbeigehen einen Halm ab und kaute darauf herum. Vor uns stoben ein paar aufgeschreckte Saatkrähen auseinander.
»Natürlich tun sie das. Ich mag sie ja auch.«
»Aber du kennst sie doch gar nicht!«
»Deswegen darf ich sie doch trotzdem mögen, oder? Wenn ich sie dann kennen lerne, kann ich meine Meinung immer noch ändern – falls jemand es nicht verdient haben sollte, von mir gemocht zu werden«, hielt er schmunzelnd dagegen.
»Pah!«, sagte ich bloß.
»Und du? Magst du die Leute?«, wollte er wissen.
Ich dachte einen Moment lang nach und zuckte dann mit den Schultern. »Ich glaube, sie sind mir egal«, sagte ich.
»Wirklich? Schlechte Einstellung.«
»Ist halt so«, antwortete ich, weil mir nichts Besseres einfiel.
Er lachte wieder: »Aber mich magst du doch?«
»Hm ... weiß nicht.«
»Tja, ich für meinen Teil mag dich genauso wenig.« Dabei knuffte er mich scherzhaft in die Seite und fegte mir mit einem Klaps meine Schirmmütze vom Kopf.
»He!«, rief ich und schubste ihn.
»Na warte, Frechdachs!«
»Blödian.«
Mit einem Male rangelten und balgten wir uns; ein Hieb gab den anderen und schon bald rollten wir durch das hohe Gras. Ich schrie laut auf, als er mir in die Seite kniff und mich gleichzeitig kitzelte. Ich versuchte, ihn zu boxen, doch Sebastian wehrte geschickt ab. Keiner meiner Schläge saß; er fing jeden meiner Fausthiebe so leicht ab, als wolle er Mücken fangen und lachte mich aus. Im nächsten Moment lag ich unter ihm; mit einer schnellen Drehung hatte er mich überrumpelt. Er kam auf mir zu sitzen und drückte meine Arme fest auf den Boden. Ich war wehrlos.
»Los, sag, dass du mich magst!«, forderte er.
»Nein!«
»Ich weiß, dass du mich magst.«
»Tu ich nicht.«
Die Wut über die Niederlage machte mich trotzig, und ich versuchte, mich freizukämpfen. Ich bekam einen Arm frei, zerrte an seinem Hemd, krallte mich in den weißen, festen Stoff und wollte Sebastian zur Seite ziehen. Vergeblich, denn er schlug meine Hand fort und packte nur noch fester zu.
»Komm schon. Sag es!«
»Niemals.« Ich keuchte.
Er verlagerte sein Gewicht weiter nach vorne, und mir blieb die Luft weg.
»Lügner.« Er flüsterte es.
Sekunden verstrichen. Hinter seinem Gesicht trieb der Westwind ein paar einsame Schafswolken über das Abendrot. Ganz in der Nähe begannen Heuschrecken ihren nächtlichen Kanon zu zirpen.
»Ich kann es sehen.« Dann, blitzschnell, küsste er mich auf den Mund.
Und sprang auf.
»Wer schneller ist!«, rief er und spurtete los.
Eine erschrockene Weile lang war ich wie starr. Meine rechte Hand hielt ich zur Faust geballt. Als ich sie schließlich öffnete, lag ein schimmernder Knopf von seinem Hemd darin. Ich hob meine Mütze vom Weg auf und rannte ihm hinterher. Erst vor der Schreinerei holte ich ihn ein; schmutzig, verschwitzt und atemlos.
Jene Wildheit, die ich vor wenigen Wochen schon einmal hatte erahnen können und die mir so fremd und so ungeheuerlich vorgekommen war, hatte durch den flüchtigen, rauen Kuss eines Mannes ein Geheimnis aus den Tiefen meiner Träume an die Oberfläche gezerrt. Ein Geheimnis, das es von nun an zu hüten galt.
An diesem Abend mochte ich Sebastian nicht mehr ansehen und ging ihm aus dem Weg, was unnötig war, denn er schien mich ebenfalls zu meiden.
Ich war verwirrt. Ich spürte Scham und gleichzeitig schäumte eine Freude in mir, die meine Gedanken – Verlegenheit hin oder her – um nichts anderes kreisen ließ als diesen einen Kuss, der mir, als ich rücklings im Gras lag, ohne jede Vorwarnung aufgezwungen worden war, und den ich doch bereitwillig angenommen hatte. Gerade so, als ich hätte ich mein Leben lang darauf gewartet.
Sebastian ...
Als ich zu Bett ging, blieb der Platz neben mir leer. Den Knopf aus Perlmutt legte ich unter mein Kissen.
Gedankenschwer drehte ich mich von einer Seite auf die andere, hoffte auf Schlaf, doch Sebastians Gesicht folgte mir und ließ mich nicht zur Ruhe kommen. In seinem Blick hatte ich etwas Verborgenes entdeckt, hatte etwas gefunden, das ich noch bei keinem anderen Menschen zuvor gesehen hatte.
Lange lag ich wach.
*