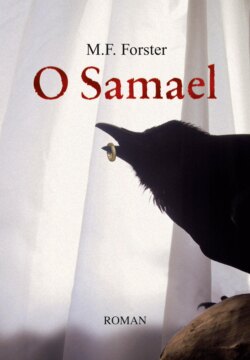Читать книгу O Samael - Martin Francis Forster - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII
Mein Platz war in der Kammer neben der Küche. Der kleine Raum war im Sommer angenehm kühl und im Winter wegen des Ofens hinter der Wand immer mollig warm. Im Herbst wurde die Matratze mit frischem Stroh und das Kissen mit neuen Federn gestopft. Es war ein guter Platz, auch wenn die Kammer so eng war, dass kaum das schmale Bett hinein passte. Mehr brauchte ich nicht. Bei Tag arbeitete ich in der Werkstatt, gegessen wurde gemeinsam mit der Familie in der Küche, und zum Schlafen zog ich mich in mein kleines Himmelreich zurück. Jeden Abend gab es einen großen Kanten Brot, ausreichend Schmalz mit Schweinespeck und immer eine kräftige Suppe.
Trotz seiner strengen Miene war Meister Esau ein ruhiger und gutmütiger Mann, der seine Töchter über alles liebte. Von Natur aus groß und breitschultrig, ging er doch meist gebeugt, so als drückte ihn ein Kummer, was, wie mir Ida einmal erzählen sollte, mit dem frühen Tod seiner Frau zusammen hing. Ich habe den Meister selten lachen hören, doch wenn wir zum Nachtmahl in der Küche um den Tisch saßen und er seine drei Töchter betrachtete, dann strich oft ein Lächeln über sein Gesicht – ein schwermütiges Lächeln allerdings, in das sich die Trauer über seinen Verlust mischte. Elena-Maria, Katharina-Maria und Ida-Maria mussten jede auf ihre Weise ein Abbild der toten Mutter sein, denn anders als der Vater waren sie zierlich, anmutig und großäugig. Jeden Tag gleich dreifach an sein Unglück erinnert zu werden, jeden Tag aufs Neue, schien mir ein hartes Los für diesen Mann zu sein, was seine Liebe zu ihnen jedoch keinesfalls minderte, sondern ihr im Gegenteil eine besondere Innigkeit verlieh. Er behütete die Mädchen wie seinen Augapfel, und abends, wenn sie in ihren Betten lagen und schliefen, zog er die große Standuhr in der Küche auf, und von meinem Lager nebenan hörte ich ihn dabei mit dem Lieben Gott reden; dass dieser die Güte besitzen möge, seine Töchter auf allen Wegen zu begleiten, sie zu beschützen und alles Leid von ihnen fern zu halten.
So nachsichtig der Meister mit mir war, so sehr forderte mein eigener Eifer mir alles ab, was ich geben konnte und oftmals gar mehr. Beinahe verbissen stürzte ich mich auf jede Arbeit, die Meister Esau mir zuwies und sog alles, was er mir sagte, zeigte und beibrachte, begierig in mich auf.
Abends fiel ich erschöpft, aber froh in mein Bett und war bereits eingeschlafen, bevor auch nur ein einziger Gedanke in meinem Kopf zu Ende gedacht werden konnte. Tagsüber schwang ich den Besen, kehrte Holzspäne zusammen, schichtete Bretter, lernte Raubank, Falzhobel und Ziehklinge zu unterscheiden. Mit dem Fuchsschwanz hatte ich daheim schon oft gearbeitet, Fein- und Gratsäge jedoch waren mir neu. Nicht lange, und ich durfte Geißfuß, Fäustel und Stechbeitel an minderwertigen Reststücken ausprobieren, um die Eigenheiten der vielen unterschiedlichen Holzarten zu erfassen. Die Kiefer war sanft und nachgiebig, weich und federnd, freundlich und unterwürfig. Die Birke roch aromatisch. Die Eiche widersetzte sich nur vordergründig und wollte eigentlich genommen werden. Bei der Kirsche musste man mit fester Hand vorgehen, sonst entzog sie sich dem Griff und ging ihren eigenen Weg.
«Holz lebt, und jedem noch so kleinen Stück wohnt ein wenig von der Seele des Baumes inne. Finde die Seele, und du kannst mit dem Holz machen, was immer du möchtest«, lehrte Meister Esau mich.
Manchmal schnitt ich mich oder rutschte mit der Feile ab und rieb mir die Fingerkuppen blutig. Einmal sägte ich mir so tief in den Daumen, dass Elena mir einen Verband aus Leinen anlegen musste.
Der Meister lachte darüber nur. »Das gehört dazu«, meinte er. »Sonst begreifst du es nicht recht.«
Zum Glück verheilten die kleinen Wunden immer schnell, und mit jedem Tag wurden meine Finger geschickter im Umgang mit den Werkzeugen und dem Material. Irgendwann tischlerte ich meinen ersten Schemel, ein unscheinbares Möbel aus einer runden Holzscheibe und drei gedrechselten Füßen – einfach und ohne Schnörkel. Dann einen Hocker mit verzapften Querstreben, später eine Kassette, eine Schmuckschatulle und, als ich besser wurde, sogar ein Schränkchen, das mit einfach geschmiedeten Beschlägen versehen war und bald einen Käufer fand, was mich stolz machte.
Dank meiner guten Auffassungsgabe begriff ich schnell, worauf es ankam, verstand, welche Öle die Oberflächen zum Leuchten bringen konnten, erkannte, welche Pasten aus Wurzeln und Wachs die Holzstruktur am besten hervor hoben. Man musste mir eine Sache nur einmal zeigen, schon sah ich, was zu tun war und konnte so den Meister bei seiner Arbeit entlasten.
Dem Meister wiederum gefielen mein Eifer und meine Wissbegier. Ganz offensichtlich fand er Gefallen daran, mich zu unterrichten und mir die vielen kleinen Geheimnisse der Tischlereikunst zu verraten. Diese ungewohnte Aufgabe vertrieb seine dunklen Gedanken, und des Morgens begann er das Tagewerk mit zunehmender Freude. Die alte Lust an der schöpferischen Tätigkeit war wieder erwacht, die Qualität seiner Arbeiten gewann stetig, was sich herumzusprechen begann, und so kamen nach wenigen Wochen selbst aus weiter abgelegenen Dörfern neue Kunden.
Meister Esau war sehr zufrieden mit mir, und ich glaube, er fing an, mich als den Sohn zu sehen, den er nur wenige Stunden gehabt hatte, und der kurz nach der Nottaufe gestorben war.
»Gute Arbeit, Junge«, brummte er oft.
»Danke, Meister«, sagte ich mit dem Lächeln, von dem ich wusste, dass er es sich von seinem Sohn gewünscht hätte, und tatsächlich nannte er mich eines Abends versehentlich »Albert« statt »Adam« und schien seinen Fehler nicht einmal zu bemerken.
So verging Monat für Monat. Sechs Tage in der Woche arbeitete ich hart. Sonntags nach der Messe lernte ich weiterhin mit den anderen Kindern aus dem Dorf Lesen und Schreiben bei Fräulein Rinker.
Nach der Sonntagsschule besuchte ich den Hof meiner Großmutter, brachte mal einen Schinken, mal einen Laib Brot als Aufmerksamkeit vom Meister mit. Meinen Vater traf ich selten an, und meine Großmutter murmelte auf meine Frage nach ihm irgendetwas von einer »Dirne« und wischte das Thema damit beiseite.
In den späten Nachmittagsstunden machte ich mich dann wieder auf den Weg zur Schreinerei, die ich mittlerweile als mein eigentliches Zuhause betrachtete.
Der Winter kam und ging, und mit ihm zogen Weihnachten, mein Geburtstag und das Dreikönigsfest vorbei. Von der ungeliebten Fastenzeit, die in Großmutters Haus streng eingehalten worden war und die ich gehasst hatte, war in der Schreinerei wenig zu spüren.
»Was soll das für ein Handwerker sein, der sich nicht ordentlich stärken darf?«, war des Meisters Ansicht, der ansonsten ein frommer Mann war und dem lieben Gott selbst den Verlust seiner geliebten Frau nicht zum Vorwurf machen wollte.
Mir tat das gut, und schon im Mai war ich ein gutes Stück gewachsen, und ich war größer und kräftiger als noch wenige Monate zuvor.
Das Leben in der Schreinerei gefiel mir. Die Werktage hatten ihren festen Rhythmus aus Arbeit und Schlaf, die Sonntage, mit ihren Predigten in der Kirche und dem Schweinebraten auf dem Tisch, rahmten die Wochen, die ins Land zogen. Die Fastenzeit endete mit dem Osterfest, der Sommer mit den ersten Herbststürmen, und in der Weihnachtszeit zog der Duft von Zimt und Sternanis durch die Schreinerei.
Doch auch vor einem frommen Haus macht der Teufel nicht lang Faxen, wenn er es sich in den Kopf gesetzt hat, seinen Klumpfuß über die Schwelle zu setzen.
Im Frühling meines zweiten Lehrjahres änderte sich etwas im Haus von Meister Esau.
Hatten seine Töchter mich bis dahin, nun, nicht gerade wie Luft behandelt, aber doch weitestgehend unbeachtet gelassen und es selbst beim allabendlichen Essen vermieden, mich anzusehen, so fing ich mit einem Male die kurzen Blicke von Elena und Katharina auf. Vorsichtige Blicke voller Neugier und Staunen; von Elena, der älteren, weniger verholen als von Katharina.
»Noch einen Schluck Bier, Adam?«, hieß es.
Oder: »Bist du auch satt?«
Ich sagte: »Aber ja!« oder »Noch nicht ...« und lächelte.
Ich genoss diese ungewohnte Aufmerksamkeit. War ich zunächst auch irritiert, so fing ich schon bald an, mir einen Spaß daraus zu machen, die Mädchen länger anzuschauen und meinen Blick nicht als erster abzuwenden. Mir fiel auf, wie ihnen dann das Blut in die Wangen schoss, und mit welcher Verlegenheit sie im Nu den Kopf abwandten und nach einer Beschäftigung für die Hände suchten.
Ich wusste, dass Elena seit über einem Jahr Phillip Kohlmorgen, dem Sohn des Dorfbäckers, versprochen war. Ich wusste auch, dass die Hochzeit mit dem ungelenken, linkischen jungen Mann im Mai bevor stand.
Phillip war recht schmalbrüstig und gleichzeitig hochgewachsen, was ihn an einen Kochlöffel erinnern ließ. Seine Bewegungen hatten immer etwas Fahriges, so als wüsste er nie genau, wohin mit den dünnen Armen, wenn man nichts in den Händen hält, und was tun mit den schlaksigen Beinen, wenn sie eigentlich still halten sollen. Sein Gesicht war obendrein von etlichen Pickeln verunstaltet, aber er hatte einen offenen Blick und die Leute mochten ihn wegen seiner höflichen, zuvorkommenden Art. Elena stand ihm in Freundlichkeit in nichts nach, war jedoch so hübsch, dass ich nicht verstand, was sie bewogen haben konnte, dieser Verbindung widerspruchslos zuzustimmen.
Vielleicht war es ihr Ausdruck von Widerstand, das trotzige Aufbegehren eines jungen Mädchens, oder einfach nur Resignation, was zu dem führte, was in der Nacht vor der Hochzeit geschah. Vielleicht war es einfach das pure Verlangen, die reine Begierde des Körpers. Vermutlich aber summierte sich von allem etwas zu einer neugierigen Abenteuerlust, die Elena in jener Nacht zu mir trieb.
Ich erwachte erst, als ihr Kopf schon auf meiner Brust lag und der lichthelle Mädchenduft ihrer Haare mir in die Nase stieg.
Eben noch hatte ich im Traum Eichendielen auf ihr Maß gestutzt, nun lag ein Engel neben mir, nackt und zitternd. Niemals zuvor hatte ich etwas so Weiches wie Elenas Haut gespürt; nie zuvor hatte ich diese besondere und einzigartige Art von Wärme, wie sie nur ein anderer Körper geben kann, kennen gelernt. War ich vielleicht gar nicht wach? Schlief ich tief und fest, allein auf der strohgestopften Matratze in meiner dunklen Kammer? Ich wusste es nicht. Es war mir auch nicht wichtig zu wissen, denn egal ob wach oder schlafend, diese nachttrübe Illusion nahm ihren Fortgang in wandernden Fingern, die von meiner Brust über den Hals strichen, bis sie den Mund fanden. Dort verharrten sie kurz, als wollten sie ein »Pssst« andeuten, dann schob sich der Zeigefinger zwischen meine Lippen, die sich öffneten, und ich saugte an der Fingerspitze. Ihr Gesicht kam näher an meines; ich spürte es, weil ihr Haar auf meine Stirn fiel. Sie zog die Finger zurück, griff mir in den Nacken und dann berührten sich unsere Münder.
Weder die Küsse, noch ihre Hände, noch das Kribbeln ihrer Haarspitzen auf meinen Schultern habe ich je vergessen. Am eindringlichsten ist mir jedoch das vernehmliche Schweigen, mit dem dies alles geschah, in Erinnerung geblieben, die Lautlosigkeit, mit der wir uns streichelten, das stumme Ja in der tiefen Stille, das der konturlosen Nacht die Wirklichkeit nahm.
Und an diese Stille, über die Maßen verstärkt durch das verschwörerische Rascheln des Strohs in der Matratze, kettete sich die Ahnung, dass – aller Inbrunst des Neuen zum Trotz – irgendetwas fehlte. Etwas, das ich unmöglich zu benennen wusste.
Als sie ihren Schoß sanft gegen mein Becken drückte, wuchs meine Erregung. Ich rieb mein geschwollenes Glied erst vorsichtig, dann fester gegen ihre Bauchdecke. Elena drehte sich auf die Seite, auf den Rücken. Ihre Hand griff meinen Oberarm fest, so dass ich mitschwang und nun auf ihr zu liegen kam. Das männliche Werkzeug, das mir die Natur mitgegeben hatte, fand, wenngleich noch gänzlich unerprobt, seinen Bestimmungsort von allein. Ohne ein einziges Wort zu wechseln, lagen wir beieinander. Selbst in dem Moment, als ich in sie eindrang, kam kein Laut über ihre oder meine Lippen. Unsere Bewegungen pendelten sich aufeinander ein, wurden schneller. Ihr Atem veränderte sich. Schweiß lief mir über den Rücken. Erst als ich etwas Fremdes in meinem Mund schmeckte, bemerkte ich, dass ich ihr in die Unterlippe biss.
Warm, süß und metallisch lag ihr Blut auf meiner Zunge. Der Frevel dieser Nacht hatte seinen ganz eigenen Geschmack.
Am nächsten Morgen weckte mich nicht wie sonst das Krähen des Hahnes. Ich verschlief, denn der Hahn war tot. Erst lautes Poltern auf der Holztreppe ließ mich hochschrecken.
Etwas war anders als sonst. Eine ungewohnte Unruhe war zu spüren. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen, fühlte mich auf fremde Art benommen und aufgewühlt zugleich. Dann erinnerte ich mich an den merkwürdigen und schönen Traum der letzten Nacht, und als meine Gedanken klarer wurden, sah ich mich in meiner Kammer nach Anzeichen um, die mir verraten konnten, ob meine Sinne mir einen Streich gespielt hatten oder aber, ob Elena wirklich hier bei mir gewesen war. Ich hatte ihre warme Haut gespürt und den süßen Duft ihrer Haare eingeatmet. Doch ich konnte weder sagen, wie und wann sie sich zu mir herein geschlichen hatte, und erst recht nicht, wann sie wieder hinausgeschlüpft war.
Noch schlaftrunken zog ich mich langsam an, während ich meine Gedanken zu ordnen versuchte. Ich fürchtete, man könne mir, wenn ich jetzt aus meiner Kammer in die Küche trat, den verwerflichen Traum (ich war mir fast sicher, dass es einer gewesen war) ansehen. Vielleicht würde Elena mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen. Oder sie würde sich angewidert abwenden. Meine Fantasie gaukelte mir die schlimmsten Bilder vor. Ich stellte mir sogar vor, wie der Meister mich in Schimpf und Schande aus dem Lehrvertrag entließ und unter lautem Geschrei aus der Schreinerei prügelte.
Zögernd öffnete ich die Kammertür – und stand ganz allein in der Küche. Ich stutzte und rieb mir die Augen. Vor mir türmte sich ein Berg von Köstlichkeiten auf. Der lange Esstisch war über und über beladen mit verschiedenen Würsten, mit Schinken, gebratenem Hähnchen und mehreren Laib Brot, und mittendrin stand ein Krug mit einem Strauß weißer Blumen. Vor dem Fenster war zusätzlich ein Tischchen aufgestellt worden, das fast nicht genug Platz bot für die fünf oder sechs Kuchen samt einer wunderschönen Torte aus mehreren Schichten, die mit Puderzucker, Glasur und Dutzenden rosaroten Röschen aus Marzipan verziert war.
Ich beugte mich staunend über die Torte und streckte die Hand aus, um eines der Röschen vorsichtig mit dem Finger zu berühren. In diesem Moment kamen zwei Frauen, dem Anschein nach Mutter und Tochter, von draußen herein, und mit einem Seufzer der Anstrengung wuchteten sie einen schweren Bräter auf den Herd. Der prallgefüllte Bauch einer Gans blitzte über den Topfrand.
Die Jüngere bemerkte mich. Sie verschränkte frech die Arme vor der Brust und rief vorlaut: »Ja, was für einen Langschläfer haben wir denn da? Hast du nichts zu tun?«
«Martha, benimm dich!«, wies die andere sie zurecht.
Das Mädchen zog schnippisch die Augenbrauen hoch. »Schau ihn dir doch an, Mama! Steht herum wie ein Dummbeutel und glotzt wie ein Ochse. Draußen können sie seine Hilfe sicher gut gebrauchen.«
»Nun lass den Buben in Frieden und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten! Hör auf zu murren, du bist schließlich nicht zum Schimpfen hier.«
Von oben drang das Gekicher der Mädchen zu mir, dann sprang jemand leichtfüßig die Treppe hinunter. Hinter den beiden Frauen erhaschte ich einen Blick auf Ida – im weißen Kleidchen und mit einem geflochtenem Kranz aus Blumen auf dem Kopf. Vor dem Haus herrschte buntes Stimmengewirr. Ich hörte Elena nach Katharina rufen.
Es fiel mir schlagartig ein: Heute war der große Tag, das Hochzeitsfest! Elena und Phillip würden heiraten. Darum lag diese Aufregung über dem Haus, deshalb die Unruhe. Festliche Betriebsamkeit hatte sich breit gemacht, Dinge mussten getan und erledigt werden, welcher Art sie auch immer sein mochten. Und ich hatte verschlafen!
Ich hatte keinerlei Ahnung von Küchenarbeit, von Pfannen und Töpfen, erst recht nicht von Kleidern, Haarschmuck, Blumengebinden oder dem anderen Weiberkram und stand unschlüssig herum.
Der Meister steckte seinen Kopf zur Tür herein. »Ah, Adam, guten Morgen! Du kannst draußen zur Hand gehen und beim Schmücken der Kutsche helfen.«
»Steht rum und hält Maulaffenfeil«, mischte sich wieder die ein, die zuvor mit Martha angesprochen worden war.
»Lasst den Jungen doch erstmal was essen; der ist ja noch gar nicht richtig wach!«, gab die ältere Frau zurück und zwinkerte mir wohlgesonnen zu.
»Ja, aber ja, natürlich. Und danach zieh dich um! Dort hab ich was für dich hingelegt.« Meister Esau wirkte auffallend zerstreut und deutete mit dem Kopf in eine unbestimmte Richtung. In seinem besten Sonntagsstaat (auch er mit neuem Hemd und neuer Weste), drehte er sich einmal um sich selbst, kratzte sich an der Stirn und schien vergessen zu haben, weshalb er eigentlich in die Küche gekommen war.
Ich nickte nur; mein Mund war zu trocken, um etwas darauf zu erwidern. Der Meister marschierte wieder hinaus, die beiden Frauen eilten ihm hinterher, und ich atmete erleichtert auf. Niemand hatte mir etwas angemerkt – alle waren viel zu aufgeregt und zu beschäftigt.
Über dem Stuhl vor meinem Platz hing ein nagelneues, weißes Leinenhemd. Ich zog das alte Hemd aus und streifte das neue über. Es kratzte unangenehm auf der Haut. Mein Magen begann zu knurren, und ich stahl mir eine Scheibe von einem Braten.
Hinter meinem Rücken in der Kammer scharrte ein Pferdefuß über die Dielen, und es klang wie ein zärtliches Lied, dessen Refrain aus nur einem einzigen Wort bestand, als der Teufel leise raunte: »Sünder!«
Ich hatte keine Angst vor dem Teufel. Nein, hatte ich nicht. Über vierzehn Jahre lang, seit meiner Geburt, hatte er sich vor mir verborgen gehalten. Den Ritt auf seinem Rücken in der allerersten Stunde meines Lebens, den hatte ich längst vergessen. In der Tat hatte ich nicht eine Sekunde an seine Existenz geglaubt! Selbst in den Stunden, in denen Pfarrer Michels des Sonntags seine Predigten von der Kanzel den Kirchgängern entgegen schmetterte, wenn er die sieben Höllen in all ihren grausigen Einzelheiten beschrieb, wenn er die unzähligen Strafen Luzifers und seiner tausend Helfershelfer in derart glühende Worte kleidete, die auf der Seele brannten wie heiße Kohleeisen auf der nackten Haut, so dass alle Schäflein in ihren Bänken erschauderten und sich nach der Messe vor dem Beichtstuhl einreihten, um Vergebung zu erfahren, war ich überzeugt, dieser Hokuspokus sei nichts weiter als der schallgewordene Wahnsinn eines kleinen Mannes, der in seinem fleckigen Talar wichtigtuerisch hinter dem Altar auf und ab hüpfte.
Der Teufel war für mich eine nebelhafte Fantasie in Rot und Schwarz.
Trotz alledem hatte ich nicht den geringsten Zweifel, wessen Finger in eben diesem Augenblick sanft über meinen Nacken streiften. Eine lang vergessene, und doch so vertraute Berührung. Gänzlich anders und zärtlicher noch, als die der vergangenen Nacht.
»Adam ...«, summte er mir über die Schulter in das gesunde Ohr. »Adam ..!«
Nein, ich hatte keine Angst vor dem Teufel. Ich drehte mich langsam um – und vor meinen Augen löste der Schwarze sich in Rauch auf. Mit ihm verblassten der rote und der weiße Fleck auf meinem Laken, und ihr Schwinden ließ die Ereignisse der letzten Stunden zu einer unwirklichen Erinnerung werden.
*