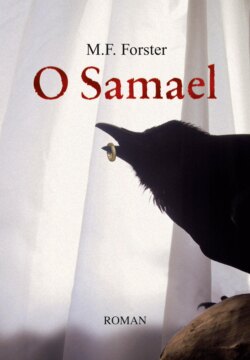Читать книгу O Samael - Martin Francis Forster - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVIII
Am nächsten Morgen war die Welt eine andere geworden; für mich wie auch für ihn. Wir versuchten erst gar nicht, so zu tun, als wäre nichts geschehen.
Sebastian hatte sich in einer Ecke der Werkstatt ein Nachtlager aus Decken gerichtet. Doch ebenso wie ich, hatte auch er offensichtlich keinen Schlaf gefunden; tiefblaue Schatten lagen unter seinen Augen, und übernächtigte Blässe hatte das sonst so frische Rot seiner Wangen verdrängt.
Über Nacht hatte Regen eingesetzt. Dicke Tropfen prasselten gegen die Scheiben, und trübes Licht sickerte träge in die Werkstatt. Der Herbst schickte seine windigen Boten voraus. Der Meister hatte es sich in letzter Zeit zur Gewohnheit gemacht, morgens ein wenig länger im Bett liegen zu bleiben, und so waren wir zwei, Sebastian und ich, zu dieser frühen Stunde unter uns.
Etwas berührte meine Seele, als ich ihn übermüdet an der Hobelbank hantieren sah. Er spannte umständlich ein Tischbein in die Drehbank, die Lippen vor Konzentration fest aufeinander gepresst. Ich blieb stehen.
Als ich – verwundert über mich selbst – seine kräftigen Schultern und die sehnigen Arme betrachtete, nahm in mir ein Wunsch seine irrlichternde Gestallt an, der, und ich schwöre es, nicht von körperlicher Natur war. Alles, was ich mir in diesem Moment wünschte, war, dass Sebastian für immer in meiner Nähe sein möge. Ich atmete tief ein und wieder aus.
Als er mich bemerkte, sah er mich beschämt an. Nach einer Weile nickte er langsam.
»Du bist wütend«, stellte er fest.
Ja, das war ich. Aber nicht auf ihn. Wie hätte ich wütend auf ihn sein können? Wie sollte ich zugeben, dass genau das passiert war, von dem ich nicht gewusst hatte, dass ich es mir insgeheim gewünscht hatte? Also schwieg ich.
»Kann ich verstehen. Das war dumm von mir.« Und dann, nach einer Pause, sagte er: »Es tut mir leid.«
Das Tischbein rutschte aus den Spannbacken und krachte dumpf auf den Boden.
Ich hob es auf, reichte es ihm, und als er es fasste, hielten wir beide das Stück Holz für einen Augenblick fest.
Mehr brauchte es nicht, um das stille Einverständnis zwischen uns wieder herzustellen. Eine Zeit lang standen wir einfach nur da, unschlüssig schwankend in dieser Mischung aus Verlegenheit, Erleichterung und Hochgefühl. Etwas brannte mir auf der Zunge, eine Gewissheit fand ihren Weg, doch der Moment verstrich, ohne dass mir ein Geständnis über die Lippen kommen wollte.
»Du siehst aus wie ein Haufen Katzenscheiße«, grinste er schließlich.
»Na, das sagt gerade der Richtige. Hast du schon in den Spiegel geschaut?«, gab ich zurück.
Der Regen ließ nach, warmgolden brach die Morgensonne durch die Fenster.
Meister Esau polterte in die Werkstatt und schmetterte uns gut gelaunt »Männer, ans Werk!« entgegen.
Die folgenden Wochen verflogen. Nie wieder habe ich soviel gelacht wie zu jener Zeit. Wir waren mit Eifer bei der Arbeit, waren flink und trieben manchmal sogar unsere Späße mit dem Meister, wenn uns der Schalk im Nacken saß. Doch er war überaus zufrieden mit dem, was wir leisteten, und natürlich war er froh über das Geld, das mit den neuen Aufträgen reichlich in die Kasse floss, und schüttelte daher nachsichtig den Kopf und ließ uns gewähren.
Abends hatten wir einen Bärenhunger, und nach dem Essen zog es uns hinaus ins Freie. Wir strichen durch die Felder, wanderten durch den Wald oder setzten uns ans Ufer des nahen Sees. Wir redeten oder schwiegen und waren uns selbst genug. Wir brauchten keine Gesellschaft, außer die des anderen. Nachts legte er seinen Arm um mich. Er grub seine Nase in meinen Nacken, und morgens erwachten wir in der gleichen Stellung, in der wir eingeschlafen waren.
Wie und wo er das Tier aufgelesen hatte, konnte ich nicht sagen. Aber eines Abends war Sebastian für eine gute Stunde verschwunden, und als er wiederkam, trug er diesen rotbraunen Welpen auf dem Arm.
»Sollte ersäuft werden, unsere kleine Schönheit. Eine Schande, sage ich«, war die knappe Erklärung, die er abgab.
Meister Esau hatte zunächst Vorbehalte und verlangte, dass Sebastian die Hündin zurückbrachte. Als er jedoch sah, wie verliebt seine Töchter das Tier streichelten und liebkosten, hatte er ein Einsehen und gab nach.
»Nun ja. Ein ordentlicher Hofhund kann nicht schaden«, brummte er, und damit war die Sache abgetan.
Wir tauften die Hündin, augenscheinlich eine Mischung aus Bardino und anderen, nicht näher erkennbaren Rassen, auf den Namen Henriette (ein Vorschlag, der von Ida kam – ihre Lieblingspuppe, deren Haar die gleiche Farbe hatte wie das Fell des Welpen, hieß ebenso), doch schon bald riefen wir sie nur noch Henni.
Henni war als Geschenk an mich gedacht gewesen, aber alle im Haus, selbst Meister Esau, schlossen sie binnen kürzester Zeit ins Herz. Die Hündin wiederum verteilte ihre Zuneigung weniger gerecht. Zwar begrüßte sie uns alle mit freudigem Schwanzwedeln und leckte jede Hand zutraulich, die sich ihr entgegenstreckte, doch Sebastian, grad so, als wüsste sie, wem sie ihr Leben zu verdanken hatte, blieb von der ersten Stunde an ihr Favorit und Liebling.
Das Laub begann seine Farbe zu wechseln, der September neigte sich dem Ende zu. Langsam mischten sich braungelbe Flecken unter das Grün, und die Tage wurden kürzer. Mit den Herbstwinden wurden wir übermütig. Wir hatten Schulter an Schulter im Gras gelegen und den ersten Zugvögeln bei ihrer Reise gen Süden nachgeschaut, als Sebastian sagte: »Stell dir vor, du könntest fliegen! Wäre das nicht herrlich? Einfach so von Land zu Land, keine Grenzen, völlig frei ... Und wo’s dir gefällt, da bleibst du eine Weile. Bis du Lust hast, weiter zu ziehen. Wohin würdest du fliegen wollen?«
Visionen von verwüsteten Landschaften, über die ich hinweg glitt, tauchten jäh vor mir auf. Henni, die eingerollt friedlich auf meinem Bauch geschlummert hatte, sprang mit einem Kläffen auf. Die Bilder von flammenden Feldern und verkohlten Baumskeletten enthüllten eine Drohung, und um sie zu verwischen, damit sie keine Macht bekamen, sagte ich schnell: »Ich glaube nicht, dass wir zum Fliegen geschaffen sind.«
Henni hatte sich an Sebastians Seite verkrochen.
»Da magst du Recht haben. Hier unten im Gras gefällt es mir gerade auch ganz gut.« Er zwinkerte mir zu. »Aber ich habe eine Idee.«
Die Bilder in meinem Kopf verblassten. Sebastian kraulte der Hündin den Nacken, dehnte die Pause genussvoll aus und wartete, bis meine Neugier wuchs.
»Nun sag schon!«
»Lass uns Drachen bauen! Die können für uns den Himmel erobern, während wir brav am Boden bleiben.«
Was für ein Einfall! Noch am selben Abend stibitzten wir Martha ein altes Laken aus dem Wäscheschrank, bestrichen das Leinen vorsichtig mit verdünntem Kleister, klebten vier federleichte Holzstäbe zu zwei Kreuzen zusammen und zogen die zurechtgeschnittenen Stoffteile darauf auf. Immer wieder berührten sich unsere Hände bei der Arbeit, mal aus Versehen, meistens aus purer Absicht. Säuberlich schlugen wir die Stoffkanten um und während alles trocknete, falteten wir aus Zeitungspapier Schleifen für die Drachenschwänze. Beim Krämer im Dorf besorgten wir uns am nächsten Tag feinste Angelschnur, und den Meister erleichterten wir heimlich um eine Flasche von seinem besten Roten.
Mit unseren Drachen, der Flasche Wein, zwei Bechern und einem großen Stück Käse zogen wir los und suchten nach einem Platz, der uns zusagte.
Wir hatten den See schon halb umrundet, und die Birken warfen lange Schatten, als wir eine stille, friedliche Wiese fanden. Ich war früher schon einmal hier gewesen. Doch mit dem Freund an meiner Seite war es anders. Der Ort wurde zu etwas Besonderem.
Der Wind fuhr in sanften Böen durch die Baumkronen und ließ die Blätter rauschen. Henni sprang voraus, bellte verspielt und scheuchte eine Entenfamilie auf, die sich schimpfend aufs Wasser flüchtete. Ein paar Krähen schrien.
In der einsetzenden Abenddämmerung liefen wir durch das Gras und zogen unsere Drachen, die mühelos aufstiegen, hinter uns her. Wir gaben ihnen Stück für Stück mehr Leine und sahen zu, wie der neugierige Wind, der sie schnell höher trug, besitzergreifend an ihnen zog.
Dann stießen wir zwei Äste in den Boden, banden die Schnüre daran fest und überließen die Drachen sich selbst und den Lüften. Sebastian zog sein Hemd aus, legte es ins Gras und setzte sich darauf. Ich tat es ihm gleich. Er packte Wein und Käse aus, schenkte die Becher voll und stieß mit mir an.
»Auf das Leben!«, rief er laut.
»Auf das Leben! Auf die Schreinerei! Auf den Meister, der uns den Wein spendiert hat! Auf die Wanderschaft, die dich hierher geführt hat! Auf dich! Soll alles so bleiben, wie es ist!«, übertrumpfte ich ihn.
Der Rotwein war süffig und stieg mir schnell zu Kopf. Bald hatte ich das Gefühl, dass mein Gesicht glühte. Sebastian schnitt mit seinem Klappmesser Stück um Stück von dem Käse ab und reichte es abwechselnd mir, dann steckte er sich selbst eins in den Mund.
Während wir in den Himmel schauten, begannen wir herumzualbern. Wir machten Scherze und dachten uns Namen für unsere Drachen aus: Caesar und Kleopatra zum Beispiel, Siegfried und Kriemhild oder gar Pfarrer Michels und Fräulein Rinker. Die Fantasie ging mit uns durch und wir versuchten, uns gegenseitig mit den verrücktesten Einfällen zu überbieten.
Irgendwann rief ich: »Jetzt weiß ich! Ich nenne ihn einfach Sebastian.«
Er strahlte mich an. Auf seiner Wange, dort, wo bei mir die Narbe saß, zeigte sich ein Grübchen.
»Dann soll meiner Adam heißen. Das ist gut! Adam und Sebastian fliegen durch die Luft!«
Die Welt schien mir vollkommen, alles war gut, so wie es war. Der Wind, die Bäume, der Himmel. Sebastian und ich.
Aus dem Unterholz am Waldrand hörte ich Zweige knacken. Ich sah ein Eichhörnchen flink eine Eiche hochklettern und im Blattwerk der Krone verschwinden. Ein Krähenschwarm flog aufgeregt auf. Aus dem Schwarm löste sich ein einzelner Vogel, größer als die anderen, und stieß mit zornigem Gekrächze auf meinen Drachen herab. Die Bespannung riss auf, der Drache trudelte in weiten Spiralen zur Erde und seine Schnur verhedderte sich mit der des anderen. Beide Fluggeräte gerieten ins Taumeln, und schließlich krachten sie am Fuße eines Baumes auf die Erde.
Wir rannten zu der Stelle, um den Schaden zu begutachten, doch offensichtlich war nichts mehr zu retten. Henni schnüffelte neugierig an den zertrümmerten Teilen. Sebastian bückte sich und hob das heillose Gewirr aus Stoff, Schnur und zersplitterten Stäben hoch.
»Weißt du, Adam, ich liebe dich.«
Er sagte es, als sei es selbstverständlich. Völlig unbeschwert und fröhlich klangen sein Worte.
»Und wenn ich einmal sterben muss, dann soll es genau so enden: Arm in Arm mit dir vom Himmel stürzen«, lachte er.
Ich schaute dem schwarzgefiederten Teufel, der über uns kreischend seine Kreise zog, hinterher. Dann sah ich ihn an und sagte: »Ja.«
Wenn ich heute zurück blicke, weiß ich, dass auch ich ihn liebte – vielleicht nicht mit dieser unschuldigen Aufrichtigkeit, die er mir entgegenbrachte und die ihn beinah das Leben gekostet hätte, weil sie mit ihrer Reinheit den Neid des Teufels hervorrief. Aber doch auf diese, in meinem Leben einzigartige, mir so uneigennützig wie mögliche Weise. Am Tag des jüngsten Gerichts allerdings, und daran, dass dieser Tag kommen wird, hege ich keine Zweifel mehr, wenn ich also vor Gericht stehe, wird dieses kleine bisschen Liebe, das auf der einen Seite in die Waagschale gelegt werden wird, nur unwesentlich zu meinen Gunsten beitragen, denn alles andere, jede einzelne meiner vielen Sünden wiegt ungleich viel mehr als die Summe all meiner guten Taten oder Eigenschaften. So wird Gott mich gleich zweimal trennen von denen, die mir etwas bedeuteten – erst in diesem, dann auch im nächsten Leben. Und das wird, allen Feuerqualen der Hölle zum Trotz, die schlimmste aller Strafen sein.
Der Michaelistag kam, und am darauf folgenden Sonntag feierte man im Dorf das Erntedankfest.
Die Hauptstraße und der Kirchplatz waren reich mit farbenfrohen Teppichen aus Gräsern, Getreide und Blüten geschmückt; bei der Prozession wurde die prächtige Erntekrone aus geflochtenen Ähren feierlich von sechs Männern auf einer Bahre in die Kirche getragen, und Pfarrer Michels Rede war gegen seine üblichen Gepflogenheiten einmal weniger von Verdammnis und Sündenfall geprägt, sondern war voll des Lobes und des Dankes an den Schöpfer und klang fast schon heiter, ja beschwingt.
»Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten«, endete er seine Predigt.
Die Ernte war in diesem Jahr auch ohne Tränen sehr üppig ausgefallen, und entsprechend gut gelaunt wurde nach der Messe gefeiert.
Der Tag war sonnig und ausgesprochen mild. Das ganze Dorf war auf den Beinen, schleppte Tische und Stühle auf den Platz, und aus jedem Haus trugen die Frauen Brote, Suppen, Braten und Pasteten herbei, wobei es schien, dass jede von ihnen versucht hatte, die Nachbarin mit den gebackenen, gebratenen und gesottenen Köstlichkeiten zu übertreffen. Die besten Kuchen hatte zweifelsohne Phillip, Elenas Mann, gebacken, doch auch die vielen anderen Leckereien ließen keine Wünsche offen. Großzügig wurden Bier und Wein ausgeschenkt, und als die Kapelle zu schnelleren Melodien wechselte, fingen die Ersten an zu tanzen.
Für mich war das neu, denn meine Großmutter, die Feiern und jegliche Form von Ausgelassenheit stets verdammt hatte, war früher nach den Gottesdiensten geradewegs mit mir zurück zum Hof gelaufen.
Ich für meinen Teil genoss das Fest umso mehr; ich lachte, schlemmte und fühlte mich wie berauscht, als Sebastian für einen kurzen Moment sein Hand unter dem Tisch auf meinen Oberschenkel legte. Just in diesem Augenblick kam Ida zu uns herüber, fasste mich an die Hand und zog mich zum Tanzen fort. Ich sah, wie Sebastian sich köstlich über meine ungelenken Bewegungen und meine Versuche, mit Ida Schritt zu halten, amüsierte. Ich genierte mich schrecklich, doch als er selber von einem anderen Mädchen aufgefordert wurde, sah ich, dass er kein bisschen besser tanzen konnte als ich oder die anderen jungen Männer aus dem Dorf, und hatte nun meinen Spaß daran, ihm spöttische Blicke zuzuwerfen. Sebastian wiederum machte sich einen Jux daraus, mich beim Tanzen mit dem Ellbogen anzurempeln oder mir absichtlich auf den Fuß zu treten, wenn er mir nahe kam, und er entschuldigte sich jedes Mal übertrieben höflich mit »Oh verzeiht, werter Hupfgeselle!«, was die Mädchen zum Kichern brachte.
Wein und Essen wollten kein Ende nehmen und so kam, was kommen musste: Als der Abend dämmerte, hatte ich mich überfressen und auch das ein oder andere Glas Wein zuviel getrunken. Mir wurde so übel, dass ich mich fortstahl und abseits der Häuser in ein Gebüsch übergab.
»Ksch!«
Ich fuhr überrascht herum. Halbverborgen im Schatten einer Hauswand stand eine fremde Gestalt, die mich unter der Kapuze eines weiten Umhangs unverwandt ansah.
»Wer ist da?«
»Du solltest schleunigst zusehen, dass du nüchtern wirst! Ich brauche deine Hilfe.«
An ihrer Stimme erkannte ich jetzt die Wurzel-Nele.
»Hilfe? Wobei? Wovon redest du?« Ich wischte mir mit dem Ärmel über den Mund und atmete tief durch.
»Komm mit, dann wirst du’s sehen!«
»Was? Was werd ich sehen?«
»Keine Zeit. Komm!«, drängte sie.
»Adam geht nirgendwo hin. Wer bist du überhaupt?«
Hinter mir war Sebastian aufgetaucht. Mein treuer Sebastian, der mich keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte und mir mit Henni an seiner Seite gefolgt war.
Nele trat aus dem Schatten. Ihre Augen waren rot unterlaufen, so als ob sie geweint hätte. Strähnen lösten sich aus ihrem hochgesteckten Haar, und sie sah abgekämpft und müde aus. Gleichzeitig wirkte sie gefasst, beinahe hochnäsig, als sie antwortete.
»Sieh an, das unzertrennliche Pärchen. Überall und immer zu zweit. Nun gut, dann kommt ihr eben beide mit. Vielleicht besser so.«
Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und schritt in Richtung Wald. Henni gab einen Laut von sich und lief der Wurzel-Nele mit wedelndem Schwanz hinterher.
»Kann das nicht bis morgen warten?«, rief ich Nele hinterher, aber ich bekam keine Antwort.
»Henni!«, rief Sebastian. Und noch einmal: »Henni!«
Die Hündin blieb stehen und blickte uns mit schief gelegtem Kopf an, machte aber keine Anstalten, zu uns zurückzukommen.
»Wer zum Teufel war diese Verrückte ohne Schuhe?« Sebastian wurde ungeduldig.
»Nele. Sie ist harmlos.«
In knappen Sätzen erklärte ich Sebastian, wer Nele war, vermied es allerdings, ihm die Umstände zu verraten, unter denen ich sie kennen gelernt hatte. Während ich sprach, dämmerte mir, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Ohne einen gewichtigen Grund hätte die Wurzel-Nele mich niemals um Hilfe gebeten. Langsam wurde ich wieder nüchtern. Meine Neugier wuchs.
»Ich denke, ich sollte ihr folgen«, sagte ich.
Sebastian sah mich an.
»Wenn du ihr vertraust, dann lass uns gehen«, meinte er nach einem kurzen Zögern.
»Ihr vertrauen? Ich weiß nicht. Ich kenne sie kaum. Aber ich habe kein gutes Gefühl, irgendetwas muss vorgefallen sein.«
»Wenn du sie kaum kennst, weshalb kommt sie dann ausgerechnet zu dir?«
»Das werde ich wohl nur herausfinden, wenn ich ihr folge.«
»Jedenfalls werde ich dich nicht alleine lassen.«
Ich war froh, dass er das sagte, und wir liefen los.
Nele war flink, und ohne Henni, die vor uns her sprang, hätten wir Schwierigkeiten gehabt, sie nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Musik vom Dorfplatz wurde schnell leiser, und bald waren die einzigen Geräusche, die wir hörten, die, die wir selbst verursachten. Zu dieser Stunde schien mir der Wald der Hexe noch viel düsterer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Doch mit Sebastian neben mir verlor er an Bedrohlichkeit. Ohne mich dafür zu schämen, griff ich nach seiner Hand und hielt sie fest gedrückt.
»Wehe der Alten, wenn es nicht etwas wirklich Wichtiges ist«, fluchte Sebastian, und ich hörte, dass er langsam genauso außer Atem geriet wie ich.
Nele stellte uns auf eine harte Geduldsprobe. Der Weg schien kein Ende nehmen zu wollen. Gerade als ich darüber nachdachte, ob wir ohne Neles Hilfe zurück finden würden, blieb sie unter einer dickstämmigen Eiche stehen. Sie sah nach oben und unsere Blicke folgten dem ihren. Henni sprang mit kratzenden Pfoten den Stamm an und winselte aufgeregt.
Meine Augen hatten sich zwar an das fahle Licht gewöhnt, dennoch musste ich zweimal hinschauen, um zu erkennen, was die Hündin in Aufruhr versetzte. Etwas bewegte sich sanft zwischen den Ästen. Ein Sack von graubraunen Kleidern schwang über unseren Köpfen.
Dann begriff ich, dass es ein Mensch war, der da mit dem Hals in einer Schlinge hing und sich sachte um die eigene Achse drehte.
Jemand hatte sich erhängt.
»Wir müssen das Seil durchschneiden.« Nele klang ruhig und bestimmt. »Allein schaffe ich es nicht, ihn dort runter zu holen.«
*