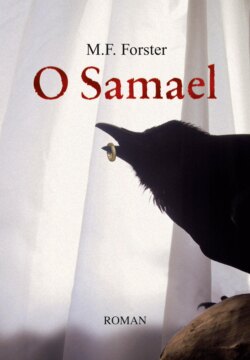Читать книгу O Samael - Martin Francis Forster - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII
Es wäre falsch, die alten Verhältnisse in der Tischlerei als ärmlich zu bezeichnen, aber beinah über Nacht war ein bescheidener Wohlstand in das Haus eingezogen, der sich überall durch Kleinigkeiten zeigte: Hier lagen neue Kissen, dort fand sich ein neuer Kerzenhalter. Alles war im Wandel.
Nach Elenas Heirat und ihrem damit verbundenem Auszug in die elterliche Bäckerei ihres Mannes, hatte ich meine Kammer hinter der Küche verlassen und war eine Treppe höher in das verwaiste Zimmer gezogen. Anfangs fühlte ich mich ein wenig verloren in dem großen Raum, doch das weiche Bett, das mir riesig erschien, mit der dicken Matratze und den warmen Decken gefiel mir. Nebenan lagen die Schlafzimmer von Meister Esau und dahinter die seiner zwei anderen Töchtern.
Über uns befand sich der Dachboden und in den ersten Nächten mit den Maigewittern tat ich kein Auge zu, denn das Gebälk knirschte und ächzte angestrengt unter den Windböen, und jeder Donnerschlag kündete von Jericho und dem nahenden Ende der Welt. Ich machte mir keinen Sorgen um den Dachstuhl, immerhin hatte der Meister seinerzeit selbst mit den Zimmerleuten Hand daran angelegt, aber der Lärm und die ungewohnten Geräusche hielten mich über Stunden wach.
Wenn mich dann doch im frühen Morgengrauen der Schlaf fand, träumte ich unruhig und wild von unter mir hinweg gleitenden Landschaften, von entwaldeten Hügeln und sturmgepeitschten Seen.
Gerne wäre ich zurück in meine vertraute Kammer mit dem winzigen Fenster geflohen, doch schon zwei Tage nach dem Hochzeitsfest war das junge Ding aus dem Dorf dort eingezogen, das mir bei unserem ersten Treffen in der Küche durch ihr freches Mundwerk aufgefallen war. Das Mädchen, Martha, sollte im Haushalt zur Hand gehen und Katharina-Maria und Ida-Maria einen Teil der Arbeit abnehmen.
Martha war von rundlicher Statur und hatte ein Apfelgesicht mit roten Wangen und den ständig wachsamen Augen eines Luchses. Als drittes von zwölf Kindern hatte sie sich daheim das Bett mit zwei Geschwistern teilen müssen, war es gewohnt, überall mit anzupacken, wo Hilfe von Nöten war und scheute keine Mühe, uns das Leben in der Tischlerei zu erleichtern, sodass sie sich bald im Haus unentbehrlich machte. Die Stuben waren sauberer als früher, die Wäsche wurde öfter gewaschen und auf den Tisch kamen jeden Abend Speisen, von denen ich bis dahin lediglich die Namen gehört hatte.
Nach den wütend polternden Nächten zeigte sich der launische Mai tagsüber von seiner allerbesten Seite, die Sonne brannte und es war heißer als im Hochsommer. Soviel Wasser, wie ich bei der Arbeit ausschwitzte, konnte ich kaum trinken, obwohl die fürsorgliche Martha uns krügeweise mit kühlem Kräutertee versorgte.
Einige Tage lang machte der fehlende Schlaf mir wenig zu schaffen. Doch dann, nach fast zwei Wochen Hitze und nächtlichen Gewittern, flimmerte mir eines Morgens der Hobel vor den Augen. Schwindel packte mich, mir wurde heiß und kalt zugleich und ich verlor das Bewusstsein.
Es war ein Flüstern: »Wach auf, Adam!«
»Wer bist du?«
»Du darfst mich nicht verleugnen, alter Kamerad!«
Er hatte sich über mich gebeugt. Ich schnappte nach Luft, und wie schon einmal zuvor, berauschte mich sein animalischer Geruch, betäubte mich und ließ mich taumeln.
Sein schwarzseidener Umhang streifte flüchtig meinen Unterarm, und in seinen Pupillen sah ich das Höllenfeuer aus Folter, Plünderei und Vergewaltigung lodern. Er kam noch etwas näher, und deutlich erkannte ich in den Flammen tausende Gesichter, junge und alte mit weit aufgerissenen Mäulern, blickte in die verzerrten Fratzen all der verlorenen Kreaturen, die sich in der gleißenden Hitze vor Qualen drehten und wandten.
»Ja, schau her. Sieh sie dir genau an! Willst du den Verdammten Gesellschaft leisten? Oder möchtest du mich nicht doch lieber deinen Freund nennen? Nein, nein, nein – nicht lange nachdenken!« Er legte den Finger auf seine Lippen. »Lausche und hör auf das, was deine Lust dir sagt!«
»Was willst du?«
»Die Frage ist: Was willst du?«
»Willst du meine Seele?«
»Die?« Er lachte leise »Die könnte ich mir einfach nehmen – die Gelegenheit dazu hätte ich schon gehabt. Erinnere dich!«
Er legte seine Hand auf meine Stirn.
Da waren sie mit einem Mal, all die lang verschütteten Bilder in den süßesten Farben! Ich sah den Gehörnten unter mir, hörte wieder das Rauschen seiner schwarzen Schwingen im Wind. Ich fühlte die Kälte seines Herzens und die Hitze seiner Leidenschaft zugleich. Ja. Ja, ich erinnerte mich: Er hatte mich getragen.
Dann wich die Furcht mit einem Mal. Was konnte mir passieren? Hatte ich doch als Säugling den Teufelsritt überlebt! Und war ich nicht getauft worden, nachdem ich mein Blut gegeben hatte? Was war mit meiner Seele? Hatte ich sie jemals gespürt, hatte ich sie gar gebraucht?
»Über deine Seele soll andernorts entschieden werden. Und dein Blut ist ein wertloses Pfand, die Andeutung eines Versprechens meinerseits; nämlich, dass ich stets da sein werde für einen treuen Freund. Nein, nicht deine Seele. Was ich will, ist deine Hand!«
»Meine Hand?«
»Deine Hand in meiner Hand. Freiwillig.« Und er hielt mir die seine hin.
Ich stieß sie bockig weg und ein erschrockener Aufschrei holte mich für einen Augenblick zurück aus meinem Fieberwahn. Vor mir an der Bettkante saß Ida, die kleine Ida-Maria, und ich hatte ihr einen Becher mit Wasser, den sie fürsorglich an meine Lippen gehalten hatte, aus der Hand geschlagen.
»Adam?«
Dann versank ich wieder weiß Gott wohin und flog mit weit ausgebreiteten Armen über wilde Landschaften, über Eichen, Tannen, Birken und Linden, die der Sturm entwurzelte.
Der Teufel hatte um meine Hand angehalten.
Ich erholte mich rasch. Als ich drei Tage später wieder vor meiner Hobelbank stand, war das erste, was ich schreinerte, ein Sarg. Meister Esau hatte dafür das beste Eichenholz, das er auftreiben konnte, spendiert, denn auf eine gewisse Weise fühlte er sich verpflichtet.
Diese Aufgabe forderte mich heraus, und so lehnte ich das Angebot des Meisters, mir zu helfen, ab. Ich strich mit den Fingern über die Bretter, ließ mein Auge über Maserung und Wuchs gleiten, nahm dann penibelst Maß, sägte, hobelte und feilte um Haaresbreite genau. Ich verzapfte und schliff, ölte und polierte mit handwerklicher Hingabe und kühler Präzision, als hätte ich mein Lebtag nichts anderes getan. Ohne zu wissen, woher ich dieses übermäßige Geschick nahm, hatte ich, als ich fertig war, an nur einem Tag ein wahres Gesellenstück geschreinert, das der ganzen Innung zur Ehre gereicht hätte und den Meister durch seine Vollkommenheit in ungläubiges Staunen versetzte.
»Ein Sarg für einen König«, sagte er.
»Kein König«, sagte ich.
Meine Großmutter war tot.
Auf dem kurzen Stück zwischen Stall und Haus war sie vom Blitz erschlagen worden.
Der Meister hatte mir morgens die Hand auf die Schulter gelegt und unbeholfen versucht, etwas Tröstendes zu sagen. Da es ihm aber schwer gefallen war, die richtigen Worte zu finden, hatte er mitten im Satz gestockt und war erleichtert aus der Küche gegangen, als ich mit einem einfachen »danke« die Verlegenheit des Augenblicks fortgewischt hatte.
Meine Großmutter war tot, doch mich traf kein Schmerz. Weder Kummer noch Trauer stellten sich ein. Kein Gefühl des Verlusts begleitete mich, als das halbverkohlte Etwas, das meine Großmutter gewesen war, in den Eichensarg gebettet wurde.
Selbst der Anblick ihrer sterblichen Überreste, der die Leute entsetzt hatte, ließ mich unberührt: die rechte Hälfte ihres Gesichts war zu einem schwarzen Klumpen verschmolzen, die linke unwirklich rosig und glatt mit einem derart weit aufgerissenem Auge, dass Doktor Erb, der Dorfarzt – unter Zuhilfenahme einer ganzen Flasche Apfelbrand – das Oberlid mit sieben Stichen an das Unterlid hatte nähen müssen, damit es geschlossen blieb.
Die Frau, die seit dem Tod ihres Mannes Trauer getragen hatte, war mir in ihrem weißen Leichenhemd seltsam fremd und unbekannt.
Am wenigsten vermochten die geheuchelte Anteilnahme und das ausgesprochene Mitgefühl der Trauergäste, die den Weg von der Kirche zum Friedhof hörbar tuschelnd zurückgelegt hatten, meinem Herzen eine Regung abzuringen. Es waren mehr Menschen zur Beerdigung erschienen, als ich erwartet hatte, doch die meisten kamen mir wie Schaulustige vor, die mit der insgeheimen Hoffnung gekommen waren, dass es vielleicht etwas zu begaffen gäbe.
So stand ich zwar mit gebeugtem Haupt doch innerlich teilnahmslos neben meinem Vater vor dem offenen Grab und sah zu, wie die vier Träger den Sarg (viel schneller als Anstand und Sitte es geboten) in die feuchte Erde herab ließen.
»Asche zu Asche«, sagte der Pfarrer.
Und Kohle für das Höllenfeuer, dachte ich, während sich das leichte Gefühl von Befreiung bei mir einstellte, und das kleine Weh, das ich beim Anblick des Grabes verspürte, galt einzig der makellosen Holztruhe, die jetzt mit gesegnetem Boden zugeschaufelt wurde.
Nie war ein gewöhnlicher Mensch in einem schöneren Sarg zur letzten Ruhe gebettet worden.
Ich schlief wieder tief und traumlos. Die Zeit flog dahin, und der Herbst, warm und trocken, brachte den Bauern reiche Ernte auf den Äckern und Feldern und mir die Erkenntnis, dass ich zweifelsohne ein talentierter Schreinerlehrling war, aber eine weitere Glanzleistung, wie das Zimmern jenes Sarges, blieb mir verwehrt.
Ich brachte zwar ein paar ordentliche Stücke zusammen, die sich sehen lassen konnten und die die Kunden durchaus zufrieden stellten, doch ich stieß bei der Arbeit immer wieder an meine Grenzen. Ich hatte noch sehr viel zu lernen.
Der Meister erklärte sich diesen sonderlichen Umstand mit meiner grenzenlosen Liebe zu meine Großmutter und der großen Trauer über den Verlust. Mir war seine Erklärung nur recht, wusste ich doch selber nicht, welcher Quelle die Besessenheit jener Stunden entsprungen war.
Ich wollte es nicht wissen.
Mein Vater lebte seit dem Tod meiner Großmutter allein auf dem Hof, was den alten Eigenbrötler wohl kaum, wie ich vermutete, weiter störte. Doch wenn ich Sonntags nach der Schule dort vorbei schaute, fand ich das Haus stets verlassen vor. So kam es, dass meine Besuche mit der Zeit immer seltener wurden, und ich sie letztlich ganz einstellte.
Meister Esau war so anständig, Marthas Mutter ab und an ein paar Groschen zu zahlen, damit sie einmal in der Woche dort nach dem Rechten sah, ein wenig aufräumte und dafür sorgte, dass mein Vater immer etwas Essbares vorfand. Doch diese Hilfe, wenngleich gut gemeint, verpuffte wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Hof verwahrloste zusehends.
Im Sommer hatte ich die Kühe und Ziegen abgemagert und in erbärmlichen Zustand vorgefunden. Die Tränke war leer und die Futtertröge lagen umgeworfen herum. Füchse hatten die Hühner, einst ganzer Stolz meiner Großmutter, gerissen; blutverkrustete Federbüschel zeugten von einem ungleichen Kampf.
Um das Vieh nicht seinem traurigen Schicksal zu überlassen, trieb ich es zur Tischlerei, was ein mühseliges Unterfangen war, denn die Tiere waren so geschwächt, dass wir zwei der fünf Ziegen direkt nach der Ankunft notschlachten mussten.
Die anderen Tiere erholten sich jedoch in den kommenden Wochen unter Marthas Pflege zusehends, und es dauerte nicht sehr lange, bis wir frische Kuhmilch, Butter und sogar Ziegenkäse auf dem Tisch stehen hatten.
Eines Abends, wir saßen zu Tisch, hörten wir vor dem Haus ungehaltenes Schimpfen und Fluchen. Als der Lärm kein Ende finden wollte und gar lauter wurde, stand Meister Esau schließlich auf, um nachzuschauen. Neugierig folgten wir ihm vor die Tür.
Im Gegenlicht dauerte es ein paar Sekunden, bis ich die Gestalt, die dort im Hof stand und wüste Beschimpfungen ausstieß, erkannte. Es war mein Vater. Ganz offensichtlich hatte er getrunken, denn er schwankte heftig und schien sich nur mühsam auf den Beinen halten zu können. Jetzt torkelte er ein paar Schritte auf uns zu.
Ich hatte ihn längere Zeit nicht gesehen, und was ich jetzt im fahlen Schein der Abendsonne sah, widerte mich an. Das Haar war ungeschnitten und fettig, sein Bart hatte begonnen zu verfilzen. Die Kleider waren fleckig und auf der Brust, ich war mir sicher, klebten die angetrockneten Reste von Erbrochenem. In der gesunden Hand hielt er eine fast leere Flasche Wein, während er den vernarbten Stumpen wild in unsere Richtung schüttelte, was seinem Auftritt etwas Lächerliches und Groteskes verlieh.
Es fällt mir nicht schwer, zuzugeben, dass ich mich in diesem Moment für den dreckigen, heruntergekommenen Haufen Elend, der uns lallend anfeindete, zutiefst schämte.
»Elendiger Viehdieb!« schrie er. »Das war mein Vieh, du Scheißkerl, mein Vieh, das du mit deinen dreckigen Fingern geklaut hast!«, und immer wieder »Elender Bastard!« und sogar »Du Sohn eines feigen Bastards und einer dreckigen Hure!«
Ich spürte, wie brennender Zorn in mir aufstieg, doch der Meister bemühte sich gelassen zu bleiben und legte mir eine Hand auf die Schulter.
»Nimm dich zurück, Johannes, du weiß nicht, was du da redest!«
Aber mein Vater war nicht zu beruhigen. Der Wein in seinem Blut tat seine Wirkung und trieb ihn zur Rage. Abfällig spuckte er uns vor die Füße. »Er ist ein dreckiger Bastard, von einer dreckigen Hure in die Welt geschissen!«
»Du gehst wirklich zu weit mit deinen unflätigen Beschimpfungen!«
»Ich sage, wie es ist. Ein verdammter Hurensohn ist er, nichts anderes!«
Er beleidigte mich und meine tote Mutter gleichermaßen, und da seine Worte mich tief trafen, ja demütigten, wünschte ich mir in diesem Augenblick, dass er Recht haben möge, und dass ich in der Tat nicht sein Sohn wäre.
»Du bist betrunken, Johannes.«
Ich kannte den Meister mittlerweile recht gut, und obwohl er versuchte, beschwichtigend auf meinen Vater einzureden, war seinem Ton der unterdrückte Ärger anzuhören. »Du solltest jetzt besser nach Hause gehen und deinen Rausch ausschlafen! Morgen bringen wir dir dein Vieh, wenn dir soviel daran liegt.«
»Und wenn ich betrunken bin – ja und? Ich weiß genau, was ich rede! Viehdieb, Bastard! Belogen habt ihr mich. Belogen und bestohlen!«
Er verzog den Mund, seine Lippen begannen zu zittern, und unversehens fing mein Vater an zu greinen wie ein kleines Kind. Schluchzend taumelte er ein paar Schritte rückwärts, dann stolperte er und stürzte, die Flasche hielt er fest im Griff. Beim Aufstehen stützte der Krüppel sich auf den Armstumpf, den er sich dabei blutig schürfte, doch die Weinflasche mochte er nicht loslassen.
»Behaltet doch das Scheißvieh, ich will es gar nicht« heulte er. »Ich will es nicht. Und dich will ich nie wieder auf meinem Hof sehen!«
Er zeigte mit dem Finger auf mich und schwenkte die Flasche dabei so ruckartig in meine Richtung, dass der Wein heraus schwappte, und obwohl er einige Meter entfernt stand, trafen mich ein paar blutrote Spritzer auf die Brust.
»Verfluchter Bastard. Fahr zur Hölle!«
Er torkelte endlich davon.
Wir sahen ihm nach, stumm und hilflos, dann ging ich ins Haus zurück. Ich spürte die Blicke von Meister Esau, Katharina, Ida und Martha auf mir ruhen, traurig, verlegen und beschämt.
Mit den Strahlen der untergehenden Sonne traf mich hinterrücks ein letztes jähzorniges »Bastard!«
Ja ...
Der Teufel hatte um meine Hand angehalten, und ich hatte sie ausgeschlagen!
*