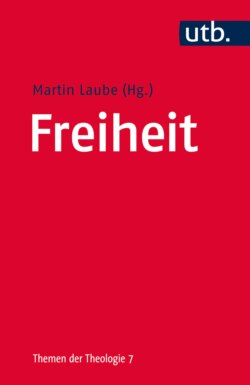Читать книгу Freiheit - Martin Laube - Страница 17
»Zur Freiheit hat uns Christus befreit«.
Neutestamentliche Perspektiven 1. Der neutestamentliche Befund
ОглавлениеDie neutestamentlichen Schriften insgesamt verwenden das Substantiv ἐλευθερία (»Freiheit«), das Verb ἐλευθεροῦν (»befreien«), das Adjektiv oder das Substantiv ἐλεύθερος (»frei« bzw. »der Freie« im Gegensatz zum Sklaven) sowie das Substantiv ἀπελεύθερος (»der Freigelassene«) nicht häufig. Die überwiegende Mehrheit aller Belege führt zu den Briefen des Apostels Paulus, der daher häufig als der »Apostel der Freiheit« angesprochen worden ist (Longenecker 1964; Vollenweider/Link 1997: 502). Ein knapper Überblick verdeutlicht schnell die Grundlage dieser Einschätzung: ἐλευθερία findet sich siebenmal bei Paulus, zweimal im Jakobusbrief, je einmal in den beiden Petrusbriefen. Von den insgesamt 23 Belegen des Adjektivs ἐλεύθερος führen 14 Belege zu Paulus, zwei zu den deuteropaulinischen Briefen an die Epheser und Kolosser, zwei zum Johannesevangelium, je ein Beleg zum 1. Petrusbrief und zum Matthäusevangelium sowie drei Belege zur Apokalpyse. Das Verb ἐλευθεροῦν ist fünfmal bei Paulus und zweimal bei Johannes bezeugt, das Adjektiv ἀπελεύθερος einmal bei Paulus. Dies bedeutet, dass im Blick auf den gesamten Wortstamm 27 Belege zu Paulus, insgesamt sogar 29 Belege ins Corpus Paulinum führen, jedoch allein dreizehn Belege außerhalb des Corpus Paulinum gegeben sind. Innerhalb des Corpus Paulinum wiederum begegnet der Wortstamm ἐλευθερ- ausschließlich in der Korintherkorrespondenz, im Galater- und im Römerbrief und hier, von Einzelbelegen einmal abgesehen,|40| überwiegend als theologisches Leitmotiv in klar definierten und in sich abgegrenzten Textkomplexen (1Kor 7 und 9; Gal 4–5; Röm 6–8). Auffällig sind das nahezu völlige Fehlen des Wortstamms in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte sowie die eher periphere Verwendung im Johannesevangelium.
Der Wortstamm Freiheit scheint demnach in der Verkündigung Jesu und in ihrer Rezeption und Darstellung in den Evangelien keine Rolle gespielt zu haben. Dieser Befund wird auch durch das apokryphe Thomasevangelium nicht in Frage gestellt. Unstrittig sind natürlich Befreiungserfahrungen und -berichte vorhanden, die sich vor allem auf Kranke und Außenseiter der jüdischen Gesellschaft beziehen, ohne hierfür allerdings den Wortstamm ἐλευθερ- zu verwenden. Es wäre eine Verzeichnung der Texte, aus diesen Befreiungserfahrungen einen für die politische und gesellschaftliche Freiheit seiner jüdischen Mitbürger eintretenden Jesus rekonstruieren zu wollen (so aber Bartsch 1983: 506). Die Verheißung der von Lukas gestalteten Antrittspredigt Jesu in Nazareth, er wolle den Gefangenen die Befreiung oder Entlassung verkünden (vgl. Lk 4,18 als Zitat von Jes 61,1), wird im eigentlichen Wortsinn in der Wirksamkeit Jesu nicht eingelöst. Die Tempelsteuerperikope (Mk 12,13–17) zeigt vielmehr eindeutig auf, dass Jesus nicht die politische Option der Widerstandskämpfer gegen das Imperium Romanum und seine versklavende Macht unterstützte.
Freilich wird man die neutestamentliche und urchristliche Freiheitsbotschaft nicht ausschließlich in einem begriffsgeschichtlichen Verfahren erheben können. Unabdingbar ist es, auf die Kontexte zu achten und hier wiederum auf Gegenbegriffe wie Knechtschaft, Gefangenschaft, Sklaverei (vgl. Gal 3,28; 2Petr 2,19; Apk 6,15; 13,16; 19,18 u.ö.) und natürlich auf die Metaphorik der Freiheitsaussagen überhaupt. Allerdings steht einem eher allgemein gehaltenen Zugriff auf die Freiheitsthematik der höchst auffällige und eine Erklärung verlangende Befund der Paulusbriefe entgegen. Weshalb verwendet Paulus und nur er im frühen Christentum den Wortstamm ἐλευθερ- in den genannten Briefen so eindeutig? Hat er den Freiheitsbegriff in das frühe Christentum eingetragen? Wodurch lässt er sich in der Verwendung des Begriffs leiten? Schließt er sich |41|an ein hellenistisches Verständnis an und trägt so auch zur Hellenisierung des Christentums bei?