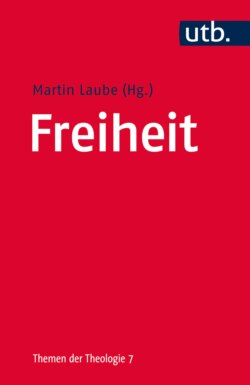Читать книгу Freiheit - Martin Laube - Страница 19
|43|3. Kontexte von Freiheit in den Briefen des Paulus
ОглавлениеMit der Entfaltung des Evangeliums in der missionarischen Verkündigung und in den Briefen an die ersten christlichen Gemeinden betrat Paulus zeitgeschichtlich einen Raum, der durch intensive Freiheitsdiskussionen und -theorien bestimmt war und in dem innerhalb der stoischen Philosophie die Freiheit in die Mitte jeglichen Denkens gestellt worden war. Vollenweider (vgl. Vollenweider 1989: 23–104) orientiert sich in seiner umfassenden Darstellung des Freiheitsverständnisses in der Stoa an der berühmten Rede Epiktets über die Freiheit (Epiktet, Dissertationes IV,1), in der das dominierende Weltbild der hellenistischen Antike zu greifen sei (vgl. Vollenweider 1989: 25). Verbindungslinien zu Paulus fallen sofort ins Auge, wenn etwa von der Freiheit als Gabe Gottes, der Gottessohnschaft des Freien, der Freiheit des Sklaven und der Relation des Freien zum Gesetz gesprochen wird. Das Kennzeichen des stoischen Freiheitsbegriffs ist gerade nicht die willkürliche Realisierung individueller Wünsche (»wie ich will«), sondern im Gegensatz dazu die völlige Unabhängigkeit des Einzelnen von allen Begierden, eine Freiheit von Zwang und äußeren Einflüssen, die einhergeht mit der Einfügung in Gottes Weltordnung. Vollenweider formuliert als ein Ergebnis seiner Untersuchung die These: »Die wirkungsgeschichtliche Schicksalsgemeinschaft von griechischer und christlicher Freiheit hat einen unverkennbaren genetischen Hintergrund: Die paulinische Freiheitsbotschaft verdankt sich historisch gesehen primär dem griechischen Freiheitsgedanken« (ebd. 397). Im Folgenden wird daher bei der Rekonstruktion und Darstellung des paulinischen Freiheitsverständnisses sorgsam darauf zu achten sein, in welchem Verhältnis seine Aussagen zum griechischen Freiheitsgedanken stehen.
Der stoische Weise realisiert die Freiheit, wenn er die Unabhängigkeit von Zwängen und Begierden gewinnt und sich einordnet in die über ihn verfügten Gegebenheiten. Paulus jedoch rekurriert nie auf Freiheitskonzeptionen, die ursprünglich mit der menschlichen Natur verknüpft sind. Seinem Freiheitsverständnis liegt ein Befreiungsgeschehen zugrunde, das mit Jesus Christus verbunden wird und in ihm gründet (vgl. Betz 1994: 116,119). In |44|diesem Befreiungsgeschehen vollzieht sich ein Übergang von der »Knechtschaft« (δουλεία) zur »Freiheit« (ἐλευθερία). Diese Knechtschaft wiederum wird in Verbindung gebracht mit der Sünde, dem Gesetz und der Vergänglichkeit, mit dämonisierten Mächten, ja sie wird in Röm 5,12–21 mit der Schöpfungsgeschichte verknüpft, und dies zeugt insgesamt nicht von einem optimistischen Weltbild (vgl. Betz 1994: 118). Der Gebrauch des Verbs ἐλευθεροῦν (»befreien«) und des Substantivs ἀπελεύθερος (»der Freigelassene«) hat im Blick auf dieses Befreiungsgeschehen einen programmatischen Charakter (vgl. Schnelle 2003: 624). Erstmals in Gal 5,1 und geradezu in formelhafter Verdichtung schreibt Paulus: »Zur Freiheit hat uns Christus befreit.« Dieser Freiheit steht das Joch der Knechtschaft gegenüber, das die galatischen Christen in diesem Befreiungsgeschehen abgelegt haben. Röm 6,18.22 spricht im Blick auf die Christen von einer Befreiung von der Sünde und Röm 8,2 von einer Befreiung von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Röm 8,21 weitet das Befreiungsgeschehen sogar auf die gesamte Schöpfung aus, die von der »Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes« befreit worden ist. Auch in dem Adjektiv ἀπελεύθερος (»frei«) in 1Kor 7,22 kommt dieses Befreiungsgeschehen zum Ausdruck, da der Sklave als ein Freigelassener des Herrn angesprochen wird. Allerdings fällt bei fast allen angeführten Belegen auf, dass sie diese Freiheit in der Paradoxie einer neuen Bindung nennen, die in einer Knechtschaft zur Gerechtigkeit (vgl. Röm 6,18) oder für Gott (vgl. Röm 6,22), für Christus (vgl. 1Kor 7,22) oder für die Liebe (vgl. Gal 5,13) besteht. Es gehört folglich zur Struktur des paulinischen Freiheitsverständnisses, das Befreiungsgeschehen in paradoxaler Weise mit einer neuen Knechtschaft zu verbinden, so dass der ἐλεύθερος gleichzeitig wieder ein δοῦλος Χριστοῦ (»Sklave Christi«) ist (vgl. 1Kor 7,22).
Dieses Befreiungsgeschehen wurzelt in dem sieghaften Ereignis von Tod und Auferstehung Jesu, dessen Ertrag als Erlösung, Befreiung oder Loskauf in der Taufe übereignet wird. Einerseits spricht Paulus von einer Befreiung von den als unheilvollen Mächten vorgestellten Gegebenheiten Tod, Sünde und Gesetz (vgl. Röm 5–7), andererseits aber eröffnet diese Befreiung eine neue Gemeinschaft, die kategorial von der Vergangenheit geschieden ist und als neue |45|Schöpfung vorgestellt wird (vgl. 2Kor 5,17; Gal 6,15). Kennzeichen der Neuheit ist u.a., dass in dieser Christusgemeinschaft der soziale Gegensatz von Freien und Sklaven aufgehoben ist (vgl. Gal 3,28; 1Kor 7,22; 12,13).