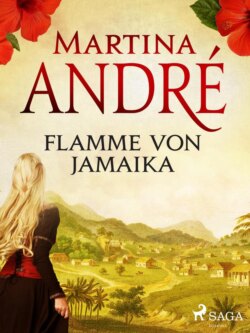Читать книгу Flamme von Jamaika - Martina Andre - Страница 14
Kapitel 6
ОглавлениеAugust 1831 // Jamaika // Sklaventreiber
Es verging fast eine Woche, bis Edward sein Versprechen, den Hochzeitstermin festzulegen, endlich einlöste. Er hatte per Boten mit seinem noch immer abwesenden Vater korrespondiert, und die beiden hatten sich schließlich auf einen baldigen Hochzeitstermin festgelegt, der ihr aber noch immer nicht konkret genannt wurde.
Mit einem romantischen Abendessen zu zweit auf der Terrasse des Herrenhauses kam er Lenas Unmut zuvor.
Überraschend zog Edward noch vor dem Dinner ein schwarzes Kästchen aus seiner Jackentasche und überreichte es ihr mit feierlicher Miene.
«Ich möchte mich bei dir entschuldigen», erklärte er. «Für alles, was seit deiner Ankunft zwischen uns schiefgelaufen ist.»
Sprachlos nahm Lena das Geschenk entgegen und klappte es auf.
Zum Vorschein kam ein kostbares, mit Diamanten besetztes Goldarmband, das ihr glatt den Atem verschlug. Edward nahm es ihr wortlos ab und legte es um ihr schlankes Handgelenk. Es saß perfekt.
«Seit deiner Ankunft hatte ich noch keine Gelegenheit, dir zu sagen, wie dankbar ich bin, dass du das alles auf dich genommen hast, um zu mir zu kommen und meine Frau zu werden», erklärte er selig lächelnd wie ein Engel.
«Danke», wisperte sie fassungslos, nicht fähig, den Blick von seinem wunderbaren Geschenk abzuwenden.
Ihre Drohung, notfalls nach Europa abzureisen, wenn er sein Verhalten nicht änderte, verpuffte wie der Rauch seiner Pfeife, die er sich nach dem Essen angezündet hatte. In knapp zwei Wochen würde Lena nicht nur seinen ehrenwerten Namen, sondern auch sein Bett mit ihm teilen, wie Edward mit einem süffisanten Lächeln hinzufügte, das sie angesichts dieser gelungenen Überraschung nicht weiter hinterfragen wollte.
Schon am nächsten Tag beauftragte Edward seinen Verwalter, einen dicklichen Endvierziger mit dem seltsamen Namen Archibald Bluebird, und dessen ältlichen Sekretär Peter Hogsmith mit der geschäftsmäßigen Planung der Feierlichkeiten. Schließlich mussten Dutzende von Einladungskarten geschrieben, der Priester bestellt und der Einkauf von Lebensmittelvorräten und Getränken erledigt werden. Hinzu kamen Dekoration und Musik.
«Edward zeigt sich mir gegenüber nur von seiner allerbesten Seite», versicherte Lena ihrer Gesellschafterin, die nach wie vor an der Charakterstärke des Bräutigams zweifelte.
Inzwischen ging es auch Maggie wieder so gut, dass sie sich sogar das Reiten zutraute. Nach dem Mittagessen wollte Edward ihnen endlich die Zuckerproduktionsstätten im Süden der Plantage zeigen, wo aus frischen Zuckerrohrstangen granulierter Zucker gewonnen wurde. Maggie, die froh war, endlich etwas mehr von ihrer neuen Umgebung kennenzulernen, stand bereits bei den Pferden.
Es war ein sonniger, aber etwas windiger Tag, und Lenas Freundin steckte sich vorsichtshalber den Hut mit weiteren Nadeln auf ihrem schwarzen Haar fest, bevor es losgehen sollte. In ihrem sandfarbenen, schweren Reitkleid, das Lena ihr noch vor der Abreise hatte anfertigen lassen, sah sie selbst aus wie eine Gutsherrin. Dieser Titel stand eigentlich Lena zu, die ganz in Dunkelrot gekleidet eine ebenso gute Figur auf ihrer fuchsbraunen Vollblutstute machte. Edward hatte ihr das edle Tier im Zuge seiner Versöhnungskampagne nachträglich zur Verlobung geschenkt. Eine wunderbare Geste, die sie tief beeindruckt hatte und ihre Zweifel an ihm endgültig verstummen ließ.
In den Tagen zuvor hatte er ihr bereits die nahegelegenen Anbaugebiete beschrieben, mit denen Redfield Hall seinen Unterhalt und einen Großteil des Vermögens der Blakes auf Jamaika erwirtschaftete. Nun wollte Edward mit den beiden Frauen in den Parish St. Thomas-in-the-Vale reiten, wo die Blakes weitere Ländereien besaßen, die für den Umsatz der Plantage nicht weniger wichtig erschienen.
Lena war ganz sprachlos, als sie das weite, sonnenüberflutete Land erblickte, das zwischen halbhohen Bergen und glitzernden Flüssen wie ein wahres Paradies anmutete. Die Blakes bauten hier Tabak und Früchte aller Art an, darunter Ananas, Mangos und Bananen. Aber die wichtigste Einnahmequelle waren das Zuckerrohr und der Rum, den sie in Southwater, einer zehn Meilen vom Haupthaus entfernten Destille, für den gesamten europäischen und amerikanischen Markt brannten.
«Etwa dreihundert Sklaven sind in der Haupterntezeit ausschließlich für die Zulieferung der mannshohen, frisch geschlagenen Zuckerrohrstangen zuständig», berichtete er vergleichsweise nüchtern, als sie zu Pferd das erste Anbaugebiet erreichten. «Mit Ochsengespannen werden die Stangen in eine riesige Scheune gebracht, wo sie zu Saft verarbeitet werden, der anschließend für die Gärung vorbereitet wird.» Als sie die Brennerei passierten, erkundigte sich Lena nach dem Namen des Rums, weil sie wissen wollte, ob sie vielleicht schon mal etwas davon gehört hatte.
«Southwater Gold steht auf dem Label», erklärte Edward mit offensichtlichem Stolz in der Stimme.
Nach einem zweistündigen Ritt erreichten sie endlich das Herzstück der eigentlichen Zuckergewinnungsanlage. Haushohe Scheunen und lang gezogene Lagerschuppen umgaben die überdachte Zuckermühle, die in Erntezeiten von vier Mulis angetrieben wurde. Hinzu kamen noch Verladerampen, Ställe und Unterkünfte für die Sklaven. Lena fiel auf, wie armselig die Hütten ausfielen, und sie erschrak beim Anblick von ein paar schwarzen Kindern, die beinahe nackt und mit aufgedunsenen Bäuchen umherliefen. Die Mütter steckten in sackähnlichen, blauen Arbeitskitteln und zogen die Kleinen nach einer hastigen Verbeugung vor Edward und seinem Gefolge in ihre primitiven Behausungen. Lena glaubte, neben Ehrfurcht auch Angst in ihren Blicken gesehen zu haben.
«Im Moment ist noch keine Erntezeit für Zuckerrohr», erklärte Edward und wies mit seiner Reitgerte auf die Felder in der Umgebung, auf denen die noch jungen Schösslinge in langen, dicht nebeneinanderstehenden Reihen bis zu zwei Meter hoch aufragten. «Bis Ende des Jahres werden sie leicht das Doppelte an Länge und Gewicht zulegen.»
Etliche Sklavinnen waren zwischen den Setzlingen damit beschäftigt, die Pflanzen mit Hilfe von eigens gegrabenen Kanälen zu wässern und sie von Unkraut zu befreien. Eine anstrengende Arbeit, wie es Lena schien, denn die Frauen mussten in gebückter Haltung und ohne Schuhwerk durch den Schlamm stapfen.
«Geerntet wird erst ab Dezember», fuhr Edward mit seinen Erläuterungen fort. «Und dann muss alles rasend schnell gehen. Bis Mai muss die gesamte Ernte eingefahren sein, weil dann die Regenzeit einsetzt und uns die Stangen ansonsten auf den Feldern verfaulen.»
Als sie einen überdachten Unterstand erreichten, sprang er vom Pferd und half ihnen, ebenfalls abzusteigen. Er wollte ihnen den weiteren Verlauf der Zuckerherstellung anhand der vielen Maschinen erklären, die in der angrenzenden Scheune standen. Ein paar Sklaven, die im Inneren auf einer Bank gesessen hatten, sprangen auf, als sie von Edwards Eintreten überrascht wurden.
In Panik, so kam es Lena vor, stieben sie davon.
Merkwürdig, dachte sie, überall, wo sie mit Edward auftauchte, reagierten die Menschen, als ob ein nahendes Unheil drohe.
Unbeeindruckt deutete Edward auf mehrere Holzblöcke, deren Oberfläche ganz zerfurcht und weich geschlagen war.
«Hier werden die harten Zuckerrohrstangen mit Macheten zerkleinert, um anschließend aus den Rohfasern mittels einer Steinpresse den Saft herauszupressen.»
Er zeigte auf die gewaltige Steinmühle, die mit Mulis betrieben wurde.
«Und was passiert mit dem Saft?», fragte Lena.
«Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie wir das ausgepresste Zuckerwasser weiterverarbeiten können», referierte er mit dem Enthusiasmus eines erfolgreichen Geschäftsmannes. «Zunächst wird der Saft gekocht.»
Er deutete auf ein Haus, durch dessen offenstehende Tür eine Art riesige Kupferpfanne zu erkennen war. «Anschließend scheiden sich die Wege des Rohstoffs», führte er weiter aus. «Es entstehen Zuckersaft, Zuckersirup, Zuckermelasse, Zuckerstücke, brauner Zucker, weißer Zucker, Rum, Likör und vieles mehr.»
Lena war ehrlich beeindruckt, obwohl sie die Menschen auf dieser Plantage weit mehr interessierten als irgendwelche Arbeitsprozesse und Maschinen. Während sie an den Feldern entlanggeritten waren, war ihr Blick immer wieder auf die vielen dunkelhäutigen Arbeiter gefallen, die in abgewetzter Kleidung ihren Pflichten nachkamen. Und zwar ohne Bezahlung. Die meisten von ihnen verrichteten ihr Werk mit stoischer Miene, wobei Lena hin und wieder auch Gesänge vernommen hatte. Doch spätestens wenn sie Edward erblickten, verstummten die Sklaven.
«Wie viele Arbeiter sind auf Redfield Hall beschäftigt?», fragte Maggie, als sie weiterritten.
«Wir besitzen mehr als tausend Sklaven, die sich allein um unsere Felder und die Ernte kümmern», erklärte Edward. «Hinzu kommen Pferdeknechte, Schmiede, Gespannfahrer und einige mehr, die man nicht mehr in der ersten Kolonne einsetzen kann.»
«Erste Kolonne?» Lena schaute ihn fragend an.
«Männer und Frauen, die die schwersten Arbeiten verrichten. Die zweite Kolonne umfasst die älteren Sklaven, und in der dritten versammeln wir die ganz jungen, die noch zu schwach sind für die Schwerstarbeit.»
«Und sie tun das alles wirklich ohne Entlohnung?», fragte Maggie skeptisch.
«Die Anschaffung der Sklaven und deren Versorgung ist schon teuer genug», entgegnete Edward leicht gereizt, «Wenn wir sie auch noch entlohnen müssten, wären wir ruiniert.»
Beim Anblick der geknechteten Menschen musste Lena an die drei gefesselten Neger denken, die sie an ihrem ersten Morgen vor dem Haupthaus gesehen hatte. Bisher hatte sie es nicht gewagt, Edward darauf anzusprechen.
«Und was ist, wenn sie nicht gehorchen?»
Edward antwortete nicht sofort, sondern wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Sein Jackett hatte er bereits in Southwater abgelegt und hinter dem Sattel an einem Riemen festgezurrt. Das verschwitzte Hemd brachte sein breites Kreuz und seine festen Armmuskeln mehr als deutlich zur Geltung. Bei seinem Anblick fühlte sich Lena schmerzhaft daran erinnert, warum sie ihn zum Mann hatte haben wollen. Dass sie dabei versäumt hatte, sich mehr für seine Lebensumstände und seine Gesinnung zu interessieren, empfand sie inzwischen als nicht wiedergutzumachenden Fehler.
«Hier auf der Insel ist das Leben alles andere als einfach und friedlich», antwortete er ausweichend.
Seine Miene wurde ernst, wie stets, wenn es um die Angelegenheiten der Plantage ging. Lena rätselte, was er mit dieser Äußerung meinte, und erinnerte sich, dass der Schiffsarzt Dr. Beacon bei ihrer Ankunft ebenfalls von größeren Schwierigkeiten im Lande berichtet hatte.
«Die Sklaven wollen mit Gewalt ihre Freiheit durchsetzen», erklärte Edward unvermittelt scharf. «Seit 1807 verbietet das britische Empire den Handel mit Negern aus Afrika. Und das verleitet ihre hier lebenden Nachfahren offenbar zu der Annahme, dass die Sklaverei gleich ganz verboten werden müsste.» Er schnaubte verächtlich. «Dabei hat niemand gesagt, dass wir die vorhandenen Sklaven oder deren Nachkommen nicht in bewährter Weise nutzen, züchten und verleihen dürfen. Das Gesetz besagt: Wenn die Mutter eine Sklavin ist, so ist auch das Kind ein Sklave. Und so schnell wird sich daran nichts ändern.»
Lena und Maggie warfen sich einen empörten Blick zu.
«Züchten?» Lenas Stimme klang schrill. «Edward, ich kann kaum glauben, was du da sagst. Wir sprechen hier von Menschen und nicht von Tieren!»
«Aber Neger sind doch keine Menschen.» Er schüttelte den Kopf. «Dem Gesetz nach sind sie kaum mehr wert als Affen in einer Menagerie. Sie befinden sich in unserem Besitz wie ein Pferd oder ein Hund. Bis vor ein paar Jahren war es uns deshalb auch noch erlaubt, sie weltweit zu kaufen und zu verkaufen. Im Augenblick können wir sie nur noch untereinander verkaufen, verleihen oder tauschen.» Ein boshaftes Lächeln umspielte seinen Mund. «Oder sie notfalls illegal zu den hispanischen Inseln verschiffen, wenn wir ihrer überdrüssig sind. Dort ist ein Verkauf dann durchaus möglich, weil unsere britischen Gesetze nicht greifen.»
Lena zog deutlich hörbar die Luft ein. Wahrscheinlich würde sich Edward über ihre Einstellung ärgern, aber das störte sie nicht. Schließlich war sie eine wohlerzogene Protestantin, und Pastor Lange, bei dem sie in Hamburg getauft und konfirmiert worden war, hatte sie stets in dem Glauben bestärkt, dass alle Menschen Gottes Kinder waren. Unabhängig davon, von wem oder wo sie geboren wurden.
«Aber wenn man sie so miserabel behandelt, muss man sich nicht wundern, wenn sie aufständisch werden», erwiderte sie erbost.
Edwards blaue Augen blitzten gefährlich, während er seinen Hengst ein wenig zügelte, um das Schritttempo zu halten.
«Ich glaube nicht, liebste Lena, dass du irgendeine Ahnung davon hast, wovon wir gerade sprechen. Alles, was unseren Reichtum ausmacht, fußt auf der Arbeit von Sklaven. Alleine wären wir nicht in der Lage, auch nur eine einzige Ernte einzufahren, geschweige denn sie weiterzuverarbeiten. Dein werter Herr Vater und seine Handelspartner hätten nichts, was sie verkaufen könnten, wenn wir nicht dafür sorgen würden, dass es pünktlich geliefert wird.»
«Und warum kann man die Arbeiter dann nicht ordentlich entlohnen?»
«Weil wir es nicht finanzieren können», erklärte er mit entnervter Stimme. «Allein im Parish St. Ann beschäftigen die Plantagenbesitzer zurzeit knapp 25000 Sklaven. In St. Mary, wo unser Haupthaus steht, sind es 22000, und hier in St. Thomas-in-the-Vale, wo ein Großteil unserer Zuckerrohrfelder liegt, sind es insgesamt rund 10000 Männer, Frauen und Kinder. Die Arbeitsleistung eines männlichen Sklaven wird mit durchschnittlich zweiundzwanzig englischen Pfund pro Jahr berechnet. Die einer Frau mit achtzehn. Wenn wir nun von einem Durchschnittslohn von zwanzig Pfund pro Sklaven ausgehen, würden für die weißen Plantagenbesitzer allein in St. Ann zusätzliche Kosten von einer halben Million englischen Pfund entstehen, die wir auf den Zuckerpreis aufschlagen müssten. Wegen des steigenden Angebots in den letzten zwanzig Jahren ist der Wert von Zucker aber bereits um mehr als 50 Prozent gesunken. Das bedeutet, wenn wir die Arbeiter bezahlen müssten, wären wir auf einen Schlag bettelarm!»
Lena hatte zwar nur die Hälfte von seinem Vortrag verstanden, doch sie spürte Widerspruch in sich aufsteigen.
«Dann müssten eben alle ein wenig mehr für den Zucker bezahlen. Den Schwarzen würde es jedenfalls helfen, als freie Männer und Frauen zu leben.»
Edwards Lachen klang höhnisch, und er warf Maggie, die etwas hinter ihnen ritt, einen spöttischen Blick zu.
«Das meint sie nicht ernst, oder?»
Doch Maggie wusste, was sich gehörte, und ersparte ihm eine Antwort.
«Bitte, wer in London wäre bereit, freiwillig mehr für seinen Zucker zu zahlen?», fuhr er aufgebracht fort. «Davon mal abgesehen, meine Lieben, diese Nigger würden ihren Lohn doch gleich in Schnaps und Rum umsetzen!» Kopfschüttelnd schaute er auf die Felder. «Außerdem gehen sie ja nicht vollkommen leer aus. Wir stellen jeder Familie ein kleines Stück Land zur Verfügung, wo sie Yamswurzeln, Weizen und Mais anbauen dürfen. Wir erlauben ihnen sogar, eine Kuh zu halten oder eine Ziege. Wir sorgen dafür, dass sie ordentlich gekleidet sind und die Kirche besuchen dürfen. Manche von ihnen schließen sogar eine richtige Ehe vor Gott und dürfen auf Antrag ihre Ehepartner und Kinder besuchen, wenn diese auf einer anderen Plantage leben. Nicht zu vergessen die Krankenabteilungen, die wir extra für die Sklaven eingerichtet haben und deren Ärzte wir fortwährend mit der nötigen Ausstattung versehen. Wo, bitte schön, würde es den Negern bessergehen als auf einer Plantage?»
Lena erkannte in seinen Augen, dass er von seiner Haltung vollkommen überzeugt war.
«Aber wenn sie es so gut bei ihren weißen Herren haben, warum müssen sie dann in Ketten gelegt und ausgepeitscht werden?»
«Damit sie bereit sind, ihr Äußerstes zu geben», erklärte er mitleidslos.
«Und du denkst tatsächlich, dass sie unter solchen Umständen ihr Bestes geben?» Lena sah ihn verständnislos an.
«Wie ich schon sagte», wiederholte er stur, «erstens sind sie faul, und darüber hinaus hat Gott ihnen jegliches Talent verweigert, um eine wirtschaftliche Existenz begründen zu können, die auch nur annähernd an die Errungenschaften der Weißen heranreicht. Es bleiben Wilde, die ihrem Naturell gemäß im Geiste immer noch auf Bäumen hausen. Eine Eigenschaft, die sie bedauerlicherweise an ihre Nachkommen vererben, selbst wenn der Vater ein Weißer ist. Und wenn wir ihnen nicht zeigen, was sie zu tun haben, sitzen sie in hundert Jahren noch dort. Falls du mir nicht glaubst, so rede doch mal mit jenen weißen Entdeckern und Händlern, die bereits in Afrika waren. Es ist ein riesiger Kontinent mit unermesslichen Schätzen. Reich an Tieren, endlosen Wäldern und Flüssen, in denen man überall Gold und Diamanten findet. Trotzdem leben die Neger dort wie einfältige Kinder. Es herrscht weder Fortschritt noch Frieden. Ihre Stämme bekämpfen sich untereinander, ja sie gehen sogar so weit und versklaven sich gegenseitig. Denkst du wirklich, man würde solchen Kreaturen einen Gefallen tun, wenn man sie sich selbst überlässt?»
Lena fiel nichts Passendes ein, um seine Argumentation widerlegen zu können. Auch ein hilfloser Blick zu Maggie half da nichts. Ihre ansonsten so muntere Gesellschafterin saß mit ausdrucksloser Miene in ihrem Damensattel und dachte offenbar nicht daran, sich in diesen hochpolitischen Disput einzumischen. Allenfalls heute Abend, wenn sie unter sich waren, würde Maggie ihr verraten, was sie wirklich über Edwards Ausführungen dachte.
«Und wie gefährlich diese Wilden werden können», fuhr Edward fort, «sehen wir ja gerade. Eine Gruppe von Rebellen stiftet seit neuestem unsere Sklaven zu Flucht und Brandstiftung an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihre Anhänger gegen uns und unsere Familien vorgehen.» Edward verlieh seinen Worten einen gewissen Nachdruck. «Es leben mehr als 300000 Sklaven verteilt auf der ganzen Insel, und wir können ja schlecht dabei zusehen, wie sie die knapp 20000 Weißen auf Jamaika Zug um Zug häuten und vierteilen. Diese Rebellen sind zu allem fähig!»
«Oh mein Gott!» Maggie hielt sich vor Schreck die Hand vor den Mund. «Ist so etwas schon einmal vorgekommen?»
«Bis jetzt noch nicht», beruhigte sie Edward. «Aber was nicht ist, kann durchaus noch werden. Deshalb dürfen wir diese Leute und ihre Anhänger nicht aus den Augen verlieren. Früher haben wir meist nur die Sommermonate auf Redfield Hall verbracht und die Verwaltungsarbeit einem Londoner Anwalt überlassen», erklärte er weiter. «Das geht nun nicht mehr. Aber den Untergang der Plantage werden mein Vater und ich um jeden Preis verhindern. Bereits mein Urgroßvater hat Redfield Hall aufgebaut. Mein Großvater, mein Vater und ich wurden hier geboren. Nicht zu vergessen, dass meine Mutter hier beerdigt ist. Deshalb müssen wir die Plantage erhalten. Koste es, was es wolle.»
Lena war gelinde gesagt schockiert. Von solchen Problemen hatte Edward in London nicht das Geringste erwähnt, als er sie so emsig umworben hatte. Auch in seinen Briefen hatte er nichts dergleichen verlauten lassen. Was hatte er ihr wohl sonst noch alles verschwiegen?
«Wobei das Ganze keine Frage des Geldes ist», fügte Edward hinzu, als ob er ihre Gedanken erraten hätte. «Davon hat mein Vater mehr als genug. Es ist in erster Linie eine Frage der Ehre. Wir lassen uns von diesen Niggern doch nicht kaputt machen, was unsere Vorfahren unter Einsatz ihres Lebens aufgebaut haben!»
«Und die drei angeketteten Männer, die ich bei meiner Ankunft auf dem Wagen gesehen habe? Waren das Leute, von denen du glaubst, sie würden uns häuten und vierteilen?» Für Lenas Geschmack hatten sie ziemlich eingeschüchtert ausgesehen.
«Sie wollten fliehen und einen Aufstand anzetteln», erklärte er kühl. «Dafür wird ihnen in Kürze der Prozess gemacht, und ich gehe davon aus, dass man sie wegen Anstiftung zur Rebellion hängt.»
Damit schien das Thema für ihn erledigt zu sein. Jedenfalls machte Edward keine Anstalten, noch mal auf Lenas Einwurf eingehen zu wollen. Lena wusste nun nicht, was sie von der ganzen Geschichte halten sollte. Wollte Edward ihnen nur Angst machen, damit sie sich ungefragt auf seine Seite stellten? Oder waren die Neger wirklich so schlimm? Den gesamten Ritt zurück nach Redfield Hall konnte sie an nichts anderes mehr denken.
Nach ihrer Rückkehr übergaben sie die Pferde einem Stallburschen und folgten Edward in den Salon, wo Estrelle zur Erfrischung verschiedene Fruchtsäfte servierte, die mit Wasser und Zuckersirup verlängert waren. Zum anschließenden Dinner am Abend würde endlich auch Lord William von seinem Besuch bei Gouverneur Lowry-Corry, dem 2. Earl Belmore, aus Spanish Town zurück sein. Lena verspürte eine gewisse Aufregung bei dem Gedanken daran, zum ersten Mal nach so langer Zeit ihrem Bald-Schwiegervater gegenüberzustehen. Mit Maggies Hilfe zog sie ihr bordeauxfarbenes Festtagskleid an, dessen Ausschnitt mit schwarzer Spitze verhüllt war. Maggie trug wie üblich ein graues, hochgeschlossenes Seidenkleid, das ihre Strenge unterstreichen sollte. Eine perfekte Verkleidung, wie Lena befand, die nichts über die wahren Qualitäten ihrer Gesellschafterin verriet.
«Ob Lord William mich mögen wird?», fragte sie unsicher. «Nach den Diskussionen mit Edward weiß ich jetzt schon, dass wir gewiss nicht immer einer Meinung sein werden.»
«Der alte Lord kann froh sein, dass endlich wieder eine Frau das Haus mit Leben füllt!» Maggie zupfte an dem Stoff herum. «Schließlich ist die letzte Herrin von Redfield Hall schon ein paar Jahre tot.»
«Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, was es mit diesem vermaledeiten Friedhof auf sich hat», sagte Lena und kontrollierte im Spiegel den Sitz ihrer Frisur. «Du hast ja gehört, wie Edward von den Gräbern seiner Vorfahren gesprochen hat. Merkwürdigerweise will er nicht, dass ich dort hingehe und für seine Mutter ein Gebet spreche. Dabei liegt die Grabstätte nur etwa eine halbe Meile südlich vom Herrenhaus entfernt, in einem eigens angelegten englischen Park.»
«Komisch», bemerkte Maggie. «Wenn man Estrelle und den Porträts im Treppenhaus Glauben schenken will, war Lord William nach dem Tod von Edwards Mutter mindestens noch ein Mal verheiratet.»
«Hm …» Lena griff sich nachdenklich ans Kinn. «Edward spricht anscheinend nicht gerne darüber. Jedenfalls hat er nichts dergleichen erwähnt. Aber ich kann verstehen, dass all das sicher nicht leicht für ihn war», erklärte sie mit einem Seufzer. Schließlich wusste sie selbst nur zu gut, wie es sich anfühlte, ohne Mutter aufzuwachsen.
«Schade, dass das Personal nicht tratscht», sagte Maggie bedauernd. «Aus Estrelle bekommt man leider nur das Allernotwendigste heraus.»
Lena warf einen letzten Blick in den Spiegel. Sie war mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Mit klopfendem Herzen ging sie in den großen Salon im Untergeschoss und wartete dort auf die erste Begegnung mit ihrem Schwiegervater in Jamaika. Als er noch in London weilte, hatte Lord William ihr und ihrem Vater nur kurz seine Aufwartung gemacht. Dringende Geschäfte hatten ihn ins House of Lords gerufen, und so war kaum Zeit gewesen, um sich ausreichend kennenzulernen.
Die Begrüßung fiel unverhältnismäßig knapp aus.
«Bleib sitzen, Helena», schnarrte William und machte eine abweisende Handbewegung, als Lena aufstehen wollte, um ihm die Hand zu reichen.
Lord William besaß immer noch die Attraktivität seines Sohnes, zumal er für sein Alter von sechzig Jahren ein erstaunlich vollständiges Gebiss präsentierte. Das graue Haar sorgfältig geschnitten, das Kinn glatt rasiert und von einem Hauch Eau de Cologne umgeben, gab er im grauen Cut den perfekten Gentleman. Doch seiner griesgrämigen Miene nach zu urteilen, war er nicht gerade bester Laune.
Wie üblich servierte der Butler Jeremia das Abendessen im sogenannten Diningroom. Mit seinen weißen Handschuhen und der steifen Miene hätte er seinen britischen Kollegen in London alle Ehre gemacht. Auch das vornehme Interieur des Speisesalons erinnerte Lena an zu Hause. Der glatt polierte Boden aus tropischem Holz, die darübergelegten schweren, persischen Teppiche und die roten Samtschabracken an den riesigen Fenstern unterschieden sich nicht im mindesten von den übrigen Räumlichkeiten, aber vor allem nicht von englischen Speisezimmern.
«Was machen die Geschäfte, Vater?», fragte Edward, offenbar um die Stimmung etwas aufzulockern.
«Ach, diese verschissenen Baptisten-Missionare sind daran schuld, wenn in Kürze auf der Insel die Hölle ausbricht. Man sollte diese Pfaffen alle verbrennen!»
Hastig goss er sich ein Glas Rotwein aus einer Kristallkaraffe ein und trank es in einem Zug.
Lena blickte verlegen auf ihren Teller. Und auch Maggie saß auffallend steif auf ihrem Stuhl. Beide waren es nicht gewohnt, dass man in Anwesenheit von Damen fluchte, schon gar nicht bei Tisch.
«Dauernd predigen sie, dass der englische König schon bald allen Sklaven die Freiheit schenken wird», fuhr Lord William aufgebracht fort und inspizierte die Speisen auf dem reich gedeckten Tisch. «Der Gouverneur ist mit mir und den übrigen Pflanzern der Meinung, dass wir notfalls mit einem Handelsembargo gegen unser ureigenes Vaterland reagieren müssen, wenn das Parlament in London und der König nicht auf unserer Seite stehen. Angus MacCallum schlug sogar vor, sämtliche Neger erschießen zu lassen, wenn es so weit kommt, dass sie sich allesamt gegen uns richten. Jedenfalls die männlichen Sklaven. Frauen und Kinder können wir notfalls illegal in die Südstaaten von Amerika verkaufen, da erhalten wir wenigstens noch einen anständigen Preis.»
Lena schluckte schwer. Alle Schwarzen erschießen? Sie verstand das alles nicht, aber ganz offensichtlich war die Situation im Land tatsächlich weit schlimmer als angenommen.
Während der Lord mit seinen Hasstiraden fortfuhr, servierte Jeremia ihm mit ausdruckslosem Gesicht eine Scheibe Rindfleisch, zwei gekochte Süßkartoffeln sowie etwas Gemüse.
«Im Gouverneurspalast sind manche der Meinung, dass wir uns wie die Amerikaner vom britischen Königshaus lossagen müssen», fuhr William fort. «Falls es zum Äußersten kommt, können wir notfalls unsere amerikanischen Freunde um Unterstützung bitten.»
Er nahm einen weiteren hastigen Schluck Wein und wandte sich dann mit offensichtlichem Appetit dem Braten zu. Mit vollem Mund sprach er weiter:
«Der Gouverneur will, dass ich als Parlamentsabgeordneter meine guten geschäftlichen und politischen Verbindungen in die Südstaaten nutze, um die notwendigen Kontakte herzustellen.»
«Bedeutet das, du reist nach Amerika, und ich soll die Plantage in diesen schwierigen Zeiten ganz alleine führen?», fragte Edward beunruhigt.
«Warum nicht. Schließlich war ohnehin geplant, dass du schon bald die Leitung von Redfield Hall übernimmst. Außerdem hast du doch nun eine tüchtige Frau an deiner Seite!»
William warf Lena ein aufforderndes Lächeln zu. Trotz der Missstimmung am Tisch freute sich Lena, dass er sie allem Anschein nach bereits vor ihrer Vermählung als vollwertiges Mitglied der Familie akzeptierte.
«Warum verhandeln wir nicht einfach mit den Sklaven?», schlug sie eifrig vor. «Man könnte ihnen angenehmere Lebensbedingungen bieten. Mein Vater sorgt zusammen mit diversen Wohltätigkeitsorganisationen in den Arbeitervierteln Hamburgs und Londons dafür, dass es den Menschen dort bessergeht. Das beugt Aufständen vor, wie er sagt!»
Edward begann unvermittelt zu husten. Offenbar hatte er sich an seinem Wein verschluckt.
«Nimm die Arme hoch», riet Lena ihm mitfühlend, weil Edward bereits rot anlief und es aussah, als ob er zu ersticken drohte. «Oder soll ich –»
«Meine Liebe», fiel Lord William ihr mit einem kalten Lächeln ins Wort, während Edward sich nur langsam von seinem Hustenanfall erholte. «Offenbar hat dein Vater dich darüber im Unklaren gelassen, wie solche Dinge tatsächlich laufen. Hast du dich je gefragt, warum du in London und auch in Hamburg in einer komfortablen Villa lebst, mit all diesen Bediensteten und dem ganzen Tand, der euch umgibt?»
Lena spürte, dass sie sich auf gefährliches Terrain begeben hatte. «Weil mein Vater als ehrlicher Kaufmann sein Geld verdient und es sich leisten kann, in einem solchen Haus zu residieren?», bemerkte sie scheu.
«Abgesehen davon, dass auch er sein Geld auf dem Rücken der Sklaven verdient, würde er wohl kaum auf das luxuriöse Haus verzichten und in eine Fischerhütte am Rande der Stadt ziehen, nur damit es irgendjemandem bessergeht, oder?»
«Wie soll ich das verstehen?» Lena schaute ihren zukünftigen Schwiegervater irritiert an.
«Nun, ohne Sklaven wäre der Zuckerpreis fünfmal so hoch», erklärte Lord William reserviert. «Dein Vater würde am Hungertuch nagen, weil ihm niemand in Europa das Zeug für so viel Geld abnehmen würde. Das Gleiche gilt für Kaffee, Rum und Tabak. Denkst du ernsthaft, die Preise würden stabil bleiben, wenn wir den Löwenanteil unseres Gewinns an die Sklaven abgeben müssten?»
Lena schwieg und starrte auf den vor ihr stehenden, goldgeränderten Porzellanteller, auf dem zahlreiche exotische Köstlichkeiten darauf warteten, verspeist zu werden.
«Es würde nicht nur die Existenz dieser Plantage auf der Stelle vernichten», knurrte William mit düsterem Blick. «Alle Plantagen dieser Insel wären ruiniert, wenn wir die Sklaven entlohnen würden! Und das werde ich auf keinen Fall zulassen. Schließlich geht es in nicht allzu ferner Zukunft – wie ich hoffen möchte – auch um dich und Edward und die Heimat eurer gemeinsamen Nachkommen.»
Lord William bedachte seinen Sohn mit einem undurchsichtigen Seitenblick und hob eine Braue, bevor er sich wieder Lena zuwandte.
«Frauen sollten sich im Übrigen nicht mit Politik beschäftigen, das macht sie hässlich. Viel besser wäre es, wenn du dich auf deine eigentlichen Aufgaben konzentrierst und zusammen mit Edward dafür sorgst, dass dieses Haus möglichst bald von Kinderlachen erfüllt wird. Bevor ich sterbe, möchte ich gerne sehen, wie die nächste Generation der Blakes auf Redfield Hall heranwächst und das fortführt, was meine Vorfahren einst so glorreich begonnen haben.»
Lena nickte beschämt. Ihre Kehle war mit einem Mal wie zugeschnürt. Es schien ihr unmöglich, auch nur einen weiteren Bissen hinunterzuschlucken.
«Für wann genau soll unser Sekretariat die Einladungen für die Vermählung eigentlich rausschicken, Vater? Du wolltest doch mit dem Gouverneur sprechen, wann es ihm am besten passt.»
Lena atmete aus. Mit seiner Frage hatte Edward sie vor weiteren Peinlichkeiten gerettet.
«Sag Bluebird und Hogsmith, dass wir den Termin auf den zweiten Sonntag im September legen», antwortete der Lord geschäftig, als habe er ihren dummen Einwand schon wieder vergessen. «Wir werden ein rauschendes Fest feiern.» William blickte mit einem eisigen Lächeln in Lenas Richtung. «Mit einer bezaubernden Braut. Die halbe Insel wird da sein. Alles, was Rang und Namen hat. Selbst der Gouverneur und seine Gemahlin haben ihr Kommen fest zugesagt. In diesen schwierigen Zeiten sollten alle auf leichtere Gedanken kommen. Und was eignet sich da besser als eine glanzvolle Hochzeit?»