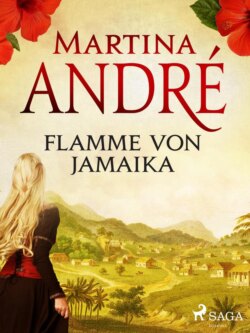Читать книгу Flamme von Jamaika - Martina Andre - Страница 8
Prolog
ОглавлениеJuni 1814 // Jamaika // Plantage Redfield Hall
Wo ist mein Kind?» In stummer Verzweiflung krallte Baba ihre Hände in die leere Hängematte, dort, wo sie am Morgen ihren fiebernden Sohn zurückgelassen hatte. «Ich habe überall nach ihm gesucht und konnte ihn nirgends finden.»
«Du weißt doch, wie kleine Jungs sind. Manchmal benehmen sie sich wie junge Hunde, die einem Kaninchen hinterherjagen», beruhigte sie Estrelle, eine Sklavin wie sie selbst, die nichts weiter tun konnte, als ihr tröstend die Hand auf die Schulter zu legen.
«Aber er ist krank!», stieß Baba mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Etwas Schreckliches musste passiert sein, das spürte sie. «Ich habe ihm verboten, die Hütte zu verlassen, weil ihn Trevor sonst zum Arbeiten eingeteilt hätte. Und das mit seinem Fieber …! Jess weiß, wann es mir ernst ist. Er hätte es nicht gewagt, die Hütte zu verlassen.»
Mühsam versuchte Baba, ihre Tränen zu unterdrücken. Baba war nicht ihr richtiger Name. Getauft war sie auf den Namen Mary. Aber es war das erste Wort ihres Sohnes gewesen, als er mit einem knappen Jahr zu sprechen begonnen hatte. Baba rührte aus dem Afrikanischen her und bedeutete eigentlich Vater. Und da Jess offiziell keinen Vater besaß, war sie ihm von Anfang an Mutter und Vater gewesen. Mama Baba eben, wie er sie nannte und wie sie fortan bei allen hieß, die sie näher kannten.
In Momenten wie diesen hasste Baba es, dass ihr die starke Hand eines Vaters fehlte, die Jess zeigte, wo es langging. Inzwischen war er acht Jahre alt und ein munterer kleiner Bursche, dessen Temperament sie manchmal überforderte. Seit ein paar Monaten gehörte er der Kinder-Kolonne auf den Zuckerrohrfeldern an und schuftete schwer. Die harte Arbeit würde aus ihm eines Tages einen starken muskulösen Mann machen. Einen Sklaven, der allein schon aufgrund seiner Statur die Aufmerksamkeit der Backras auf sich ziehen würde – jener weißen Männer und Frauen, die sein Leben von Geburt an in der Hand hielten. Umso mehr ängstigte Baba sich, dass Jess etwas angestellt haben könnte. Die Sorge um ihren einzigen Sohn machte sie halb wahnsinnig. Dabei galt sie unter den Sklaven als eine starke, durchsetzungsfähige Frau, die sich selbst von ihren weißen Herren kaum etwas sagen ließ. Ihr Rücken war ganz vernarbt von all den Peitschenhieben, die sie im Laufe der Jahre für ihre Widerspenstigkeit kassiert hatte.
Dass man sie noch nicht auf dem Sklavenmarkt in Kingston verkauft hatte, war einzig einem Umstand zu verdanken, über den Baba selbst Estrelle gegenüber eisern Stillschweigen bewahrte: Ihr Master, Lord William Blake, ein perverser, hochnäsiger Widerling, verlangte von ihr, dass sie ihm auf die übelste Weise zu Willen sein musste. Seit er sie als junges Mädchen auf den Feldern erblickt hatte, verschleppte er sie regelmäßig in seine Jagdhütte und verlangte Dinge von ihr, die seine weiße Frau ihm nicht zu geben bereit war. Wie oft hatte er sie ans Bett gefesselt, geschlagen und war über sie hergefallen wie ein brunftiges Tier! Danach hatte er sie jedes Mal mit kostbaren Geschenken und teuren Stoffen verwöhnt. Wahrscheinlich, weil ihn das schlechte Gewissen plagte, denn als gläubiger Anglikaner, der jeden Sonntag in die Kirche lief, musste er wohl um sein Seelenheil fürchten, wenn er so abstoßende Sünden beging.
Doch geändert hatte er sich deshalb noch lange nicht. Zweimal hatte sie eine Fehlgeburt erlitten, weil er keine Rücksicht auf ihren Zustand genommen hatte. Aber Baba hatte das alles ausgehalten. Zum einen, weil ihr nichts anderes übrig blieb; zum anderen, weil sie durch seine Zuwendungen unter den restlichen Sklavinnen als etwas Besonderes galt. Sie besaß schöne Kleider, verfügte über besseres Essen und verbrachte mehr Zeit im weichen, frisch bezogenen Bett des weißen Herrn als auf den staubigen Zuckerrohrfeldern.
Als sie schließlich Jess zur Welt brachte, einen kleinen, widerstandsfähigen Kerl, dem die Grobheiten seines Vaters während der Schwangerschaft nichts anhaben konnten, war ihr Glück beinah perfekt. Jeder auf Redfield Hall ahnte wohl, dass Jess der Sohn des Masters war. Das konnte man nicht nur an seiner vergleichsweise hellen Hautfarbe erkennen. Auch sein schmales Gesicht war mehr das eines Europäers und hatte wenig gemein mit den Zügen der rein afrikanischen Bälger, die nicht selten mitten auf dem Feld das Licht der Welt erblickten.
Vom Tag seiner Geburt an hoffte Baba inständig, dass Lord William ihrem Sohn eines Tages die Freiheit schenken würde. Immerhin war Jess sein zweitgeborener Sohn – nach dem schmächtigen Edward, der fünf Jahre älter war und sich nicht eben bester Gesundheit erfreute. Auch Edwards Mutter, Lady Anne, eine vornehme Dame aus Europa, war seit der Schwangerschaft meistens zu krank und zu schwach gewesen, um ihre ehelichen Pflichten zu erfüllen. Und so hatte Baba ziemlich oft herhalten müssen, um ihren Herrn zu befriedigen. Doch seit die Lady nach Jahren der Unfruchtbarkeit nun zum zweiten Mal guter Hoffnung war, hatte sich sein Interesse an Baba merklich abgekühlt. Es hieß, er habe sich bereits ein anderes Mädchen gesucht, das williger war und weniger Forderungen stelle.
Doch nicht das beunruhigte Baba: Wenn Lady Anne ihrem Gatten einen zweiten männlichen Erben schenkte, würde Jess so unbedeutend für ihn werden wie ein Blatt im Wind. Mehrfach hatte Baba ihrem Master vorgehalten, dass Jess sein einziger Erbe wäre, falls der kränkliche Edward an einem Fieber stürbe. William war daraufhin sehr wütend geworden und hatte sie als elende Niggerhure beschimpft.
«Wegen deiner Herkunft und deiner Hautfarbe giltst du nicht als Mensch, sondern als Tier!», rief er aufgebracht. «Und deine Brut kann deshalb auch niemals Erbschaftsrechte erwerben.»
Als Baba ihn daraufhin als Sodomiten beschimpft hatte, der es mit Tieren trieb und den Gott für sein lästerliches Leben hart bestrafen würde, war er ihr an die Kehle gesprungen und hatte sie beinahe erwürgt. Seit jener Nacht hatte Baba nicht nur Angst um sich, sondern auch um ihren geliebten Jess. Je mehr sie jetzt darüber nachdachte, umso mehr schloss sich eine kalte Faust um ihr Herz. William Blake war zu allem fähig, wenn er jemanden hasste.
«Ich muss zu unserem Master», stieß Baba heiser hervor.
«Das kannst du nicht ernst meinen! Was ist, wenn er denkt, dass Jess davongelaufen ist?» Estrelle, deren Haut im Gegensatz zu Baba beinah so schwarz war wie das Gefieder eines Truthahngeiers, riss vor Entsetzen ihre kugelrunden Augen auf. «Sie werden den Jungen mit Bluthunden jagen!», warnte sie. «Die Bestien werden ihn zerfleischen, wenn sie ihn aufspüren! Nur Desdemona kann dir helfen. Sie kann in den Knochen lesen und sehen, wo sich dein Sohn befindet.»
«Aber sie lebt fast einen halben Tagesmarsch entfernt im Dorf der Maroon, und ich habe keine Erlaubnis, die Plantage zu verlassen.» Mit abwesendem Blick starrte Baba in das spärliche Licht einer Talgkerze.
«Es ist Nacht, Baba, und im Herrenhaus schlafen sie alle. Trevor liegt betrunken in seiner Aufseherhütte, und seine Kameraden spielen Karten oder amüsieren sich mit den jungen Sklavinnen. Wer also sollte bemerken, dass du fort bist? Wenn du dich beeilst, bist du zum ersten Glockenschlag morgen früh wieder da.»
Als Baba schwer keuchend an die Hütte der alten Desdemona klopfte, hatte sie einen zweistündigen Fußmarsch hinter sich. In gebückter Haltung war sie am Haupthaus von Redfield Hall vorbeigeschlichen und quer über die abgeernteten Zuckerrohrfelder der Nachbarplantage Rosehall gelaufen. Anschließend hatte sie sich durch den beinah undurchdringlichen Urwald gekämpft und sich mit ihrem gewaltigen Pflanzmesser den Weg frei geschlagen. Das dichte Blätterwerk und der bedeckte Himmel sorgten dafür, dass kaum Mondlicht durch sein üppiges Dach fiel. Die Wipfel über ihr rauschten und ächzten gewaltig, und streckenweise konnte sie den Weg nur erahnen. Doch immer wenn der starke Wind die Wolkendecke aufbrach, kam Baba schneller voran.
Sie war völlig außer Atem, als sie endlich die Hütte der alten Zauberin erreichte. Nach einigem Rumoren im Innern der Hütte öffnete die alte Desdemona die Tür. Ihr runzliges Gesicht vereinte Merkmale einer vergleichsweise hellhäutigen Indianerin mit denen eines kohlschwarzen Negers, den die Briten vor der Westküste Afrikas gefangen und auf diese Insel verschleppt hatten.
Desdemona wirkte so alt wie die Welt. Ihre blinden Augen überzog ein merkwürdiger weißer Schleier. Die alte Obeah-Frau behauptete stets, das Augenlicht sei ihr von den Göttern ihrer Vorfahren genommen worden, damit sie besser ins Jenseits schauen könne und nicht durch das trügerische Licht des Diesseits gestört werde.
Aufgrund ihrer mütterlichen Abstammung gehörte Desdemona zu den Maroon, einer Gruppe von ehemaligen Sklaven, die sich mit den Ureinwohnern der Insel vermischt hatten und bereits vor fast achtzig Jahren nach hartnäckigen Kämpfen mit den weißen Plantagenbesitzern und den Soldaten der britischen Krone ihre Freiheit erstritten hatten. Ihr Vater war ein Obeah-Mann gewesen, ein schwarzer Zauberer, der die Geheimnisse der Geister und Götter der Aschanti von Afrika mit übers Meer gebracht hatte.
«Komm herein, meine Tochter», sagte sie und schien kaum verwundert, dass Baba so spät in dieser stürmischen Nacht vor ihrer Hütte aufgetaucht war.
Erst gestern war die Schamanin im Dorf der Sklaven von Redfield Hall gewesen und hatte vor aller Augen einen Hahn geschlachtet, um die Geister der Unterwelt zu beschwören, damit bei Jess endlich das Fieber zurückging. Obwohl die weiße Regierung einem solchen Treiben kritisch gegenüberstand, wurde es zur Heilung von Kranken geduldet. Offenbar waren Desdemonas Bemühungen von Erfolg gekrönt gewesen, denn der Junge hatte am Morgen bereits einen halbwegs munteren Eindruck gemacht. Dennoch hatte Baba beim Aufseher um eine weitere Freistellung gebeten, die bei Kindern durchaus gewährt wurde. Ein unbekanntes Fieber sollte nicht unnötig die Arbeitskraft der anderen Sklaven aufs Spiel setzen.
Desdemona bot Baba einen Platz an dem glimmenden Lagerfeuer im Innern der Hütte an, das sie mit ein paar trockenen Ästen und Palmblättern befeuerte.
«Ich suche meinen Sohn», sagte Baba mit gedämpfter Stimme, aus der ihre Verzweiflung herauszuhören war. «Jess ist seit heute Nachmittag verschwunden! Wir haben ihn überall gesucht.»
Desdemona nickte verständig, sagte jedoch kein Wort. Stattdessen holte sie eine flache, offene Holzkiste hervor, deren Seiten jeweils gut eine Elle lang waren, und stellte sie auf den gestampften Boden. Dann arrangierte sie in den vier Ecken ein Stück glimmende Holzkohle, eine kleine Schale mit Wasser, ein Häufchen Sand und eine Hühnerfeder. Sie symbolisierten die vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde und Luft. Zum Schluss nahm sie eine kleinere, verschlossene Holzschachtel vom Regal und hob vorsichtig den Deckel an. Baba erschrak, als ein sich windender, schwarzer Skorpion zum Vorschein kam. Desdemona packte das Tier trotz ihrer Blindheit geschickt am Stachel und ließ es mitleidslos in die größere Kiste fallen. Sogleich sauste der Skorpion flink umher, musste aber recht schnell erkennen, dass seine neue Freiheit begrenzt war.
Baba kauerte sich ängstlich zusammen und beobachtete, wie Desdemona im Schein des Feuers in eine Art Trance versank und unverständliche Beschwörungsformeln murmelte. Allmählich gab der Skorpion seine hektischen Bewegungen auf und wanderte nur noch zwischen zwei Ecken hin und her: Wasser und Luft. Und obwohl die blinde Desdemona seine Bewegungen nicht in gleicher Weise mitverfolgen konnte wie Baba, erkannte sie offenbar die Zusammenhänge.
«Dein Sohn lebt», erklärte sie schlicht, «aber er ist nicht mehr auf der Insel. Er befindet sich zusammen mit einem großen, dunkelhaarigen Mann auf dem Meer. Dieser wird von nun an sein Master sein.»
Babas Brust durchfuhr ein gewaltiger Schmerz, so stark, dass sie nach Atem ringen musste. «Nein», flüsterte sie außer sich vor Angst. «Das darf nicht sein.»
«Verabschiede dich innerlich von deinem Kind», fuhr Desdemona tonlos fort. «Es ist möglich, dass du deinen Sohn nie wiedersiehst.»
Als Baba drei Stunden später durch den peitschenden Regen über die Felder rannte, fühlte sie nichts mehr. Nicht die durchdringende Nässe ihrer Kleidung, nicht den Schmerz, der in ihr wütete, und auch nicht die Ohnmacht, die sie erfüllte. Sie kannte nur noch ein Ziel: Redfield Hall, das Haus ihres Herrn.
In der Dunkelheit zuckten die Blitze am Himmel, und mit jedem Lichtstoß leuchtete ein neues Bild vor ihrem geistigen Auge auf: wie sie Jess von seinem Vater empfing … wie ihr Leib zum ersten Mal die menschliche Frucht hielt und ihr Bauch zu einer riesigen Melone heranwuchs … wie sie den Jungen bei einer komplizierten Geburt unter heftigen Schmerzen gebar … wie er schließlich in ihren Armen lag und sein kleiner Mund gierig an ihrer Brust säugte … wie er zu einem stattlichen, jungen Burschen heranwuchs, der seinen eigenen Kopf hatte … und wie er trotz seiner Wildheit mit zärtlicher Liebe an ihr hing und vor Kummer fast verging, wenn sie ihn alleine in der Hütte zurücklassen musste, weil der Master ihre Dienste verlangte …
Baba stolperte durch die Nacht wie ein verwundetes Tier. Verstört und völlig durchnässt erreichte sie in den frühen Morgenstunden Redfield Hall.
Der Hahn hatte noch nicht gekräht und die Glocken der kleinen Kirche den neuen Arbeitstag noch nicht eingeläutet, als sie die Tür des Haupthauses aufstieß. Ohne rechts und links zu schauen, stürmte sie in die eindrucksvolle Empfangshalle. Beinahe rannte sie Terry, den Leibsklaven, über den Haufen, der gerade ein Glas mit heißer Milch auf einem Tablett balancierte. Vermutlich hatte die Missus nach einem Morgentrunk rufen lassen.
Der livrierte Butler geriet ins Wanken, und die heiße Milch schwappte über seine Hände. Er schleuderte Baba ein paar ungehobelte Flüche entgegen, doch sie rannte bereits die Treppe hinauf, zwei Stufen auf einmal nehmend. Vorbei an den Wandleuchtern, deren flammende Kerzen Schatten in die oberen Stockwerke warfen.
«Hey! Wo willst du hin?», rief ihr der aufgebrachte Mann hinterher.
Natürlich wusste er, dass Baba nicht ins Haus, sondern auf die Felder gehörte, weil die Rangordnung der Sklaven auch etwas mit ihren zugewiesenen Aufgaben zu tun hatte.
Wie aufgeschreckte Vögel steckten jetzt weitere Hausangestellte ihre Köpfe aus den Türen im Erdgeschoss. Doch ungeachtet der entgeisterten Blicke, setzte Baba ihren Weg in den ersten Stock fort, wo Seine Lordschaft mit Ihrer Ladyschaft über zwei nebeneinanderliegende Schlafgemächer verfügte. Von Estrelle, die ab und an im Haus aushalf, wusste Baba, dass die Gemächer der beiden Eheleute durch eine Tür miteinander verbunden waren.
Als sie die erste Tür aufstieß, tat Ihre Ladyschaft einen entsetzten Schrei und fuhr so rasch in ihrem Bett auf, dass sie ihr sorgsam aufgesetztes Häubchen verlor. Sofort fiel das rotblonde Haar in langen Wellen herab, was ihr zartes, weißes Gesicht noch bleicher erscheinen ließ. Ihr Blick war so panisch, als habe sie ein Gespenst gesehen. Doch Baba hatte keine Zeit, die hochschwangere Missus länger zu betrachten. Sie wollte Antworten von ihrem Master, und wenn es ihr Leben kosten würde.
Schon stürmte sie durch die Zwischentür. Lord William saß im Bett und hatte bereits eine Lampe entzündet. Baba irritierte sein ungewohnter Anblick. Unzählige Male hatte sie seinen gestählten Körper nackt gesehen, aber noch nie war ihr William Blake im Nachthemd begegnet, und schon gar nicht mit einer Zipfelmütze auf seinem grau werdenden Haupt. Doch er musste den Eindringling erwartet haben. Denn in seiner Rechten hielt er eine Pistole.
«Wo ist mein Sohn?», schrie Baba und ignorierte, dass der Lauf der Waffe auf sie gerichtet war.
Der Master zögerte einen Moment, ob aus Überraschung oder vor Zorn vermochte Baba nicht zu sagen. Die Angst um ihr Kind steigerte sich in grenzenlose Hysterie.
«Wo ist Jess?», brüllte sie wie von Sinnen. «Und wage ja nicht, so zu tun, als wüsstest du es nicht!»
Dass sie ihn vor seiner Frau und allen anwesenden Haussklaven in einer solch respektlosen Weise behandelte, machte die Sache nicht besser. Lord Williams Kopf schwoll vor Zorn rot an.
«Verkauft!», sagte er in einem bemüht nüchternen Ton. «An einen spanischen Händler.» Als er sah, wie schockiert Baba reagierte, fügte er ohne Erbarmen hinzu: «Beide haben die Insel bereits verlassen. Also hör auf zu lamentieren. Du kannst dir ja von irgendeinem dahergelaufenen Nigger einen neuen Jesús machen lassen. Je eher, desto besser.»
Für einen Moment war Baba wie betäubt. Fassungslos starrte sie auf den Mann, der sie so viele Jahre missbraucht und gequält hatte. Der körperliche Schmerz, den sie ertragen hatte, war nichts im Vergleich zu dem, was sie nun fühlte.
«Ich … verfluche … dich, William Blake», flüsterte sie gefährlich leise. «Dich und deine gesamte Familie. Auf dass deine Frau und deine Kinder einen baldigen Tod finden mögen. Und alle Frauen, die auf Redfield Hall noch folgen werden! Sie sollen allesamt eines frühzeitigen Todes sterben und auf immer und ewig in der Hölle schmoren!»
Rascher, als William reagieren konnte, riss Baba sich das Pflanzmesser vom Gürtel. «Der Teufel selbst und all seine Dämonen sollen meine Zeugen sein, dass ich diesen Fluch hier und heute und für alle Ewigkeit mit meinem Blut besiegele!»
Dann schnitt sie sich vor den entsetzten Augen aller Umstehenden mit zwei schnellen Bewegungen die Pulsadern auf.