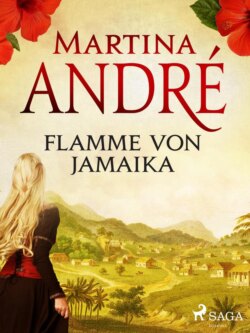Читать книгу Flamme von Jamaika - Martina Andre - Страница 16
Kapitel 8
ОглавлениеSeptember 1831 // Jamaika // Obeah- Zauber
Mit ihren fünfzig Sommern war Baba längst nicht mehr die Jüngste. Aber das Leben in den Blue Mountains hatte sie in all den Jahren der Entbehrung zäh gemacht, und so war sie immer noch flink und konnte bei Gefahr wie eine Ferkelratte in jedem sich bietenden Loch verschwinden.
Im Park hinter dem Herrenhaus wimmelte es bereits von Verfolgern. Auch ein paar Neger waren darunter, aber vor ihnen hatte Baba keine Angst. Geriet sie jedoch in die Hände der Weißen, war sie so gut wie tot, und diesmal würde es endgültig sein.
Mit Schaudern dachte sie an jene schicksalhafte Nacht zurück, als sie sich im Schlafzimmer von William Blake die Adern mit einer Machete geöffnet hatte. Danach hatte der noch junge Trevor Hanson ihren blutenden, erschlafften Körper in einen dunklen Schuppen geschleppt. Ohne Gnade hatte er sie in ihrem ohnmächtigen Zustand noch einmal vergewaltigt, bevor er sie in den White River geworfen hatte. Sicher in der untrüglichen Absicht, sich die Finger nicht noch schmutziger machen zu müssen und die Entsorgung ihres Kadavers getrost den hungrigen Krokodilen zu überlassen. Im Wasser treibend, hatte sie zwar das Bewusstsein wiedererlangt, war jedoch zu schwach gewesen, um sich aus eigener Kraft ans Ufer zu retten. Dann war ihr endgültig schwarz vor Augen geworden, und sie war sicher, das Reich der Toten betreten zu haben. Eine energische Stimme hatte sie jedoch zu den Lebenden zurückgeschickt. Am nächsten Morgen entdeckte Jeremia, damals ein Haussklave im mittleren Alter, sie zufällig am Ufer.
Bei Einbruch der Dunkelheit hatten er und Estrelle ihren halbtoten Körper heimlich zu Desdemona geschafft. In ihrer Hütte hatte die alte Schamanin sie vollständig ins Leben zurückgeholt. Seither galt Baba als ein Mensch, der von den Toten zurückgekehrt war, und sie genoss unter den eingeweihten Sklaven eine besondere Beachtung.
Doch sie ahnte, dass sie diesmal nicht so viel Glück haben würde, sollte sie Hanson in die Hände fallen oder von den Soldaten des Gouverneurs geschnappt werden.
Von dieser Erkenntnis getrieben, rannte Baba nun durch den Park hinunter zum Flussufer. Nasse Äste schlugen ihr ins Gesicht, und ihre nackten Fußsohlen schmerzten von den spitzen Steinen. Einmal schlug sie der Länge nach hin, weil der Regen den Boden rutschig gemacht hatte. Sofort rappelte sie sich wieder auf und watete so tief wie möglich ins rettende Schilf, das zu dieser Jahreszeit besonders hoch stand. Wenn es ihr gelang, auf die andere Seite des Flusses zu schwimmen, war sie in Sicherheit. Denn dort begann der Mangrovenwald, und die hohen Bananenstauden auf dem Feld dahinter standen so dicht, dass sie einem Flüchtenden gut Schutz bieten konnten.
In Gedanken überdachte Baba ihren weiteren Fluchtweg. Bis zur Dämmerung wollte sie es bis zum Rio Nuevo schaffen. Von den bewaldeten Hängen der dahinterliegenden Berge aus würde sie dann am Flint River entlang den Rückweg in die Blue Mountains antreten.
Hinter ihr hallten die Rufe zahlloser Männer. Pferdegetrappel und das Bellen von Jagdhunden waren zu hören. Hastig streifte Baba ihr schwarzes Gewand ab und watete, bekleidet mit dem blauen Arbeitskittel einer Sklavin, den sie zur Tarnung darunter trug, ins Wasser.
«Durchkämmt den Park!», rief eine Stimme im Befehlston. Eine andere brüllte: «Auf zu den Hütten! Treibt alle Sklaven raus und befragt jeden einzelnen, ob er was Verdächtiges gesehen hat.»
Baba spürte die Nähe der heranrückenden Soldaten und der ihnen folgenden Meute beinahe körperlich. Bis zum gegenüberliegenden Ufer waren es vielleicht dreihundert Fuß. Die Strömung zog das Wasser gemächlich zum Meer, das nur ein paar Meilen entfernt war. Während das Gebell der Hunde immer lauter wurde, glitt sie mit dem gesamten Körper in die Fluten. Sie musste ein ganzes Stück in den Fluss hineinschwimmen, um komplett untertauchen zu können. In der Ferne sah sie, wie die ersten Häscher das Ufer erreichten. Mit ihren Pferden galoppierten die Soldaten flussaufwärts, in die falsche Richtung, doch es würde nicht lange dauern, bis sie ihren Irrtum bemerkten.
Baba atmete tief ein und tauchte ab. Sie war eine hervorragende Schwimmerin. Als Kind hatte sie nach Muscheln und Krebsen getaucht, um den kärglichen Speiseplan in den Sklavenunterkünften ein wenig zu bereichern. Später hatte sie dazu keine Zeit mehr gehabt, weil sowohl William Blake als auch sein Aufseher gleichermaßen einen Narren an ihr gefressen hatten. Als Anerkennung ihrer besonderen Dienste bekam sie manchmal ein Stück Stoff oder einen Beutel Tabak, den sie gegen Fleisch und Fisch tauschen konnte. Das ging so lange gut, bis William ihr nicht nur die Seele, sondern auch ihr geliebtes Kind genommen hatte.
Kurz tauchte Baba auf, um Luft zu holen.
«Da!», rief eine laute Stimme. «Da war was in der Mitte des Flusses, ich habe es deutlich gesehen.»
Der Rest seiner Worte ging für Baba im gurgelnden Wasser unter. Sie hielt die Luft an und starrte mit offenen Augen ins trübe Nass. Als plötzlich ein dunkler Schatten an ihr vorbeihuschte, war der Schreck größer als die Angst vor ihren Verfolgern. Ein Flussalligator! Gut zwei Meter lang.
Baba wusste, dass die Tiere in der Regel keine Menschen anfielen, doch was wäre, wenn er so ausgehungert war wie sie selbst? Oder wenn er sich von einer tauchenden Negerin bedroht fühlte? Dies war schließlich sein Revier. Halt dich von den Dämonen der Flüsse fern, dann tun sie dir nichts!, hatte ihre Großmutter immer erklärt.
Baba schwamm, so schnell sie konnte, unter Wasser weiter. Erst als sie spürte, wie ihr die Brust eng wurde, tauchte sie kurz auf und schnappte gierig nach Luft. Die Mangrovenwurzeln auf der anderen Seite des Ufers lagen nur noch ein oder zwei Beinschläge entfernt!
«Da!» Die Stimme schallte über den Fluss. «Ich glaube, ich habe wieder etwas gesehen.»
Im gleichen Moment tauchte der schuppige Kopf des Alligators neben Baba auf. Die gelben Schlitze fixierten sie bösartig.
Fieberhaft dachte sie nach, wie sie dem Tier entkommen könnte. Sie konnte unmöglich aufspringen und wegrennen. Dann würden die Soldaten auf sie schießen!
«Das ist nur ein Krokodil», kam es vom anderen Ufer, «ich kann es ganz deutlich an seinem schuppigen Rücken erkennen, der aus dem Wasser ragt.»
Baba bekam unvermittelt eine Mangrovenwurzel zu fassen. Um den Alligator nicht aufzuschrecken, der noch immer reglos im Wasser verharrte, zog sie sich vorsichtig Richtung Ufer. Wie eine Meereskrabbe hangelte sie sich weiter voran, bis das Wasser ihr nur noch bis zur Brust reichte und eine Lücke zwischen den Wurzeln sichtbar wurde. Dort konnte sie ans Ufer kriechen.
Baba stemmte sich auf die Knie und wollte gerade in gebückter Haltung in den dahinterstehenden Wald laufen, als einer der Hunde lauthals zu bellen begann.
«Das ist sie!», brüllte einer der Männer übers Ufer. «Das muss die Frau sein, warum sonst wäre sie ins Wasser gegangen?»
So hastig und unsicher, wie Baba sich nun bewegte, mussten die Soldaten die richtigen Schlüsse ziehen.
«Ergreift sie!», schrie ein großer blonder Soldat, der sich anschickte, mitsamt seinem Pferd den Fluss zu überqueren.
Sein grüner Rock verriet, dass er ein Scharfschütze war – so viel hatte sie nach all den Jahren im Schatten der britischen Garnisonen gelernt. Er trug ein Gewehr, und er würde es nutzen. Hinter ihm folgten zwei weitere Reiter sowie eine Horde Bluthunde, die sich jetzt ebenfalls unerschrocken ins Wasser warfen. Es würde nicht lange dauern, bis ihre Verfolger das andere Ufer erreichten. Und ganz gleich, wie schnell sie ihre Beine trugen, Baba hatte kaum eine Chance, ihnen zu entkommen.
Atemlos kämpfte sie sich durch die ausladenden Bananenstauden mit ihren herunterhängenden, fleischigen Blättern. Immer wieder blickte sie zum Himmel, um sich am Stand der Sonne zu orientieren, die nach dem plötzlichen Gewittersturm mit ihrem gleißenden Licht aus den Wolken hervorbrach. Als Baba den Rand des Feldes erreicht hatte, blieb sie für einen Moment keuchend stehen. Ein kurzes Stück musste sie noch über eine freie Fläche laufen, dann wartete die bewaldete Anhöhe eines Hügels auf sie. Baba hoffte, sich dort im Unterholz verkriechen zu können.
Das Kleid klebte ihr klatschnass am Körper, der Schweiß lief ihr in Strömen das Gesicht und die Brust hinab, und ihr altes Herz raste vor Anstrengung. Als sie erneut das Bellen der Hunde vernahm, erschrak sie. Ihre geschundenen Füße wollten ihr den Dienst versagen, doch Baba zwang sich trotz der unsäglichen Schmerzen, den Weg über das harte Steppengras fortzusetzen.
Kaum dass sie am Fuße der rettenden Hügelkette angelangt war, vernahm sie das Getrappel galoppierender Pferde. Wie eine Schlange verkroch sie sich hinter einem umgestürzten Akazienbaum und spähte durch ein Loch in der Rinde. Mit durchnässten Uniformen saßen die Soldaten auf ihren schnellen Rotfüchsen und folgten den Bluthunden, die ihre dicken Nasen unablässig über den Boden schoben. Mal hier, mal da schnüffelnd, suchten sie vergeblich die Spur ihres Opfers. Offenbar hatte der Fluss ihren Geruch verschluckt.
Als die Männer vorbeigeritten waren, atmete Baba tief durch. Vorsichtig kroch sie weiter durchs Gebüsch und die verschlungene Anhöhe hinauf, bis sie auf einen ausgetretenen Waldweg stieß, der von einer hohen Baumgruppe umgeben war. Dabei schreckte sie ein paar Vögel auf, und sogleich schlugen die Hunde an. Für die Pferde war dieses unebene Terrain schwierig. Aber natürlich konnten die Hunde sie auch hier aufspüren, und die Angst, von ihnen zerfetzt zu werden, nahm mit jedem Schritt weiter zu. Aus Erfahrung wusste sie, dass die weißen Herren es gerne ihren Hunden überließen, flüchtende Sklaven mit schmerzhaften Bissen zu bestrafen. In Babas Fall würden die Soldaten sicher nicht einschreiten, bis die Bestien sie totgebissen hatten.
Schon hörte Baba ein Rascheln hinter sich, und das bösartige Kläffen kam unaufhaltsam näher. Sie fuhr herum, als eines der Biester mit gefletschten Zähnen zum Sprung ansetzte. Baba glaubte schon, die scharfen Fänge auf ihrer Haut zu spüren, als ein Schuss fiel und das Knurren sich in ein helles Jaulen verwandelte. Völlig überrascht starrte sie auf das am Boden liegende Tier. Jemand hatte es erschossen. Bevor Baba auch nur einen klaren Gedanken fassen konnte, tauchte ein Reiter auf einem stattlichen Maultier neben ihr auf, und ein starker Arm legte sich um ihre Taille. Wie von Geisterhand hob sich ihr magerer Körper in die Lüfte und landete unsanft vor dem Mann im Sattel. Der Blick in sein strenges Gesicht und auf sein schulterlanges, nussbraunes Haar, das er mit einem schwarzen Stirnband zu bändigen versuchte, verschaffte Baba Gewissheit. Ein Gefühl tiefer Erleichterung erfasste sie, als er seinen schützenden Arm um sie legte.
«Jess!?» Ihre Stimme war nur noch ein heiseres Krächzen, so geschwächt war sie mittlerweile. «Ich werde verfolgt!»
«Sei ruhig! Ich hab’s gesehen.»
Ihr Sohn trug eine schwarze Armeehose und die schweren Reitstiefel eines Soldaten. Beides musste aus einem Überfall auf ein Lagerhaus der Armee stammen. Sein feuchtes Hemd hatte er ausgezogen und mit den Ärmeln an den Sattel des Mulis geknotet. Sein muskulöser Oberkörper und seine mächtigen Arme glänzten vom Schweiß.
Plötzlich fiel ein zweiter Schuss, und wieder jaulte ein Hund auf. Erst jetzt registrierte Baba, dass Jess nicht alleine gekommen war. Eine ganze Horde von dunkelhäutigen Rebellen, die auf sein Kommando hörte, ließ den Wald lebendig werden. Nathan, ein kleiner gedrungener Kämpfer mit pechschwarzer Haut, hatte den zweiten Hund erschossen, während die anderen fünf Krieger ihre Pistolen nachluden.
«Gebt acht, wenn sie durch das Blattwerk stoßen», raunte Jess ihnen zu. «Es sind nur drei Soldaten, aber ihr müsst sie mit dem ersten Schuss erwischen, sonst schießen sie zurück oder entkommen und holen Verstärkung.»
Dann schnalzte er mit der Zunge, und der Maulesel trug seine beiden Reiter eine Serpentine hinauf. Währenddessen umklammerte Jess ihren dürren Körper, als ob er sie mit seiner bloßen Anwesenheit schützen könnte. Baba wusste, er würde sie um jeden Preis vor den Soldaten retten und in Sicherheit bringen. Ein Gefühl tiefer Geborgenheit durchflutete sie.
«Jess, ich …», begann Baba, nachdem sie wieder zu Atem gekommen war.
«Halt den Mund!», herrschte er sie von neuem an. «Denk ja nicht, dass du dich bei mir entschuldigen kannst! Oder dass ich deiner Wahnsinnstat Verständnis entgegenbringe!»
Erstaunlich flink erklomm der Muli die nächste Höhe, während am Fuße des Berges zwei weitere Schüsse fielen. Baba wagte es nicht, den Steilhang hinabzusehen. Was würde aus den übrigen Jungs werden, wenn sie es nicht schafften, die Soldaten zu erledigen? Die Männer waren Jess treu ergeben und folgten ihm in jeden noch so aussichtslosen Kampf. Nicht nur das eigene Leben hatte Baba leichtsinnig aufs Spiel gesetzt, sondern auch das ihres Sohnes und seiner Krieger.
«Es tut mir leid», stieß sie kläglich hervor.
«Das wird Cato nicht reichen», erwiderte Jess düster. «Der Ältestenrat wird darüber befinden, was mit dir geschehen soll. Du hast sämtliche Regeln gebrochen. Und dafür wirst du bestraft werden müssen.»
«Woher wusstest du …?»
«Du meinst, wie ich dich finden konnte?»
Seine Stimme klang ein klein wenig weicher, oder bildete sie sich das nur ein? Sie empfand es als Schande, dass sie ihren einzigen Sohn nicht gut genug kannte, um ihn einschätzen zu können. Obwohl sie ihn vor mehr als fünfundzwanzig Sommern geboren hatte, waren sie fast zwanzig Jahre getrennt gewesen. Erst vor einem Jahr war er nach all der schrecklichen Ungewissheit aus Kuba zu ihr zurückgekehrt. Genauso plötzlich, wie William Blake ihn ihr einst genommen hatte. Nun trauerte sie nicht mehr um das verlorene Kind, sondern um die verlorenen Jahre, die sie nicht gemeinsam mit ihm hatte erleben können.
Jess war in der Zeit seiner Abwesenheit, die er als Sklave in Kuba verbracht hatte, zu einem erwachsenen Mann gereift. Und wenn Baba ehrlich war, so war ihr der eigene Sohn im Grunde ein Fremder. Immer noch spürte sie den furchtbaren Verlust, der sich mit unbändigem Hass mischte. William Blake trug an all dem eine Schuld, die er niemals zu sühnen vermochte.
Und selbst jetzt gönnte ihr der eiserne Lord, wie sie William Blake seit jenen Tagen bezeichnete, keine Ruhe. Er gehörte zu den schlimmsten Verfechtern der Sklaverei und Jess zu ihren entschlossensten Gegnern. Mit aller Macht lehnte sich ihr Sohn gegen die weißen Herren auf und somit gegen seinen eigenen Vater.
Als Jess vor knapp einem Jahr im Lager der Rebellen aufgetaucht war, um nach ihr zu suchen, hatte sie zunächst an ein Wunder geglaubt. Die Freude war grenzenlos. Alles wollte sie von ihrem Sohn wissen, einfach alles. Jess erzählte, dass sein spanischer Herr, Fernando de Montalban, ihm auf dem Sterbebett die Freiheit geschenkt und ihn über seine Herkunft aufgeklärt habe. Doch zu allem Unglück hatte der Neffe des Mannes die Plantage übernommen und die Freilassungsurkunde des Onkels nicht akzeptiert. Daher hatte sich Jess zur Flucht entschlossen.
Trotz der immensen Gefahr war ihr Sohn nach Jamaika zurückgekehrt, um seine Mutter zu suchen. Hoch in den Bergen hatte er sie schließlich gefunden, in einem versteckten Rebellennest, das entrechteten, misshandelten und vom Tode bedrohten Menschen wie Baba Zuflucht bot. Jess war sofort in Catos Rebellenarmee aufgenommen worden, die für die endgültige Befreiung aller Sklaven kämpfte. Er besaß Mut, wie seine Mutter, und er war ein Kämpfer, wie sein Großvater, der einst aus Afrika hierher verschleppt worden war. Äußerlich hatte Jess nicht mehr viel von einem Afrikaner, er war ein Terzerone, der nur gut ein Drittel afrikanisches Blut in sich trug. Und doch war er trotz allem immer ein Sklave geblieben.
Babas Blick fiel auf seine kräftigen Hände, die entspannt und präzise zugleich die Zügel des Maultiers hielten. Er war ein guter Mann, der Frauen und Kinder respektierte und schützte. Von seinem Vater hatte er den strengen Gesichtsausdruck eines Engländers. Heimlich verfluchte Baba die gerade Nase, die schmaleren Lippen und die leicht schräg stehenden Augen, wurde sie doch auf diese Weise immer wieder an das Scheusal erinnert, das ihn gezeugt hatte.
Aber im Gegensatz zu William Blake und seinem Sohn Edward war Jess kein gelackter Dandy, der faul auf der Haut lag, während andere sich Hände und Füße blutig schufteten. Jess war ein harter Arbeiter, der keine Mühen scheute und seinem Herrn stets treu gedient hatte. Dass er von jesuitischen Mönchen das Lesen und Schreiben gelernt hatte und nicht nur Spanisch, sondern auch die englische Sprache beherrschte, machte sie stolz. Er war schon als Kind ein intelligenter Bursche gewesen, denn eigentlich war es Sklaven bei Todesstrafe verboten, Lesen und Schreiben zu lernen, geschweige denn sich mehrere Sprachen anzueignen.
Überhaupt handelte Jess stets weitaus überlegter als Baba. Niemals hätte er ihr die Erlaubnis erteilt, das Rebellenlager heimlich zu verlassen. Schon gar nicht für ihre blödsinnige Zauberei, wie Jess ihre Gabe nannte. Deshalb hatte sie ihm auch nichts von ihren Plänen gesagt.
Aber sie hatte es tun müssen. Sie hatte zurückkehren müssen nach Redfield Hall, um Jess zu rächen. Niemals würde ihr Sohn den Schmerz einer Mutter nachvollziehen können, der man das Kind und damit die Zukunft geraubt hatte. Eine unendliche Qual, als ob einem das Herz bei lebendigem Leib aus der Brust geschnitten würde. Tausendfach würde sie William und seinen verfluchten Sohn diesen Schmerz spüren lassen!
Gedankenverloren strich sie Jess über die vernarbte Hand. Er ließ es geschehen, während er sein wendiges Maultier über die Bergkuppe und den Hang hinab in ein bewaldetes Tal lenkte.
«Die Soldaten hätten dich getötet, wenn sie dich erwischt hätten», erklärte er mit rauer Stimme. «Oder man hätte dich später gehängt.»
«Woher wusstest du überhaupt, wo ich war?», fragte Baba vorsichtig.
«Desdemona», erwiderte er knapp. «Ich habe ihr angedroht, ihre Hütte abzubrennen und sie aus dem Lager zu werfen, wenn sie mir die Wahrheit verschweigt.»
«Um Himmels willen, Jess! Wie kannst du es wagen?» Baba schlug die Hände vors Gesicht. «Sie ist eine Obeah-Zauberin. Eine heilige Frau! Was, wenn sie dich verflucht?»
«Wenn sie dich bei einem solchen Unsinn unterstützt, kann sie so heilig nicht sein», spottete er. «Du kannst von Glück sagen, dass wir dich vom Berg aus am Rand des Bananenfelds gesehen haben. Madre mio»!, stieß er wütend hervor. «Es waren Scharfschützen, Baba, die dich verfolgt haben! Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ob dich deine alten Füße noch bis zum Wald tragen würden, bevor es zu spät sein würde!»
Plötzlich wurde Baba bewusst, dass er sich wirklich um sie geängstigt hatte. Halb drehte sie sich zu ihm um und warf ihm einen flehenden Blick zu.
«Ich werde so etwas nie wieder tun», flüsterte sie. «Ich schwöre es, bei der Seele meiner Mutter!»
«Was wolltest du überhaupt bei diesen verteufelten Weißen?»
In seiner Stimme war das ganze Unverständnis zu hören: Wie konnte man nur an den Ort seiner Qualen zurückkehren, ohne die Möglichkeit zu haben, wahrhaftige Rache zu verüben?
«Er hat geheiratet, und ich habe seine Ehe verflucht!»
«Wer? Der alte Blake? Wen denn?» Jess wirkte durchaus erstaunt. «Ist er nicht schon älter als du?»
«Du Narr!», schalt sie ihn. «Nicht William, sondern Edward, dein Halbbruder hat sich eine Frau genommen.»
«Pah! Halbbruder!», höhnte Jess mit verächtlicher Stimme. «Ich will nichts mit dieser Familie zu tun haben.»
«Aber mir war es ein heiliges Anliegen, den Fluch, der auf den Blakes lastet, noch einmal zu bekräftigen. Auf dass sie kinderlos bleiben und aussterben. Denn das Schlimmste, was einem Mann wie William Blake widerfahren kann, ist, wenn er keine Nachkommen hat, die ihn eines Tages beerben. Auch die Frau soll sterben, wie all ihre Vorgängerinnen, verstehst du?»
«Du machst mir Angst.» Jess schüttelte ungläubig den Kopf. «Warum hast du nicht einfach seinen Schwanz verwünscht? Das hätte doch vollkommen gereicht. Was kann die Frau denn dafür, dass ihr Schwiegervater ein durchtriebener Höllenhund ist?»
Baba war beleidigt. Jess nahm die Kräfte von Desdemona, die sie bei ihrer schwarzen Zauberei unterstützte, nicht ernst. Aber auch Jess wusste, dass fünf Frauen im Hause Blake zu Tode gekommen waren. Und das lag sicher an ihrem Fluch.
«Warum hast du es immer auf die Frauen abgesehen und nicht auf die Männer?», bemerkte Jess mit einigem Unverständnis im Blick. «Schließlich stecken William Blake und sein Sohn hinter unserem Unglück und nicht seine Frauen.»
«Davon verstehst du nichts», blaffte Baba und blieb ihm eine Erklärung schuldig.
Im Grunde glaubte Jess nicht an Obeah-Zaubereien, denn er war bei den Jesuiten im katholischen Glauben erzogen worden. Doch er hielt sich zurück, allem Anschein nach wollte er seine Mutter nicht beleidigen.
«Ist sie wenigstens hässlich?», fragte er beiläufig.
«Wer?» Baba war immer noch ganz in Gedanken und erinnerte sich an den Moment, als sie William den Hahn an den Kopf geschleudert hatte.
«Die Braut – ist sie hässlich?», fragte er noch einmal so laut, als ob Baba schwerhörig wäre.
«Ich hab sie nur ganz kurz gesehen. Eine Weiße eben. So ein unglaublich blasses, nichtssagendes Ding mit strohblonden Haaren. Ich weiß nicht, was ein Mann an einer solchen Frau finden kann.»
«Wie ich die Blakes einschätze», erwiderte Jess mit einem Schulterzucken, «ist das Aussehen unwesentlich. Wahrscheinlich soll sie einzig und allein den Fortbestand ihrer Familie sichern.»
«Deshalb wundert es mich ja, dass sie sich schon wieder so eine schwindsüchtige Europäerin ausgesucht haben, wo doch jeder weiß, dass die kräftigen, dunkelhäutigen Frauen widerstandsfähiger sind und die gesünderen Kinder gebären. Aber ganz gleich ob sie dünn oder dick ist», triumphierte Baba boshaft, «ich werde ihr das Leben zur Hölle machen – und mit Hilfe von Desdemona verhindern, dass sie je ein gesundes Kind zur Welt bringt.»
Lord William wischte sich mit einem Schnupftuch den Schweiß von der Stirn.
«Was ist?», fragte er und blickte unwirsch zu Lena, die sich ihm vorsichtig näherte. «Haben sie die Furie zu fassen bekommen?»
«Ich habe keine Neuigkeiten. Aber wer könnte das gewesen sein?»
Lena sah ihren Schwiegervater mit einem eindringlichen Blick fragend an, ohne Rücksicht auf seinen momentanen Gemütszustand zu nehmen.
«Woher soll ich das wissen?», schleuderte er ihr entgegen. «Eine Verrückte. Was sonst?»
Als er bemerkte, dass nicht nur Lena fragend die Stirn runzelte, sondern auch die Gattin des Gouverneurs, die mit besorgter Miene an ihrer Seite stand, sah er sich offenbar gezwungen, weiter auszuholen.
«Wir beschäftigen rund tausend Sklaven auf unseren Plantagen, davon dreihundert Frauen», antwortete er mit gequältem Blick. «Das könnte jede gewesen sein. Wer weiß denn schon, was in deren krausen Köpfen vorgeht?»
Lena waren die mitleidigen Blicke der noch anwesenden Frauen nicht entgangen. Immerhin hatte dieser merkwürdige Fluch auch ihr gegolten. Und auch wenn sie nicht abergläubisch war, so fühlte sie sich doch leicht beunruhigt und wollte wissen, was der wahre Grund dieses Auftritts gewesen war. Irgendetwas vermittelte ihr das Gefühl, dass mehr dahintersteckte, als Lord William zugeben mochte. Warum hatte die merkwürdig verhüllte Gestalt am Ende ausdrücklich die Frauen der Familie verflucht und es nicht bei einem allgemeinen Fluch belassen?
«Komm», flüsterte Maggie, die neben sie getreten war. «Du siehst aus, als ob du frische Luft gebrauchen könntest.»
Gemeinsam traten sie nach draußen auf die Terrasse. Edward war immer noch nicht aufgetaucht. Der rasch zusammengestellte Suchtrupp unter dem Kommando von Captain Peacemaker war allem Anschein nach hinunter zum Fluss gelaufen, wo sich die Sklavenunterkünfte befanden. Hier und da sah man noch einen Grünrock zwischen Bäumen und Sträuchern aufblitzen.
«Lass uns ein wenig umhergehen», schlug sie Maggie vor und zog ihre Gesellschafterin zum Haupteingang.
«Was ist, wenn uns diese Hexe über den Weg läuft?», gab Maggie zu bedenken.
«Soweit ich sehen konnte, ist sie zum Fluss gelaufen und nicht zu den Wirtschaftsgebäuden. Außerdem wimmelt es hier von Soldaten.»
Lena hielt für einen Moment Ausschau, als sie nach draußen traten, und entschied sich, in Richtung Weinlager zu laufen, weil dort niemand zu sehen war. Sie war froh, einen Moment mit Maggie alleine sprechen zu können.
«Denkst du wirklich, dass es eine Verrückte war, wie Lord William vermutet?»
«Man muss schon ziemlich verrückt sein, um als Negerin so etwas zu tun», entgegnete Maggie. «Wenn du mich fragst, hat sie ihr Leben riskiert. Oder glaubst du ernsthaft, die Soldaten werden diese Frau einfach laufen lassen, wenn sie ihrer habhaft werden?»
«Ich finde, Lady Elisabeth hat auch merkwürdig reagiert. Anstatt zum Buffet zu gehen, hätte sie sich doch um Lord William sorgen müssen, meinst du nicht?»
«Vielleicht ist sie nur unglaublich gefräßig», mutmaßte Maggie. «Sie hat schon vorher die ganze Zeit nur übers Essen gesprochen.»
«Oder sie wollte die ganze Situation verharmlosen.»
«Dir bleibt nichts weiter übrig, als deinen frisch angetrauten Ehemann zu fragen, was das alles zu bedeuten hat. Schließlich müsste er ein Interesse daran haben, dich zu beruhigen.»
«Sobald ich ihn zu fassen kriege», grollte Lena und nahm mit entschlossener Miene das Weinlager ins Visier, vor dem eine Bank stand, auf der sie sich einen Moment mit Maggie niederlassen wollte.
Bei dem angrenzenden Gebäude handelte es sich um ein kleines weißes Steinhaus, dessen Eingang direkt in einen tiefen Keller führte, der nicht nur zur Aufbewahrung der Weine, sondern auch als Kühlhaus für leichtverderbliche Ware genutzt wurde.
«Ich fürchte, ich bekomme eine Migräne», stöhnte Lena und hielt sich die Stirn. «Der letzte Auftritt war einfach zu viel für mich.»
Als sie den Eingang zum Weinkeller passierten, bemerkte sie, dass die eiserne Tür einen Spalt offen stand. Estrelle hatte sie vor ein paar Tagen hierher mitgenommen, weil der Bestand des Vorratsraumes offiziell der Kontrolle der Hausherrin unterlag. Nur sie und Jeremia besaßen daher einen Schlüssel. Vorsichtig öffnete Lena den Spalt und lauschte. Sie glaubte ein leises Schluchzen zu hören, dazu ein unerklärliches Schnaufen. Vielleicht war jemand die steinerne Treppe hinuntergestürzt, hatte sich dabei etwas gebrochen und lag nun schmerzvoll verrenkt auf dem Kellerboden? «Ist da wer?», rief sie laut und öffnete die Tür so weit, wie es ging.
Stille.
«Hallo?»
Nichts.
«Lass uns Verstärkung holen», empfahl Maggie, die ansonsten nicht zur Ängstlichkeit neigte. «Nicht, dass die komische Alte am Ende dort unten ist.»
«Wer sollte uns helfen?», erwiderte Lena und warf einen prüfenden Blick in die Umgebung.
Sämtliche Wachleute waren verschwunden, und auch Soldaten waren weit und breit keine zu sehen. Wahrscheinlich waren alle unten am Fluss und beteiligten sich an der Suche. Wieder ein Aufschluchzen. Kaum hörbar, und doch war es da. Lena fasste einen Entschluss.
«Bleib hier bei der Tür», sagte sie zu Maggie. «Und wenn ich nicht gleich wieder da bin, läufst du zum Haupthaus und holst Hilfe.»
«Nicht!», rief Maggie und versuchte sie am Arm festzuhalten.
Doch Lena war schon entwischt und befand sich auf halbem Weg in den Keller. Ihre Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dämmerung, und so stieß sie einen Laut jähen Entsetzens aus, als sie im Vorraum des Weinkellers angekommen war und ein riesiger Mann vor ihr stand. Erst beim zweiten Hinsehen erkannte sie, dass er ihr wohl eher unbeabsichtigt seine stramme, nackte Kehrseite entgegenstreckte. Rechts und links neben den Hüften des Mannes ragte ein Paar nackte Füße empor, deren Fußsohlen um einiges weißer waren als die mageren Beine, die zu den Füßen gehörten.
Der unzweifelhaft weiße Kerl, der die schmalen Schenkel eines sehr jungen Mädchens wie in einem Zangengriff gepackt hielt, ließ sich von Lenas Aufschrei kaum beirren. Als er sich mehr widerwillig zu ihr umdrehte, blickte sie in das tumbe Gesicht von Trevor Hanson. Für einen Moment war Lena nicht sicher, ob der überraschte Ausdruck in seinen kleinen Schweinsaugen Belustigung oder Wut über ihr unvermitteltes Erscheinen ausdrückte.
«Hauen Sie ab, Missus», grunzte er lahm. «Dies ist bestimmt kein Anblick für eine weiße Lady, erst recht nicht für eine Braut, die noch ihre Hochzeitsnacht vor sich hat.»
«Trevor! Was in Gottes Namen tun Sie da?»
Lena hatte einen Augenblick benötigt, um ihre Fassung wiederzugewinnen. Und obwohl sie der Anblick des kopulierenden Paares verstörte, nahm sie allen Mut zusammen, um sich genauer anzuschauen, welche ihrer Sklavinnen so unverfroren war, es mit dem Oberaufseher von Redfield Hall im Weinkeller zu treiben.
«Nach was sieht es denn aus?», grunzte Hanson. «Gehen Sie endlich und gönnen Sie mir meinen Spaß!»
«Spaß?»
Lena straffte entschlossen ihren Rücken und machte im Halbdunkel des Kellers ein paar Schritte um Trevor herum. Als sie das völlig verheulte Gesicht der erst vierzehnjährigen Larcy erblickte, hatte sie genug gesehen, um zu wissen, dass hier allenfalls einer seinen Spaß hatte. Larcys weit aufgerissene Brombeeraugen flehten sie regelrecht an, dem ungnädigen Treiben Einhalt zu gebieten. Wie im Reflex schnappte Lena sich einen herumstehenden Besen und erhob ihn drohend gegen den ersten Aufseher der Plantage.
«Lassen Sie sofort von dem Mädchen ab, oder ich werde Sie an meinem Hochzeitstag in Gegenwart meines Gemahls und des Gouverneurs von Jamaika höchstpersönlich zur Verantwortung ziehen!»
Als Trevor nicht gleich reagierte, erhob sie den Besen aufs Neue und stieß ihm die Kehrseite in den Rücken, als ob sie einen Löwen bändigen wollte.
«Ist das klar, Mr. Hanson?!»
«Lena?» Maggies Stimme erscholl ängstlich vom Treppenabsatz herab. Offensichtlich war sie ihr bis zur Hälfte gefolgt. «Alles in Ordnung da unten?»
«Nein, leider nicht, Maggie. Hol sofort Lord William und sag ihm, dass ich hier seine Hilfe benötige!»
«Ist es die Frau? Hast du sie erwischt? Warte, ich komme runter und helfe dir!»
«Nein, Maggie», schrie Lena zurück. «Tu einfach, was ich dir sage, und hol den Lord!»
«In Ordnung!», rief Maggie, und ihre eiligen Schritte entfernten sich.
«Schon gut, schon gut, Mylady», lenkte Trevor unvermittelt ein und hob entwaffnend seine Hände.
Dann trat er zurück und Lena entging nicht, wie er sein riesiges, halbsteifes Glied offenbar ohne Scham aus dem bibbernden Mädchen herauszog. «Verschwinden Sie bloß», fauchte Lena, die nicht weniger als Larcy zitterte und den Besen erst sinken ließ, als Hanson sich die Hose gegürtet hatte und den Weg nach oben antrat.
Als der Tyrann endlich aus ihrem Blickwinkel verschwunden war, half sie Larcy von dem Weinfass herunter. Dem Mädchen lief das Blut die Schenkel hinab, ein Zeichen dafür, dass Hanson ihr nicht nur die Jungfräulichkeit genommen hatte, sondern auch mit brutaler Gewalt vorgegangen war. Als Lena sie schützend in ihre Arme zog, in dem vergeblichen Bemühen, sie zu trösten, begann die Sklavin erneut zu schluchzen.
«Bitte, Missus», bettelte sie weinend, «sagen Sie nichts dem Massa. Bitte. Niemand darf etwas davon erfahren. Ich flehe Sie an!»
«Mach dir keine Sorgen, Larcy, ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass dein Peiniger seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Dir wird kein Leid mehr geschehen.»
Edward hatte mit den anderen sämtliche Hütten durchkämmt, aber nichts Verdächtiges finden können. Dabei war er auf Yolanda gestoßen, eine Sklavin in seinem Alter, die erst kürzlich ein Kind geboren hatte, das ihren Behauptungen nach sein eigenes war. Als er im Hochzeitsfrack vor ihr stand und sie nach der entflohenen Attentäterin zu fragen begann, war sie in Tränen ausgebrochen. Allerdings trieben die junge Mulattin ganz andere Sorgen um als ihn selbst.
«Du wirst sie doch nicht lieben, auch wenn du nun mit ihr verheiratet bist und sie besteigen musst, oder?» Mit einem waidwunden Blick klammerte sie sich an das Revers seines Fracks, was ihm mehr als lästig erschien. «Ich bin deine einzige Frau, das hast du immer gesagt!»
«Yolanda, so sei doch vernünftig», beschwichtigte er sie. «Sie ist die neue Herrin von Redfield Hall. Ich werde ihr ein Kind zeugen oder auch zwei. Sei gewiss, dass ich trotzdem weiter zu dir komme.» Edward kniff ihr in den üppigen Hintern. «Allerdings solltest du nie vergessen, dass du nur eine Sklavin bist. Sollte ich jemals erfahren, dass du höhere Ansprüche stellst, werde ich dich und deine Kinder verkaufen müssen. Hast du das verstanden?»
Sie nickte willfährig und fiel vor ihm auf die Knie.
«Ich tue alles, was du verlangst, Master Edward.»
«Dir bleibt ohnehin nichts anderes übrig», erwiderte er grinsend und war schon nach draußen verschwunden.
Lord William hatte sich bereits umgezogen, als Edward in die Festhalle zurückkehrte.
«Habt ihr die Hexe gefunden?», fragte er wütend.
Edward schüttelte missmutig den Kopf.
«Captain Peacemaker und seine Leute haben jenseits des Flusses die Verfolgung aufgenommen.»
«Wenn ich es nicht besser wüsste», raunte William ihm zu, «würde ich schwören, dass es Baba war, die von den Toten auferstanden ist.»
«Red keinen Unsinn», zischte Edward. «Baba ist tot, und an einen solchen Geisterquatsch glaube ich nicht. Das war jemand, der die Geschichte kennt und uns einen Schreck einjagen wollte. Wo ist eigentlich meine Frau?», fragte Edward, als Lady Elisabeth unvermittelt näher trat.
«Keine Ahnung», sagte sie nur. «Eben war sie noch da.» Dann fasste sie ihn am Arm und schaute ihm verbindlich in die Augen. «Du solltest ihr die Wahrheit sagen.»
«Welche Wahrheit denn?», zischte Edward ungehalten. «Ich habe mit den Machenschaften meines Vaters nichts mehr zu tun. Das ist ein alter Hut, über den niemand mehr spricht.»
«Edward, es ist kein Zufall, dass du dir eine Frau in Europa aussuchen musstest», beschwor ihn seine Tante. «Die Leute hier wissen sehr wohl, was damals geschehen ist. Das siehst du daran, dass seit dem Tod von Hetty MacMelvin kein Plantagenbesitzer auf Jamaika bereit war, dir die Hand seiner Tochter zu überlassen. Jeder, der hier aufgewachsen ist, weiß, dass diese Sklavin vor zwanzig Jahren eure gesamte Familie verflucht hat. Danach sind drei Frauen und zwei neugeborene Mädchen gestorben. Denkst du, das ist Zufall?»
«Natürlich ist es Zufall», setzte er sich schnaubend zur Wehr. «Überall sterben Frauen im Kindbett, das ist doch nichts Ungewöhnliches.»
«Hetty ist nicht im Kindbett gestorben, sie wurde von einem Sklaven getötet, und das noch vor eurer Hochzeit. Hast du Helena davon erzählt?», fragte die Lady besorgt.
«Wo denkst du hin?», knurrte Edward. «Glaubst du, ich will, dass sie sich vor unseren Sklaven fürchtet?»
«Nach dem heutigen Vorfall wird ganz Jamaika darüber klatschen», wandte die Lady mit einem schicksalsergebenen Lächeln ein. «Dabei wird es sich kaum vermeiden lassen, dass diese Dinge auch Lena zu Ohren kommen. Deshalb solltest du vorbeugen und ihr die Dinge aus deiner Sicht schildern, bevor sie sich von dir abwendet.»
Wenn ich sie aus meiner Sicht schildere, dachte er bei sich, wird sie erst recht davonlaufen.
Doch stattdessen triumphierte er lässig: «Wir sind verheiratet. Du hast doch gehört, dass uns nur noch der Tod scheiden kann.»
«Edward», beschwor sie ihn eindringlich. «Genau darauf läuft dieser vermaledeite Fluch hinaus. Du willst doch nicht, dass sie stirbt, bevor sie dir einen Sohn geboren hat.»
«Warum sollte sie sterben? Nur wegen dieser Frau? Dass ich nicht lache!»
«Hast du eine Ahnung, wer dahintersteckt?» Lady Elisabeth hob eine Braue.
«Nein.» Edward schüttelte missmutig den Kopf und blickte auf seinen Vater, der in einiger Entfernung in einer hitzigen Unterredung mit dem Gouverneur war.
«Die verschwundene Sklavin von damals kann es schlecht sein», sinnierte er laut. «Das ist ja schon alles viel zu lange her.»
Er wollte Elisabeth von weitergehenden Überlegungen abhalten. Sein Vater hatte die Geschichte mit der verschwundenen Sklavin sogar Edwards Mutter glaubwürdig aufgetischt. Angeblich war die Schwarze trotz ihrer schweren Verletzungen bei Nacht und Nebel davongelaufen. Außer Lord William wusste nur Trevor, wie die Dinge wahrhaftig gelaufen waren. Edward hatte die Geschichte später von seinem Vater erfahren.
Mit versteinerter Miene ließ Lord William sich einen großen Schluck Brandy aus einem silbernen Becher reichen, um den Ärger über die verdorbene Hochzeitsfeier hinunterzuspülen. Vorsorglich befahl er einem seiner schwarzen Diener vorzukosten. Nachdem der Neger nicht umfiel, atmete Lord William auf und hob den Becher.
«Ab sofort will ich, dass sämtliche Speisen und Getränke vor meinen Augen gekostet werden», wandte er sich mit hysterischem Blick an Jeremia, der als Hausbutler den anderen Dienern vorstand.
«Haben Sie Angst, dass Sie jemand vergiften will?»
Der Gouverneur trat hinzu und warf seiner Frau einen bedeutungsschwangeren Blick zu.
«Diese verrückten Neger kommen ja anscheinend auf alle möglichen Ideen, wenn ihre Phantasie erst einmal entfesselt ist», antwortete William aufgebracht.
«Haben Sie bereits eine Ahnung, wer sich hinter diesem schaurigen Spuk verbirgt?» Der Gouverneur schaute ihn fragend an.
«Eine Ahnung schon, aber keine Erklärung, und es wäre mir recht, wenn wir es einstweilen dabei belassen würden.»
Plötzlich huschte Maggie in den Festsaal und zupfte Edward am Ärmel.
«Sie müssen sofort zum Weinlager kommen! Lena hat aller Wahrscheinlichkeit nach die gesuchte Frau gefunden. Sie hält sie unten im Keller in Schach!»
«Was …?»
Edward war ebenso schnell auf dem Weg wie die übrigen Männer, die bei Lord William geblieben waren. Sogar der alte Lord persönlich ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit dem Gouverneur Lenas Gesellschafterin zu folgen. Gemeinsam rannten sie im Laufschritt nach draußen und dann den Kiesweg zum Weinkeller hinunter.
Sie entdeckten Lena schließlich auf der kleinen, weißen Holzbank zusammen mit einer Frau. Seltsamerweise kauerte die Schwarze sich an Lenas Schulter. Erleichtert stellte Edward fest, dass seine frisch angetraute Braut sich augenscheinlich bester Gesundheit erfreute. Dass sie die Übeltäterin offenbar ganz allein überwältigt hatte, ließ seine Brust vor Stolz schwellen. Allerdings erschien ihm die schmächtige schwarze Gestalt, die Lena beinahe schützend umarmt hielt, erheblich kleiner als die geflüchtete Attentäterin.
«Larcy?», entfuhr es ihm ungläubig, als er das Negermädchen erkannte. «Ist sie etwa die Schuldige?»
«Unsinn», konstatierte Lena verärgert. «Nicht sie ist die Schuldige, sondern Trevor Hanson!»
«Trevor Hanson?»
Edward verstand überhaupt nichts mehr. Was hatte Trevor mit dem Auftritt der Hexe zu tun? Wenn man einmal davon absah, dass er ohnehin noch ein Hühnchen mit seinem Aufseher zu rupfen hatte, weil er das Gelände um das Haupthaus nicht gut genug im Auge behalten und sich auch nicht an der Suche nach der geflohenen Frau beteiligt hatte. Was die Frage aufwarf, wo er überhaupt steckte.
«Er hat ihr Gewalt angetan», erwiderte Lena zornig.
Nun konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Männer wieder auf die junge Sklavin. Dabei konnte niemandem das Blut entgehen, das an ihren dürren Beinen hinuntersickerte. Mit betretener Miene zogen sich die meisten Schaulustigen zurück. Die Vergewaltigung einer Sklavin, so häufig es auch vorkam, war nichts, was man gerne an die große Glocke hing.
Lord William war die Angelegenheit nach all dem vorangegangenen Trubel offenbar mehr als peinlich. Er nahm den Gouverneur bei der Schulter und führte ihn, zusammen mit drei anderen Honoratioren, schnellen Schrittes zurück zum Haus.
«Hanson ist ein verdammtes Schwein», entfuhr es Lena wenig damenhaft. «Ich bestehe darauf, dass du ihn sofort entlässt», forderte sie Edward unmissverständlich auf. «Ich kann nicht in Gegenwart eines Mannes leben, der ein solches Verbrechen begeht. Wie sollte man sich als Frau da noch sicher fühlen?»
Edward war es unangenehm, mit Lena vor Zeugen zu streiten, besonders, wenn es Bedienstete waren.
«Nun beruhige dich doch», empfahl er ihr und vollführte mit seinen Händen eine beschwichtigende Geste. Er war versucht, den Arm um Lena zu legen, als diese aufstand, um Larcy gemeinsam mit Maggie zum Haus zu bringen.
«Miss Blumenroth, gehen Sie bitte mit dem Mädchen schon vor und sagen Sie Estrelle, sie soll sich um Larcy kümmern.»
«Sehr wohl, Sir.» Maggie fasste Larcy beim Arm, um sie Richtung Herrenhaus zu dirigieren.
Lena wollte offenbar protestieren, doch Maggie nickte ihr zu.
«Ich erledige das schon. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn Larcy sich ein wenig hinlegen kann.»
«Wie kommt es überhaupt, dass du die beiden entdeckt hast?», fragte Edward lahm, nachdem Maggie und die Sklavin sich auf den Weg gemacht hatten.
Im Stillen ärgerte er sich mehr darüber, dass Trevor nicht bei der Jagd nach der Hexe teilgenommen hatte, als dass er sich an Larcy vergangen hatte. Die Aufseher auf der Plantage besaßen alle Freiheiten, wenn es darum ging, sich eine Sklavin zu nehmen. Immerhin sorgten sie damit für zuverlässigen Nachwuchs unter den Negern. Eine Aufgabe, der die rein afrikanischen Sklaven immer weniger nachkamen.
«Als ob das jetzt noch eine Rolle spielen würde», erklärte Lena wütend. «Was soll denn bitte schön noch alles an unserem Hochzeitstag geschehen? Eine Frau, die meinem Schwiegervater einen toten Hahn an den Kopf schleudert … Ein brutaler Aufseher, der seine Pflichten vernachlässigt und anstelle dessen unsere jüngste Bedienstete vergewaltigt? Und was kommt als Nächstes?!»
Edward schüttelte unwillig den Kopf.
«Vielleicht hat Larcy Trevor ja schöne Augen gemacht», fuhr er ungerührt fort. «So was soll vorkommen.»
«Ich glaube, ich habe mich verhört.» Lena blieb stehen und stemmte die Hände in ihre schmalen Hüften. «Wie kannst du nur auf eine solch unmögliche Idee kommen? Er ist alt, sie ist jung. Er ist weiß, sie ist schwarz, und sie sind nicht verheiratet!»
Edward straffte sich und baute sich vor seiner aufgebrachten Frau zu voller Größe auf, was sie ein wenig einzuschüchtern schien.
«Weil ich diese kleinen schwarzen Schlampen zur Genüge kenne», verteidigte er sich. «Sie alle legen es nur darauf an, einen weißen Mann zu verführen, weil sie wissen, dass sie davon profitieren können.»
Lena hielt seinem strengen Blick stand.
«Das meinst du nicht im Ernst?» Ihre grünen Augen blitzten gefährlich, doch Edward ließ sich davon nicht beeindrucken.
«Ich lebe seit dreißig Jahren auf dieser Insel und bin mir sicher, dass ich die Bewohner und ihr Verhalten weit besser beurteilen kann, als du es je könntest. Und wenn ich sage, dass es die Sklavinnen üblicherweise auf ihre weißen Herrn abgesehen haben, kannst du mir das ruhig glauben.»
«Oho, muss ich mir Sorgen machen?» Eine gehörige Portion Ironie lag in ihrer Stimme. «Und aus Freude, dass ihr Werben von den weißen Herren erhört wurde, läuft den Negerinnen das Blut an den Beinen herab, und sie heulen sich die Seele aus dem Leib?»
«Lena! Das verstehst du nicht!»
Er machte einen Schritt auf sie zu, um sie in seine Arme zu ziehen, doch sie wich ihm aus.
«Ich verstehe genug, um zu wissen, dass wir aus zwei völlig verschiedenen Welten stammen und die deine mir zusehends unsympathischer wird. Ich will, dass du Trevor Hanson entlässt, sonst …»
«Sonst was?»
Mit wildem Blick schaute sie ihm direkt in die Augen.
«… will ich nicht länger deine Frau sein. Jawohl! Ich werde mich dir nicht eher hingeben, bis du zur Vernunft gekommen bist.»
Edward brach in schallendes Gelächter aus, und es dauerte einen Moment, bevor er sich beruhigt hatte.
«Meine liebste Helena», stieß er nach einer Weile immer noch amüsiert hervor, «wenn du mir deinen süßen Leib aus welchen Gründen auch immer missgönnst, hole ich mir eben eine von meinen Sklavinnen. Wie ich schon sagte, sie lechzen nur so danach, bei mir liegen zu dürfen.»
«Gut, dass wir das geklärt haben», erwiderte Lena empört und marschierte außer sich vor Zorn mit hocherhobenem Haupte davon.
Einen Moment lang überlegte Edward, ob er nicht zu weit gegangen war und ihr lieber folgen sollte. Aber um sie für sich zurückzugewinnen, hätte er auf ihre Bitte, Trevor umgehend zu entlassen, eingehen müssen. Und das wollte und konnte er nicht.
«Verdammte Hexe», zischte er leise und schaute ihr nach, bis sie im Haupthaus verschwunden war.
In Begleitung ihres Vaters hatte Lena sich weitaus demütiger gegeben. Aber dass sie in Wahrheit ein kleines Biest war, hatte er schon in Almack’s Keller geahnt, wo sie sich ihm bereits bei ihrer ersten Begegnung beinahe hingegeben hatte. Dieses Temperament war es allerdings auch gewesen, das ihn gereizt hatte. Und nun war es plötzlich eine lästige Nebenerscheinung. Er würde auf Knien rutschend bitten müssen, bevor sie ihn freiwillig an sich heranließ. Doch für heute Nacht war es zu spät. Dabei hatte ihn allein ihr Anblick in dem sündig geschnittenen Brautkleid scharfgemacht, als sich ihre wunderbaren, kleinen Brüste vor Entrüstung hoben und senkten.
Ein Hornsignal riss ihn jäh aus seinen lüsternen Gedanken. Anscheinend war Captain Peacemaker mit seinen Männern von der Verfolgungsjagd zurückgekehrt. Edward vergaß für einen Moment den Streit mit seiner frisch angetrauten Ehefrau. Ungeduldig wandte er sich dem Park zu. Er wollte wissen, ob der Captain und seine Soldaten die Alte erwischt hatten.