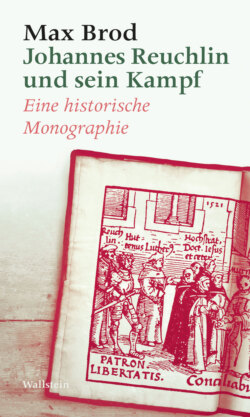Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеIn gewissem Sinne war die Antike während des ganzen Mittelalters oder doch in bedeutenden Zeitabschnitten dieser Epoche präsent geblieben. In Klöstern wurden alte Handschriften sorgfältig kopiert, auch Catull und Ovid, und auf diese Art behielten die klassischen, gar nicht prüden Autoren ihr Leben; lateinisch ist die Sprache des deutschen Heldengedichts vom tapferen Waltharius, das in St. Gallen entstand; Dramen des in lateinischer Sprache schreibenden Puniers Terentius dienten als Vorlagen für Klosterdramen (nach Märtyrergeschichten) der Nonne Hroswita. Der Trojanische Krieg bildete in mannigfachen Umdichtungen (von Chryseis bis Cressida) den Hintergrund vielverbreiteter Ritterromane. Ähnlich die Äneis und der Alexanderzug. Und wer seinen Aristoteles nicht im kleinen Finger hat, dem fehlt einfach der Schlüssel für die subtilen und sehr viel Wesentliches ausdrückenden Geisteskämpfe der Scholastiker. – Dennoch läßt sich erst in der Renaissance und schon in den Ansätzen zu ihr etwas ganz Neues vernehmen: der erst zaghaft, dann immer vordringlicher sich durchsetzende Gedanke, den man mit den Schlagworten ›die Antike als Rettung‹ bezeichnen könnte, am handgreiflichsten zur Wirklichkeit gerinnend in dem tollkühnen Versuch des ›Volkstribunen‹ Cola di Rienzo, die altrömische Republik im 14. Jahrhundert fast 900 Jahre nach ihrem Untergang noch einmal aufleben zu lassen. Petrarca begrüßte diese antihistorische Verzückung und gab um ihretwillen die Freundschaft des mächtigen römischen Adels (Giovanni Colonna) auf.
Dazu ein anderes: der mittelalterlich malträtierte Aristoteles wird in der Humanistenzeit nicht nur durch den originalen ersetzt, er wird überdies (zumindest in wichtigen Zentren) durch den neu zu verdienten Ehren kommenden Platon und die Neu-Platoniker verdrängt. Der griechische Gelehrte Georgios Gemistos nahm nicht grundlos den an Platon und an die ›Plethora‹, die Gottespräsenz der Neuplatoniker, erinnernden Namen Plethon an; beim Konzil in Florenz, das der Vereinigung der römischen und der Ostkirche gewidmet war, wenige Jahre vor dem Fall des oströmischen Reiches, warb er für die platonische und neuplatonische Philosophie, bekämpfte den Aristotelismus. Unter seinem Einfluß schrieb der Kardinal Bessarion, sein Schüler. Und Cosmus von Medici gründete die ›Platonische Akademie‹. In Florenz wirkten seither Marsilius Ficinus und Pico von Mirandola, der, von Elia Delmedigo im Hebräischen unterrichtet, die Kabbala in den Kreis seiner Interessen miteinbezog. Damit aber langte der Einfluß dieses Kreises bis zu Reuchlin hinüber. – Plethon selbst wollte (wie ein neuerer Forscher darstellt) »gegenüber dem mittelalterlichen abendländischen Christentum den Hellenismus als einen universalen Theismus entwickeln und zur Grundlage einer durchgreifenden Reform, einer wahrhaft humanen und ungebrochenen Daseinsgestaltung erheben. In diesem Sinne wird ihm die neuplatonische Ideenlehre zugleich zu dem Hilfsmittel, die hellenische Götterwelt wieder zu verlebendigen«.
Kaiser Julian Apostata war also wieder auferstanden? – Nicht viele gingen so weit wie Plethon. Aber allen gemeinsam war die Richtung, der sie sich zuwandten: gegen die totalitäre Denk-Versklavung durch die mittelalterliche Kirche. Und viele lugten dabei in irgendeiner Form nach der ›Rettung durch die Antike‹ aus. Wobei allerdings der Rahmen des (von Mißbräuchen gereinigten) Christentums mehr oder weniger entschieden beibehalten wurde. Besonders gerade bei Reuchlin, ferner bei Pico della Mirandola, der in der letzten Zeit seines sehr kurzen Lebens unter den Einfluß Savonarolas geriet und der schon vordem (vergebens) nachweisen wollte, daß zwischen Platon und Aristoteles eigentlich Übereinstimmung herrsche. – Die Antike, an der sich die Zeit umorientierte, blieb also in vielen Punkten kirchlich oder zumindest im Sinne einer freien christlichen Kirche beeinflußt. Sehr stark ist das bei Erasmus zu merken, es entsprach seiner immer vermittelnwollenden Art. Doch mit so zarten Fingern konnte das Problem nicht von vielen angefaßt werden. Und »dirumpamus vincula eorum et projiciamus a nobis jugum eorum« (»durchbrechen wir die Fesseln jener [Feinde] und werfen wir ihr Joch von uns ab«) ist nach dem fehlgedeuteten 2. Psalm die Umschrift um das Porträt Ulrich von Huttens vor einer seiner Schriften, die den unmißverständlichen Titel trägt: ›Klage und Vermahnung gegen die übermäßig unchristliche Gewalt des Bapsts zu Rom und der ungeistlichen Geistlichen durch Herren Ulrichen von Hutten, Poeten und Orator der ganzen Christenheit und zuvoran dem Vaterland teutscher Nation zu Nutz und Gut, von wegen gemeiner Beschwernis und auch seiner eigen Notdurft in Reimens Weise beschrieben. Jacta est alea. Ich habs gewagt.‹ – Wie aufrichtig ist dieser in manchen andern Punkten, z. B. in seinem nationalen Chauvinismus weniger sympathische, immer aber höchst ehrliche Ritter, wie vielen Skribenten heute und je könnte er als ein Muster von Ehrlichkeit darin gelten, daß er seine eigene Interessiertheit (›Notdurft‹) an der Sache nicht verschweigt, obwohl ihm das Gemeinnützige gewiß wesentlich wichtiger war. Heute macht man das meist umgekehrt.