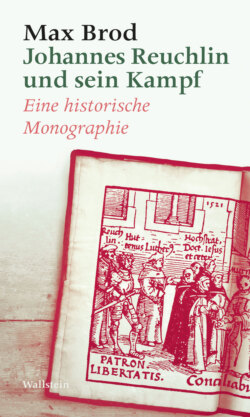Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеIn dem ersten Brief an Reuchlin, den Ludwig Geiger in seiner wichtigen Sammlung ›Johann Reuchlins Briefwechsel‹ uns überliefert hat, ist bereits von Reuchlins Sprachkenntnissen die Rede. Ein ›miraculum trilingue‹ (ein dreisprachiges Wunderwesen – nämlich: mit lateinischem, griechischem, hebräischem Wissen ausgerüstet) wird er später mit einem in vielen Varianten auftretenden Beinamen genannt. Doch das Hebräische liegt vorläufig noch außer Sicht. – Der erwähnte Brief ist aus Basel 1477 datiert. Andronicus Contoblacas lobt den zweiundzwanzigjährigen Jüngling Reuchlin wegen seiner Kenntnisse der griechischen Sprache, mahnt zur Fortsetzung der Studien. Ähnlich lautet der zweite Brief der Sammlung; Georgius Hermonymus hat ihn 1478 ex urbe Parisiorum (aus Paris) an den Lernenden gerichtet. – Bald nachher (Heidelberg 1483) bezeichnet Rudolf Agricola unsern Reuchlin als einen »homo tam multiplicibus disciplinarum literarumque ornamentis expolitus« (einen im Schmuck so mannigfaltiger literarischer Wissenszweige feingebildeten Mann) und gratuliert Deutschland, daß es sich dank Reuchlin aus der Barbarei erhebt, durch die es so viele Jahrhunderte lang wie von einem stupiden Schlaf oder vielmehr von einer Art Lethargie erdrückt worden ist. –
Reuchlins Bildungsgang hatte in der Pforzheimer Lateinschule begonnen, in derselben, die später für kurze Zeit auch seinen Verwandten Philipp Melanchthon heranbilden half (Melanchthons Großmutter war Reuchlins Schwester Elisabeth Reuther). Als Fünfzehnjähriger bezog Reuchlin die junge Universität Freiburg im Breisgau und studierte zuerst an der ›Artistenfakultät‹, deren Unterstufe etwa unserem Obergymnasium entsprach und die Vorbedingungen (Philosophie, Grammatik, Rhetorik) zu späteren Spezialstudien schaffen sollte. Reuchlin, der seiner guten Singstimme wegen im Chor der Hofkirche mitsang und dabei die Beachtung des badischen Markgrafen auf sich gezogen haben soll, vielleicht auch zur Mitwirkung bei musikalischen Aufführungen am Hof in Anspruch genommen wurde, ging 1473 als Begleiter des Markgrafensohns an die berühmte Pariser Universität. Der erste Schritt in die große Welt.
Paris. Die Buchmesse der mittelalterlichen Wissenschaft. Die älteste Universität mit vier Fakultäten, also für lange Jahrhunderte das Vorbild einer kompletten Universität. Das studium Parisiense umfaßte Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin und die Artistenfakultät, letztere mit den ›sieben freien Künsten‹ d. h. mit ihrem Dreiweg (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und dem Vierweg (Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie). – Der Pariser Universität war die Ausbildung einzelner Fakultäten im Italien des 11. Jahrhunderts vorausgegangen; so die Rechtsschulen in Bologna und Padua, die medizinische Schule in Salerno. – Die Universitäten standen unter päpstlicher Schutzherrschaft, hatten ihren eigenen klerikalen Gerichtsstand, es bildete sich so etwas wie ein päpstlicher oder klerikaler Kolonialismus, ein ultramontaner Machtbereich mitten in Europa heraus. Übrigens nicht unwidersprochen. Gerade die Pariser Universität stellte sich im 13. Jahrhundert in den Dienst der französischen Könige, nahm Partei gegen den Papst. – Auch sonst war das Leben an den Universitäten voll von kämpferischer Bewegung. Als erste deutsche Hochschule scheint die in Prag auf, 1348 vom Luxemburger Karl IV. gegründet, also französisch beeinflußt. Die Studenten zankten sich in ihren ›Nationen‹, die einander befehdeten. Zu den politischen Mißhelligkeiten, die öfters zum Auszug eines Teils der Studentenschaft und Neugründung neuer Universitäten führten (Gründung der Leipziger Universität von Prag aus, zur Zeit von Johannes Hus), kamen die Zusammenstöße auf theologischem und philosophischem Gebiet. Die Orden der Dominikaner und Franziskaner lagen in Fehde miteinander. Diskussionen und Disputationen hörten nicht auf. Die heute so oft als ›starr‹ verschriene Scholastik (gerade zu Reuchlins Zeit begann man sie zu beschimpfen) hatte ihre feurigen schöpferischen Epochen, deren Bedeutung heute noch der Wiederentdeckung harrt. Im 14. Jahrhundert trat ein großer denkerischer Revolutionär im Mönchhabit der Franziskaner auf: Wilhelm von Ockham. Er erneuerte den schon halbvergessenen ›Nominalismus‹, stürzte alles um, was man als gesicherte Erkenntnis des Thomas Aquinus und des Duns Scotus, der berühmten ›Realisten‹ angesehen hatte. ›Venerabilis inceptor‹ hieß Ockham bei seinen Schülern, der verehrungswürdige Neubeginner. Er muß von einer geradezu übermenschlichen Energie gewesen sein. Eine Anzahl seiner Sätze wurde für häretisch erklärt, vier Jahre saß er zu Avignon in Untersuchungshaft. Er wandte sich an Kaiser Ludwig den Bayer, wurde exkommuniziert, floh nach München. Berühmt sein Wort an den Kaiser, gegen den Papst: »Tu me defendas gladio, ego te defendam calamo«. (Du wirst mich mit dem Schwert verteidigen, ich dich mit der Feder.)
150 Jahre lang blieb nach seinem Ende die Universität Paris der Hauptsitz des Ockhamismus. Die Naturwissenschaft blühte auf. Nicolaus von Oresme, Bischof von Lisieux, entwickelte lange vor Kopernikus die Lehre von der täglichen Bewegung der Erde und von der Unbewegtheit des Himmels; er hat lange vor Descartes das Koordinatensystem erdacht und ist somit der eigentliche Erfinder der analytischen Geometrie; er hat lange vor Galilei das Fallgesetz formuliert. Welch ein Genie, fast von der gesamten Menschheit in die Wüste der Vergessenheit geschickt! Ganz ebenso, wie der heutige Marxismus und Materialismus, so weit ich es überblicken kann, noch nicht die Wege zum Nominalismus des Franziskaners Ockham gesucht und gefunden hat. Er würde damit auch den Weg zu mancher behutsamen Korrektur an seiner Kernlehre antreten.
Der Kampf zwischen Realismus und Nominalismus muß hier deshalb zumindest in knappem Umriß charakterisiert werden, weil er zu Reuchlins Studienzeit noch nachzitterte und, wie bisher nicht genügend beachtet worden ist, auch während des weiteren Lebens des großen Humanisten, vor allem in seinen philosophisch-theologischen (kabbalistischen) Büchern weiterhin Wellen schlägt. Nicht nur die Problematik Ockhams, auch seine kühne unabhängige Gesinnung, taucht bei Reuchlin neu auf. An das oft zitierte Wort Reuchlins über die Wahrheit, die er höher stellt als die Autorität des von ihm verehrten Hieronymus und Nikolaus von Lyra, erinnern folgende Sätze in Ockhams ›Dialogus inter magistrum et discipulum‹, Sätze, in denen er gegen die Verurteilung einiger seiner Thesen durch den Erzbischof Robert Kilwardly (Oxford 1277) protestiert: »Behauptungen vornehmlich physikalischer Art, die sich nicht auf theologische Sätze beziehen, dürfen von niemandem feierlich verdammt oder verboten werden, da es in solchen (wissenschaftlichen) Behauptungen jedermann freistehen muß, frei zu sagen, was er für richtig hält. Da mithin der genannte Erzbischof grammatikalische, logische und rein physikalische Sätze verdammt hat, muß sein Richtspruch als unüberlegt (tollkühn, sententia temeraria) zurückgewiesen werden.« – Ganz ähnlich hat Reuchlin sein philologisches und juridisches Wissensgebiet gegen die Kölner ›Theologisten‹ hartnäckig verteidigt.
Die Streitsache: Realismus contra Naturalismus geht auf die Ideenlehre Platons und (abgeschwächt) auf den Begriff der ›Formen‹, der gestaltenden Prinzipien bei Aristoteles zurück. Wobei der Name ›Realismus‹ ungefähr das Gegenteil von dem bedeutet, was man heute unter ihm (z. B. in der Theorie des einigermaßen schablonenhaften ›sozialistischen Realismus‹) versteht. Dem Realisten waren die allgemeinen Wesenheiten, die Ideen als schöpferische Potenzen die wahren wirkenden Kräfte des Weltalls. Man konnte sich ihnen nur in Liebe, in Ekstase nahen, sich mit ihnen (das heißt: mit dem göttlichen Schöpfer) konfrontieren oder gar verbinden. Wie es Leisegang in seinem grundlegenden Buch ›Die Gnosis‹ am speziellen Beispiel der Mystik aufweist: »Nicht wissenschaftlicher Forschungseifer, sondern die Sehnsucht, sich verbunden zu fühlen mit den tiefsten und klarsten Lebensgründen ist es, die zur Ideenschau drängt.« Wozu aber zu bemerken ist, daß bei Platon selbst, dem Urmeister, dem Moses Atticus, dem Moyses Attikizon (wie ihn der Neupythagoräer Numenius und nach ihm Clemens von Alexandria nennt), der wissenschaftliche Erkenntnisdrang gleichfalls in die ungeheure Bewegung der Liebe, als Eros paideutikos, mitaufgenommen ist und als Mathematik sogar an erster Stelle steht. »Keiner, der nicht geometrisch gebildet ist, trete hier ein« hat Platon an das Tor seiner Lehrstätte geschrieben. Gegenüber den Ideen, den allgemeinen Wesenheiten, die nicht etwa kahle abstrakte Begriffe sind, treten die Einzeldinge zurück. Letztere werden (in einer falschen Interpretation der platonischen Lehre, wie ich in meinem Buch ›Diesseits und Jenseits‹ gezeigt habe) zu wesenlosen Schatten. Die Allgemeinheiten (universitates) sind, zeitlich wie auch kausal ›ante rem‹ (vor den Einzeldingen). Diese Ansicht, die überdies in zwei sehr verschiedenen Spielarten auftrat, in der durch Maß und vernünftige Klarheit ausgezeichneten Lehre des Dominikaners Thomas von Aquino und in der emotional bewegten des Franziskaners Duns Scotus, bildete zur Zeit, in der Reuchlin und später Erasmus den Hauptplatz des großen Streites, die Pariser Universität, betraten, eine geschlossene Front: die via antiqua. Ihr entgegengesetzt beanspruchte der Nominalismus, als via moderna, sein Recht. Ihm waren die Einzeldinge, die naturwissenschaftlichen Sichtweisen, wichtiger als die Ideen, die bei den Anhängern Ockhams als abgeleitete Begriffe, als zweitrangig galten; universitates post rem. Die neu aufkommende Humanistenbewegung stand der via moderna näher, jedenfalls distanzierte sie sich energisch von der via antiqua. Für den oberflächlich schönrednerischen Erasmus wurde ›Scotist‹ zum Schimpfwort. Reuchlin blieb bei all seinen humanistischen Grundanschauungen doch im Tiefsten mit mannigfachen Fäden an die ältere Ideenschau, den Idealismus, der sich Realismus nannte, geknüpft. – Eine dritte, vermittelnde Richtung, die vom Realismus wie vom Nominalismus (dem die allgemeinen Wesenheiten bloße ›Namen‹ d. h. Begriffe oder gar nur Worte waren) gleich weit entfernt war, zeigte sich in Ansätzen, konnte sich aber nicht voll entwickeln. Gerade ihr, diesen ›universitates in re‹, habe ich meine Platondeutung in ›Diesseits und Jenseits‹ gewidmet. Nach meiner Meinung ist die platonische Idee durch die Vereinigung der Gegensätze ausgezeichnet, sie verbindet das Umfassende, Ewige mit dem Vorbeifliegenden, der vergänglichen Gegenwart. – Treffsicher hat Goethe diese dritte Kategorie mit dem Briefwort an ein einfaches Mädchen erfaßt: »Das Wirkliche ist das eigentlich Ideelle«.
Diesem geheimnisreichen Leitsatz des »erzieherischen Eros« kam Reuchlin in seinen späteren Jahren immer näher. Das Symbol, in dem das Wort oder die Aussage, der Satz gleichsam transparent wird und neben den Einzeldingen, die es darstellt, oder vielmehr in den Lücken zwischen ihnen die ewigen Geheimnisse einer vollkommenen Welt durchschimmern läßt, – das Symbol wird immer mehr zur eigentlichen Philosophie Reuchlins. Nicht etwa die Allegorie, die A sagt und B meint, die den ›Anker‹ nennt und die ›Hoffnung‹ ausdrücken will, – sondern eine völlig andere Darstellungsweise, die A sagt und die das nicht restlos Faßbare mitmeint. Im Sinne Goethes, der konstatiert, daß die Allegorie alles klar ausspricht, was sie meint, während im Symbol das ineffabile (das Unaussagbare) mitenthalten ist. Daher spricht Reuchlin in dem bedeutenden Widmungsbrief an Papst Leo X. (der Vorrede seines Hauptwerks ›De arte cabalistica‹) von einer ›Philosophie in Symbolen‹ (symbolica philosophia), als welche er die Kabbala ansieht und die nach seiner Meinung auch die Grundlage der pythagoräischen Lehre bilden soll.
In Paris wurde sein wichtigster Lehrer Heynlin aus dem Dorfe Stein (daher dessen Humanistenname a Lapide). Der Deutsche Johannes a Lapide war (laut Preisendanz ›Johannes Reuchlin in Leben und Forschung‹ – Reden und Ansprachen im Reuchlinjahr 1955) ein Gelehrter, »der als einer der ersten die veraltende Scholastik und den erstarkenden Humanismus, also die via antiqua und die via moderna friedlich zu vereinen suchte, ohne schließlich so grelle Disharmonien zum Einklang stimmen zu können. Niemals hätte sich, wie er, ein wahrer Humanist ernstlich mit der echt scholastischen Frage abgemüht, ob denn wohl die Toten einst mit Haaren und Nägeln an Fingern und Fußzehen zur Auferstehung kämen.«
Mit diesem Lehrer kam Reuchlin an die Universität Basel (1474 bis 1477), wo der oben genannte Andronicus Contoblacas sich um sein Griechisch kümmerte.
Als Freund in Basel erwirbt er den um zwei Jahre jüngeren Sebastian Brant aus Straßburg, den satirischen Dichter des ›Narrenschiffs‹, das dem Erasmus als Muster dient, als der sein ›Lob der Narrheit‹ verfaßt. Das Schiff, das nach ›Narragonien‹ abgeht und in dem die Narren singen »Gaudeamus omnes« (»Freuen wir uns allesamt!«), soll der Welt zeigen, wie tief sie in die vielen einzelnen Formen der Narrheit versunken ist. »Von schatzfynden«, »von zu vielen sorgen«, »von luchtlich zyrnen«, »von dantzen«, »von bösen wibern«, »von spylern« und ungezählten andern Verirrungen handeln die Kapitel. Brant hat Ironie genug, sich selbst als ›Büchernarren‹ mit in die Menschenfracht aufzunehmen. Auf dem Titelblatt-Holzschnitt heißt es: »zu schyff, zu schyff, bruder; ess gat, ess gat«. – Für Reuchlin, dessen Sinn für Humor und Witz in seinen jungen Jahren (vor dem großen Hebraismus-Streit) außerordentlich entwickelt war, – siehe seine beiden lateinischen Lustspiele – und der eine originelle bildkräftige Sprache wohl zu schätzen wußte, gab Brant den rechten Kumpan ab. Die Studien der beiden entwickeln sich fast parallel. Reuchlin wird 1475 Baccalaureus, 1477 Magister (als solcher darf er auch schon die akademische Lehrtätigkeit als Latein- und Griechischlehrer in Basel beginnen). Brant macht 1477 das Baccalaureat, 1484 das Lizentiat des kanonischen Rechts, 1489 wird er Doktor beider Rechte; bei all dem einer der fruchtbarsten Schriftsteller des Jahrhunderts. Später Syndikus und Stadtschreiber des Straßburger Rats. Reuchlins Komödie ›Scaenica Progymnasmata‹ leitet er im Stil der Zeit mit überschwenglichen Lobesversen auf den dulciloquus, den süßsprechenden Capnion, ein. – Doch sobald die Sache ernst wird, im Kampf mit den Kölnern, verstummt Brant und schlägt sich grämlich in die Büsche.
Basel wurde noch aus einem andern Grund für Reuchlin bedeutsam. Der Buchdrucker Johannes Amorbach (oder Amerbach) bestellte eine riesenhafte Arbeit bei dem armen Studenten; ein lateinisches Wörterbuch, den vocabularius breviloquus. Es war Reuchlins erstes Buch, das allerdings anonym erschien (weshalb es ihm manchmal abgesprochen wird. Aber die Gedenkrede Melanchthons bezeugt ausdrücklich Reuchlins Verfasserschaft). – Merkwürdig, daß gerade dieses Buch ein großer Erfolg wurde. Es wimmelt von etymologisch falschen Ableitungen und stellt überhaupt nur einen Tastversuch seines jungen Autors, einen ersten Vorstoß ins Reich der Wissenschaft dar – so wird beispielsweise das Wort ›uterus‹ als stammverwandt mit ›uti‹ oder mit ›utilitas‹ angesehen. Gerade dieses Buch erreichte eine Verbreitung von 25 Ausgaben. »Es wäre seltsam«, sagt Ludwig Geiger in seiner klassischen Reuchlin-Biographie, »daß Reuchlin bei all den neu erscheinenden Ausgaben keine bessernde Hand angelegt hätte, wenn man sich nicht erinnerte, daß nur die (vier) Ausgaben bis 1482 bei Amorbach aufgelegt, alle späteren Nachdrucke sind. Seit 1504 ist keine neue Ausgabe erschienen; die Zeit war über das Werk hinweggeschritten.« Es handelt sich übrigens nicht um ein bloßes Lexikon, sondern an sehr vielen Stellen eher um eine Art von Realenzyklopädie. Die Worterklärungen wachsen gelegentlich zu richtigen großen Sachartikeln an, dem Titel des Werkes, der »kurze Rede« verheißt, unumwunden widersprechend.
In der ›Bibliographie der Schriften Johannes Reuchlins im 15. und 16. Jahrhundert‹ von Josef Benzing findet man die korrigierende Bemerkung, daß es »nur 22 sichere Ausgaben« des vocabularius gibt. – Kritisch gibt Geiger unter den positiven und negativen Eigenschaften dieses Reuchlinschen Erstlings an, zu bewundern sei die große Belesenheit des jungen Mannes, der nicht etwa bloß auf den Wortschatz der lateinischen Bibel abzielt, sondern es »als seine Aufgabe erkennt, den ganzen durch klassische Schriftsteller und die Quellen der römischen Jurisprudenz wesentlich bereicherten lateinischen Sprachschatz in sich aufzunehmen«. Echt reuchlinisch mutet auch schon die folgende Bemerkung an: »Merke, daß überall wo sich in den Büchern des alten Testaments (bei Geiger einer der häufigen Druckfehler: ›ceteris‹ statt ›veteris‹) ein Irrtum findet, auf die hebräischen Bücher zurückzugreifen ist, da das Original des alten Testaments in hebräischer Sprache geschrieben ist.« – Damals, in jener Baseler Zeit hatte Reuchlin das Studium des Hebräischen noch gar nicht begonnen. Und doch stellt er bereits einen jener Grundsätze auf, an denen er später eisern festgehalten hat und die ihm soviel Gegnerschaft eingebracht haben. Sogar um eine eigentlich so selbstverständliche Regel mußte also gekämpft werden. Rückblickend erzählt Reuchlin später (1518 in einer Widmung an Kardinal Hadrian), daß er es in Basel mit einer Sorte von Menschen zu tun gehabt habe, »deren einziges Streben es Jahrhunderte lang gewesen war, recht barbarisch zu reden«. Die Vorkämpfer der alten Lehrmethode waren den jungen modernen Lehrern (ebenso wie in Paris) feindlich gesinnt. Es galt als verboten, die griechische Sprache zu unterrichten, da ja die Griechen (Oströmer) von der römischen Kirche abgefallen waren! So dachte man damals, zu einer Zeit, da die Hauptstadt des oströmischen Reiches, Byzanz–Konstantinopel, schon seit drei Dezennien von den Türken erobert war und die flüchtigen griechischen Gelehrten, aus dem Ostreich in den Westen gekommen, dort ihre höheren Bildungswerte, die der griechischen Kultur, zu verbreiten begannen; die dann (neben den Fundamenten der nie ganz vergessenen lateinischen Erbschaft) zu einer wesentlichen Vertiefung der humanistischen Anschauungen hinführte.
Der vocabularius ist in lateinischer Sprache verfaßt. Über Reuchlins seltsame, letzten Endes aber doch dem Verhältnis Dantes zur ›Volkssprache‹ entsprechende fortschrittliche, in die Zukunft weisende Haltung zur Verwendung des Deutschen, wird später, bei Gelegenheit des ›Augenspiegels‹ einiges darzulegen sein. Schon hier aber sei der große Skandal beklagt, daß von sämtlichen Werken Reuchlins, den lateinischen wie den deutschen, bis heute, da ich diese Zeilen schreibe (April 1963), kein einziges ins Hochdeutsche übersetzt vorliegt. Das ist um so weniger begreiflich, als von seinem doch nur flacheren Zeitgenossen Erasmus eine große Anzahl von Werken und Briefen in hochdeutschen Ausgaben, einige sogar mehrfach herausgebracht worden sind. – Das Mittelmäßige, Glatte und eigentlich Uninteressante, Unoriginelle erwirbt sich eben manchmal, bei geeigneter Propaganda (nicht immer), leichter und rascher Weltruhm als das tief Gedachte und auf persönlichste Art Erlittene!
In Basel blieb Reuchlin mehr als drei Jahre, ging dann zum zweitenmal nach Frankreich, wo er in Paris bei Georgios Hermonymos (siehe den oben zitierten Brief, den zweiten der Geigerschen Sammlung) die griechische Sprache weiterstudierte. In Paris wurde er mit dem Kanonischen Recht vertraut; anschließend an den Universitäten in Orléans und in Poitiers mit dem römischen Recht. In Orléans soll er zum Eigengebrauch und für Mitstudierende eine griechische Grammatik ›Mikropaideia‹ (etwa: Kleine Belehrung) herausgegeben haben, die ich allerdings bei Benzing nicht verzeichnet finde und die mir auch an einigen Universitäten Süddeutschlands, in denen ich Reuchlins Bücher in ihrem bibliothekarischen Eremitendasein aufgestöbert habe, nicht zu Gesicht gekommen ist. (Nach Geiger existierte das genannte Werk nur handschriftlich.) – 1481 erhielt Reuchlin in Poitiers das Lizentiatendiplom und »die ausdrückliche, den sonstigen Sitten der Universität entgegenstehende Erlaubnis, den Doktortitel zu erwerben, wo es ihm beliebe«. So war er um diese Zeit durch lauter Juristerei seinen philologischen Bestrebungen entfremdet, die später zugleich mit Theologie und Mystik das Zentrum seiner geistigen Wesenheit erfüllen sollten. Das Brotstudium, die Juristerei, hatte ihn geschnappt. Es dünkte ihm, wie es scheint, nicht seinem Charakter gemäß: sich auf Mäzenatentum, Pfründen und die unsicheren Ergebnisse der Schriftstellerei zu verlassen, wie der um zwölf Jahre jüngere Erasmus (der allerdings viel diplomatischer war und mehr Glück hatte als Reuchlin) und die ganze jüngere Humanistengeneration wie Eoban Hesse, Konrad Celtes, Ulrich von Hutten, Crotus Rubeanus u. a. in einer Art von ungemessenem Wanderleben und leichter Bohème-Freiheit es taten. »Laß den väterlichen Herd«, so dichtet (natürlich lateinisch) der Humanist Celtes, »und schaue fremde Gestirne, wenn du himmlische Pfade wandeln willst. Wo du stirbst, ist einerlei; überall führt der gleiche Weg von der Erde in Jupiters Saal.« Der schwerblütige Reuchlin neigte dagegen sein ganzes Leben lang zu festen Bindungen, zu Bestimmtheit, zu Heimat und einem geordneten Leben, ja zu einer Stetigkeit, die an Unbeholfenheit grenzte und sich nur im Notfalle (dann allerdings höchst energisch) zu Bewegung und Veränderung aufraffte, auch dann immer unter der machtvollen Kontrolle seines Gewissens, und zu einer erhabenen Gott-Trunkenheit hinleitend, die seine besten Zeiten erfüllte. – Er hat, wie viele seiner Briefe beweisen, sehr darunter gelitten, daß er dem geschäftigen Leben, dem juristischen und Beamtenberuf unterjocht blieb. Erst im Alter, zehn Jahre vor seinem Tode und mitten im bittersten Ringen mit den Kölnern und mit Pfefferkorn, das alle seine Kräfte in Anspruch nahm, hat er die Berufslast der Rechtswissenschaft abgeworfen, die er so lange getragen hat. – Gauguin hatte sein Indonesien gefunden. Im Falle Reuchlins hieß es: De arte cabalistica.
Indessen war ihm das Rechtsstudium nicht unfruchtbar geblieben. Im ›Augenspiegel‹ zeigt er, wenn es in den Argumentationen hart auf hart geht, wie vortrefflich er den ungeheuren Wissensschatz des weltlichen wie des Kanonischen Rechtes zu handhaben versteht.